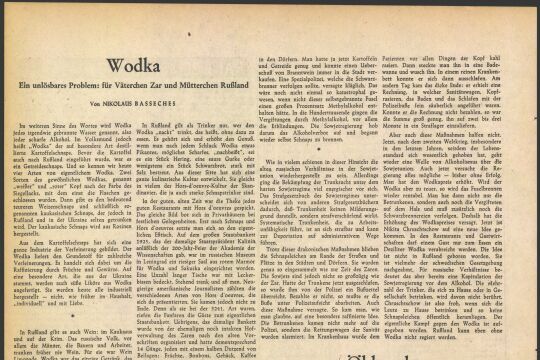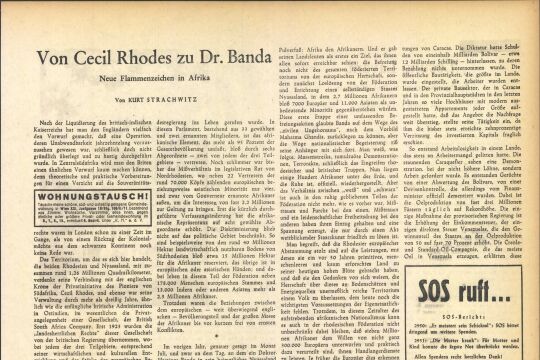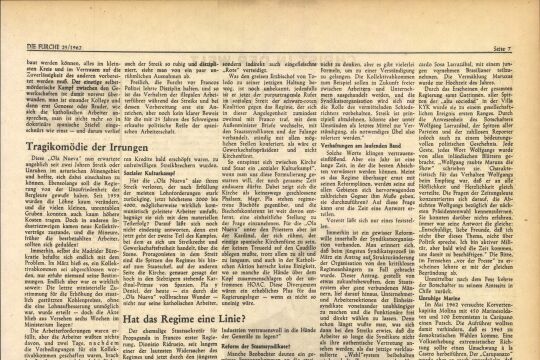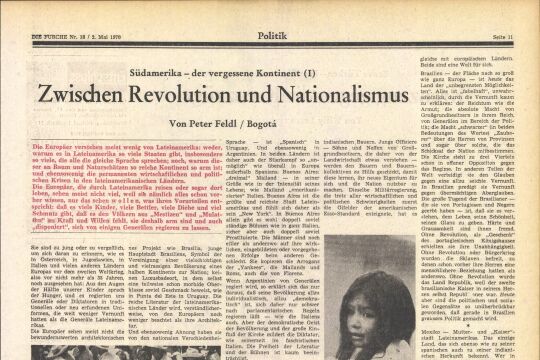Hugo Chavez wird Venezuela vermutlich weiter als Präsident regieren. Doch wegen seiner Krebserkrankung stellt sich die Frage, wer ihm nachfolgen soll, heute mehr denn je.
Hugo Chavez, der ehemalige Fallschirmjägeroffizier hat jetzt schon für einen demokratisch legitimierten Staatschef auf dem Subkontinent einen neuen Rekord aufgestellt: Er regiert sein Land seit mehr als 13 Jahren. Und er hat es nicht nur nachhaltig verändert, sondern auch tief gespalten: Die einen lieben und verehren ihn, die anderen hassen und verachten ihn aus tiefstem Herzen.
Der Mann, der sein Volk mit stundenlangen Ansprachen unterhält oder nervt, trat am 4. Februar 1992 in die Geschichte ein, als er an der Spitze eines Putschversuchs junger Offiziere stand. Noch im Gefängnis, wo er nach dem gescheiterten Putsch landete, avancierte Chávez zum Politstar. Nach seiner Begnadigung durch Präsident Rafael Caldera zwei Jahre später machte er sich an die Gründung einer linksnationalistischen Partei. Zur Kandidatur bei den Präsidentschaftswahlen 1998 wurde er geradezu gedrängt. Bei seinem Erdrutschsieg wurden die bis dahin bestimmenden Parteien, die sozialdemokratische Acción Democrática und die christdemokratische Copei, auf das Niveau von Splittergruppen reduziert und die vom Ölreichtum korrumpierte politische Klasse gedemütigt.
Und der neue Mann brachte frischen Wind in die Politik. Zunächst in der Symbolik, dann auch in der Substanz. Noch im ersten Amtsjahr ließ Chávez eine Verfassunggebende Versammlung wählen, die breit zusammengesetzt war und ein modernes Grundgesetz ausarbeitete. Von den zahlreichen Neuerungen wurde im Ausland in erster Linie die Aufhebung des Wiederwahlverbots für den Staatspräsidenten wahrgenommen. Eine erste Ankündigung, dass Chávez vorhatte, längere Zeit an der Staatsspitze zu verweilen, um das Land gründlich umzukrempeln.
Putschist statt Baseballstar
Der im Juli 1954 im Städtchen Sabaneta, Bundesstaat Barinas, geborene Hugo Chávez musste im Alter von neun Jahren mit dem Handwagen losziehen und Süßigkeiten verkaufen, weil die Familie vom bescheidenen Lehrergehalt des Vaters nicht leben konnte. Sein Traum, eines Tages Baseball-star zu werden, erfüllte sich nicht. Sprungbrett für den sozialen Aufstieg sollte die Militärakademie werden, in die der ehrgeizige junge Mann aus kleinen Verhältnissen mit 17 Jahren eintrat.
Der Militärputsch in Chile gegen den demokratisch gewählten Präsidenten Salvador Allende im September 1973 öffnete ihm die Augen, dass auch im Staate Venezuela einiges faul war. Schon als junger Kadett bildete er Lesezirkel mit Kameraden, in denen die venezolanische Militärgeschichte und die Werke des Unabhängigkeitshelden Simón Bolívar und anderer Vordenker Lateinamerikas studiert wurden.
Ab 1986 begann die Gruppe, einen Putsch vorzubereiten. Chavez Diskurs provozierte. Politische Gegner mussten und müssen sich oft wüste Beleidigungen gefallen lassen. Aber das Trommelfeuer der privaten Medien war an Rassismus und gezielten Falschinformationen kaum zu überbieten. Hugo Chávez war vom Tag eins im Präsidentenpalast einer Rufmordkampagne ausgesetzt, die ihresgleichen suchte.
Die Medien waren auch federführend, als es darum ging, den starken Mann, der an den Urnen nicht zu schlagen war, mit anderen Mitteln in die Knie zu zwingen. Aber Chávez überlebte einen Putschversuch am 11. April 2002 und einen monatelangen Streik im staatlichen Erdölkonzern PDVSA, der den Lebensnerv des Landes treffen sollte. Obwohl Venezuela weiterhin den Großteil seiner Erdölförderung in die USA exportiert, wird Chávez von Washington als Bedrohung für die Region gesehen. Das kommunistische Regime in Kuba ist ein natürlicher Verbündeter. Demonstrativ zelebrierte Freundschaft mit Autokraten wie Alexander Lukaschenko oder Irans Präsidenten Mahmoud Ahmadinejad entspringen aber wohl der schlichten Überlegung, dass gut sein muss, was die USA verabscheuen.
Man kann Chávez viel vorwerfen: dass er die Justiz manipuliert, dass er es trotz Agrarreform nicht geschafft hat, die Landwirtschaft zu beleben.
Es ist ihm nicht gelungen, die Korruption zu besiegen. Und die überbordende Gewaltkriminalität wird von allen, auch den Chávez-Anhängern, als Problem Nummer eins identifiziert. Caracas ist heute die gefährlichste Stadt des Kontinents. Aber im vergangenen Jahrzehnt hat sich nicht nur Venezuela, sondern ganz Lateinamerika verändert. Südamerika hat sich zunehmend aus der Umklammerung der USA gelöst und geht politisch wie wirtschaftlich zunehmend eigene Wege.
Der von Chávez ausgerufene "Sozialismus des 21. Jahrhunderts“ ist allerdings weitgehend Rhetorik geblieben. Die arme Bevölkerungsmehrheit steht heute dank der Sozialprogramme, der Misiones bolivarianas, besser da. Die Mitbestimmung beschränkt sich aber auf lokale Angelegenheiten.
Alles ist auf die Figur des Präsidenten zugeschnitten. Seine Anhänger sehen ihn als Messias. Wenn Hugo Chávez abtritt, hinterlässt er weder solide Strukturen, die das Überleben seiner Reformen garantieren, noch einen Nachfolger, der über die nötige Weitsicht und Autorität verfügt, um den Ölreichtum in ein nationales Projekt zu kanalisieren und die polarisierte Gesellschaft zu versöhnen.