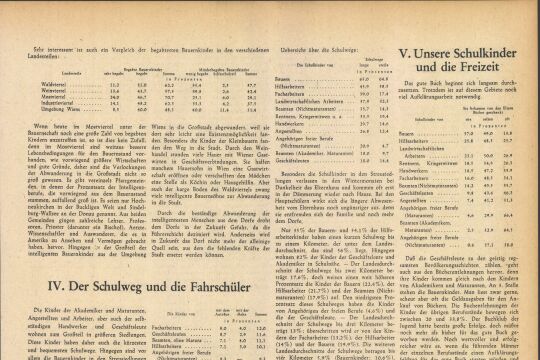Das Aufwachsen in modernen Gesellschaften ist nicht leicht. Sabine Andresen, Privatdozentin am Pädagogischen Institut der Universität Zürich, hat den Problemen der Kinder und Jugendlichen nachgespürt. Ein furche-Gespräch über junge Menschen und ihre Emotionen.
Die Furche: Sie beschäftigen sich mit der Bedeutung der Gefühle für die Konstruktion von Kindheit. Wie viel Gefühl braucht der Mensch, wie viel verträgt die Pädagogik?
Sabine Andresen: Die Vorstellungen, die wir Pädagoginnen und Pädagogen uns von Kindheit machen, sind sehr emotionsgeladen. Kindheit ist mit dem Kontext besonderer Intensität verbunden, und diese scheint Erwachsenen verloren gegangen zu sein. Insofern konfrontieren Kinder uns mit dem Gefühl des Verlustes. Tatsächlich startet das Kind mit seiner Neugier, die Welt zu entdecken - dabei ist der Wunsch, sicher zu seiner Bindungsperson zurückzukehren, ebenso stark. Doch welcher Erwachsene kennt dieses Gefühl - abgeschwächt vielleicht - nicht? Auf der anderen Seite ist das pädagogische Bild von Kindheit vor allem von der Idee des leidenden Kindes geprägt, was zu seiner Idealisierung führt.
Die Furche: Die Pädagogik hat die Bedeutung der ersten Lebensjahre im Kreis der Familie stets betont. Im Zuge der Kinderbetreuungsdiskussion hat sich diese Frage zugespitzt. Wie viel "Mutter" braucht das Kind?
Andresen: Die Mütter werden noch immer angehalten, in den frühen Jahren alles dafür zu tun, dass die Kinder die besten Voraussetzungen für ihre weitere Entwicklung haben. So wichtig diese frühkindlichen Erfahrungen sind: Es müssen nicht immer die Mütter sein, die sie in aller Ausschließlichkeit vermitteln. Wir haben in Deutschland und Österreich die Vorstellung, Kinder sind am besten und ausschließlich in den Familien zu betreuen. Die Familie ist unbestritten wichtig, ebenso bedeutsam sind aber auch frühe Erfahrungen der Kinder in Institutionen - hier meine ich gute pädagogische Institutionen mit qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Sie schaden den Kindern nicht, im Gegenteil: Kinder können dort bestimmte Kompetenzen entwickeln und frühe Erfahrungen in der Peergroup machen. Ich wünsche mir jedenfalls eine entideologisierte Debatte der Kinderbetreuung. Studien zeigen eher eine andere Risikogruppe von Familien und damit Kindern und Jugendlichen, nämlich jene, die von Armut betroffen sind: Das wirkt sich gravierend auf den weiteren Lebensweg der Heranwachsenden aus. Die Leiter aus der Armut ist für die betroffenen Familien gerade die Berufstätigkeit der Mütter.
Die Furche: Die Grenze zwischen Kindheit und Jugend verschiebt sich zusehends. Wo ziehen Sie die Grenze zwischen diesen beiden Lebensaltern?
Andresen: Wir haben uns angewöhnt, die Lebensalter nach Übergängen in die pädagogischen Institutionen einzustufen. Die Grundschule ist sicher ein zentraler Übergang, ebenso der Übertritt der Zehn- bis Zwölfjährigen in weiterführende Schultypen. Daraus leite ich allerdings nicht ab, dass ausgerechnet dieses Lebensalter der richtige Zeitpunkt für Schulwechsel oder Selektion ist. Angehörige dieser Altersgruppe gehören nicht mehr richtig in die Kindheit und lassen sich auch nicht der Jugend zurechnen. Die traditionelle Jugendkunde hat zwischen Pubertät und der Adoleszenz unterschieden. Doch diese Übergänge gestalten sich vielfältig, wenn etwa eine Schülerin in eine höhere Klasse wechselt oder eine andere als Schulabgängerin in die Berufsausbildung geht.
Die Furche: Apropos Beruf: Die Lücke an Lehrstellen nimmt in Österreich stetig zu. Derzeit stehen 3.460 Lehrstellensuchende 2.272 offenen Lehrstellen gegenüber. Wie wirkt sich Arbeitslosigkeit emotional auf die Jugendlichen aus?
Andresen: Es ist unumstritten, dass man derzeit die junge Generation ohne Perspektive für die Zukunft lässt. Der Beruf ist nach wie vor entscheidend für die individuelle Lebensgestaltung, für die Zufriedenheit, für gesellschaftliches Engagement. Der politische Trend geht dahin, dass die Risiken, die auf dem Arbeitsmarkt vorhanden sind und alle betreffen, privatisiert werden: So sollen Eltern für ihre Kinder etwa eine Berufsausbildungsversicherung abschließen. Eltern müssen heute ohnehin schon viel für ihre Kinder aufwenden, während sich die Wirtschaft zum Teil aus der Verantwortung nimmt und die Probleme der Politik zuschiebt. Hier herrscht eine katastrophale Politik des Verschiebebahnhofs.
Die Furche: Welchen Stellenwert geben Jugendliche dem Faktor Arbeit?
Andresen: Die Shell-Studie "Jugend 2002" belegt, dass Jugendliche an Beruf und Karriere orientiert sind. Doch was ist, wenn der Bildungsabschluss nicht ausreicht? Dann landen die Betroffenen in der Perspektivenlosigkeit; das sollen und können wir uns - auch aus politischen Gründen - nicht leisten. Es muss ein gesamtgellschaftliches Anliegen sein, junge Leute in einen Beruf zu bringen, der ihnen nach Möglichkeit eine sichere Zukunft und damit Perspektiven bietet.
Die Furche: Welche Auswege sehen Sie?
Andresen: Momentan geht der Trend dahin, dass immer jeweils der andere Partner des Generationenvertrages für die Misere verantwortlich gemacht wird: Die Betriebe behaupten, dass schlecht ausgebildete Jugendliche von der Schule abgehen, die nicht lesen, schreiben und rechnen können. Die Schulen sagen, es liege an den Familien, die zu wenig Zeit für ihre Kinder gehabt - und deshalb versagt hätten. So wird die Verantwortung von einer Position zur anderen verschoben. Es ist für mich ein erster wichtiger Schritt, die verschiedenen Verantwortungsgruppen in die Pflicht zu nehmen und zu schauen, wo man ansetzen kann, dass Jugendliche in Ausbildung und Berufstätigkeit kommen können. Die Schule hat wichtige Anknüpfungspunkte mit Berufsvorbereitungsmaßnahmen gesetzt, das müsste weiter ausgebaut werden. Und die Wirtschaft muss mehr Bereitschaft zur Ausbildung von Jugendlichen zeigen. Man muss so früh und effektiv wie möglich ansetzen, dass Jugendliche nicht aus dem System herausfallen - und damit gedemütigt werden.
Die Furche: Die Familie hat laut Shell-Studie eine hohe Priorität für junge Menschen. Wie schätzen Sie speziell die Lebensorientierung junger Frauen ein?
Andresen: Wenn Jugendliche zu ihren Zukunftsperspektiven befragt werden, dann gehören Familie und Karriere dazu. Bei Mädchen ist die Diskussion der Vereinbarkeit von Familie und Beruf stärker als bei Jungen. In jedem Fall besteht eine hohe Bereitschaft zur Familiengründung. Dieser Befund unterscheidet sich in Teilen von früheren Studien. Heute werden Frauen älter, bevor sie ihr erstes Kind bekommen. Da der Kinderwunsch auch gesellschaftlich gewollt ist, braucht es Rahmenbedingungen dafür, dass junge Frauen wie junge Männer ihre Familien gründen können. Familiengründung ist unbestritten mit einem finanziellen Aderlass verbunden. Die momentane Strategie, nicht Familien zu entlasten, sondern Kinderlose zu belasten, ist aber nicht zielführend. Hier müsste ein Perspektivenwechsel stattfinden: Wo kann man Familien - besonders Mütter - strukturell unterstützen? Schließlich tragen die Mütter ja nach wie vor die Doppelbelastung.
Das Gespräch führte Christina Gastager-Repolust.
Schwieriges Erwachsenwerden
Der richtige Umgang mit Emotionen ist - gerade im pädagogischen Alltag - kein Kinderspiel: Das weiß Sabine Andresen nur zu gut. Als Privatdozentin und wissenschaftliche Oberassistentin am Pädagogischen Institut der Universität Zürich hat sie sich intensiv mit dieser Frage beschäftigt. Zuletzt auch in ihrer 2003 erschienenen Habilitationsschrift, in der sie anhand sozialistischer Kindheitskonzepte das Thema "Kindheit und Politik" unter die Lupe nahm. Auch die Reformpädagogik und die Jugendkulturforschung stehen im Zentrum von Andresens Forschungen. Im Rahmen der 53. Internationalen Pädagogischen Werktagung, die sich Mitte Juli dem Thema "Wie viel Gefühl braucht der Mensch?" widmete, referierte sie über "Gefühle und ihre Bedeutung für die Konstruktion von Kindheit" und leitete einen Werkkreis über "Jugendkulturen und was wir über sie wissen."