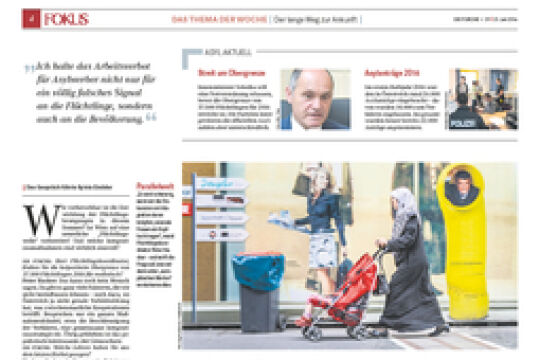Wenn wir in Österreich über Flüchtlinge sprechen, dann geht es momentan vor allem um Zahlen. Wir feilschen um die 88 Prozent, also den realen Anteil der ihnen zugeteilten Flüchtlinge, den die Bundesländer tatsächlich in ihren Gemeinden unterbringen sollen. Wir streiten um die Zahl, bei der die Kapazität des Erstaufnahmezentrums Traiskirchen erschöpft ist: Für Landeshauptmann Pröll 480, für den Bürgermeister von Traiskirchen 874, für Innenministerin Mikl-Leitner 1397, für die Betreuungsfirma der Unterkunft 1840. Wir diskutieren, wie viele Feldbetten man in Turnsälen von Polizeischulen unterbringen kann und vergessen bei all der komplizierten Logistik leicht (und vielleicht auch gar nicht ungern), dass wir eigentlich von Menschen sprechen.
Bipolarer umgang
"Helfen, natürlich. Aber bitte nicht bei uns!", fordern wir mit der selben Entrüstung, mit der unsere Bürgermeister, stellvertretend für uns, mit den Landeshauptleuten, und die wiederum mit der Innenministerin streiten, wo diese Zahlenmenschen bleiben sollen. Und seit Monaten liegt die FPÖ in allen Umfragen an erster Stelle.
Das ist die eine Seite. Doch es gibt noch eine andere. Erst diese Woche fuhr eine Delegation aus Bad Ischl nach Wien, um sich direkt im Innenministerium für ein Bleiberecht für eine armenische Familie aus ihrem Ort einzusetzen, die kurz vor der Abschiebung steht. Der Mechanismus ist nicht neu: Wenn das Drama greifbar wird, formiert sich ein Schutztrupp aus Lehrern und Freunden, Pfarrern und Vereinskollegen, Mitschülern und Nachbarn. Wenn wir uns betroffen fühlen, weil Menschen aus unserem Umfeld, "Unsrige", tatsächlich betroffen sind, machen wir uns stark für sie.
Der Widerspruch findet sich auch im "Radar für gesellschaftlichen Zusammenhalt", mit dem die deutsche Bertelsmann Stiftung regelmäßig misst, was verbindet. Im Vergleich zu den anderen 34 untersuchten Ländern ist Österreich besonders stark bei "Solidarität und Hilfsbereitschaft". Beschämend weit unter Durchschnitt liegen wir allerdings beim Umgang mit Diversität. Das erklärt unseren bipolaren Umgang mit Flüchtlingen: Sobald wir Menschen als zu-uns-gehörend empfinden, weil wir sie aus der Schule, der Pfarre, dem Sportverein kennen, engagieren wir uns für sie. Solange sie aber fremd sind, bleiben sie eine Zahl, die wir lieber nicht verwalten möchten.
Mehr Mut, mehr Mitgefühl
Aus diesem Widerspruch ergeben sich relevante Schlüsse: (1) Auch wenn das Asyl-Thema als politisch "heikel" gilt, können sich Politiker -vom Gemeinderat bis zur Innenministerin - mehr Mut leisten. Sie können es ihren Bürgern zumuten, neben Flüchtlingen zu leben, auch wenn anfangs protestiert wird. Sind die Asylwerber erst einmal da, das zeigt sich in vielen Orten, funktioniert das Miteinander meist gut.
(2) In welcher Form Sorgen gegen Quartiere formuliert werden, hängt vom Stil der öffentlichen Diskussion ab. Spricht der Bürgermeister vom "gefährdeten sozialen Frieden" (wie im oberösterreichischen Golling) oder ein Bezirkshauptmann von "Gefahr in Verzug"(wie in Baden), wird Angst geschürt, Abneigung gespeist, der unrühmliche Umgang mit Diversität fortgeschrieben. (3) Um diesem Prozess entgegenzuwirken, müssen wir Österreicher an unserem Wir-Begriff arbeiten. Identifizieren wir uns nur mit Menschen, die uns ähnlich sind? Oder können wir uns vorstellen, auch jemandem mit einer anderen kulturellen Prägung/Muttersprache/Hautfarbe/Religion/sexuellen Orientierung zu den "Unsrigen" zu zählen?
Das Schlachten im Nordirak, der Bürgerkrieg in der Ukraine, die Konflikte in Gaza, Syrien und Libanon. Das Wüten der Islamisten in Nigeria, des Hungers in Westafrika und Südsudan - all diese Tragödien betreffen auch uns. Die Reaktion darauf darf nicht Angst sein, sondern ein Gefühl der Verbundenheit. Das zu etablieren ist eine kollektive, auch politische Aufgabe.
veronika.dolna@furche.at
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!