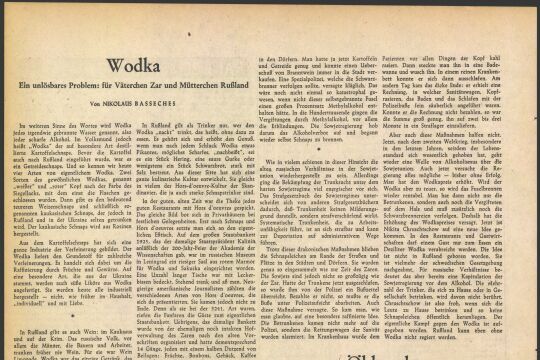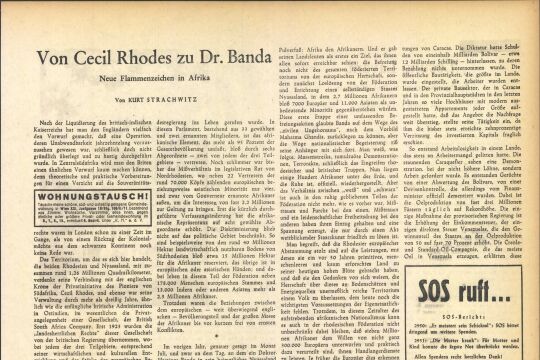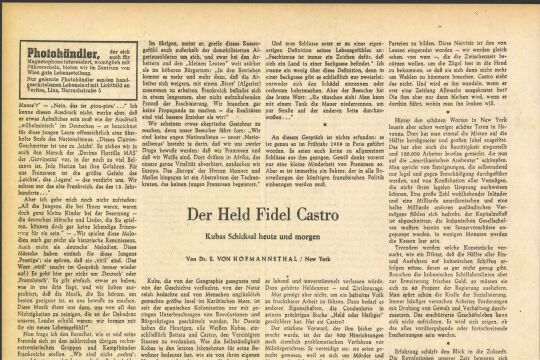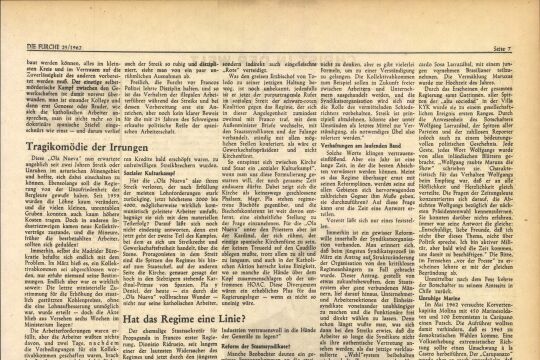Bald 60 Jahre, nachdem Che Guevara mit seinem Motorrad durch Lateinamerika gereist ist, macht der Autor eine Ländertournee in der Region – und ärgert sich über die immer noch große Ungerechtigkeit.
Guatemala, November 2009
Guatemala ist stabil. Der Wechselkurs des Quetzal gegenüber dem US-Dollar hat sich seit über zehn Jahren kaum verändert. „Die Wirtschaftskrise trifft uns kaum“, jubeln Unternehmer in den lokalen Zeitungen. Solche Aussagen zeigen, dass sich im reichsten Land Zentralamerikas auch in anderer Hinsicht wenig verändert hat: Die Hälfte der Bevölkerung wird von der weißen und mestizischen Elite ausgeblendet. Wenn im Hochland, wo die Mehrheit der indianischen Bevölkerung auf kleinen Parzellen überleben muss, Kinder verhungern, wird das nicht als Symptom einer Krise wahrgenommen. Gustavo Porras, ein aus der sozialchristlichen Bewegung kommender Intellektueller, hat man vor vierzig Jahren auf die Abschussliste der Militärs gesetzt, weil er im Radio mit der Aussage zitiert wurde, zwei Prozent der Bevölkerung kontrollierten 72 Prozent des fruchtbaren Landes. Er wurde, wie er in einem jüngst erschienenen und viel diskutierten Buch schreibt, dazu gedrängt, unterzutauchen und sich der Guerilla anzuschließen. Heute darf man solche Aussagen treffen, ohne sein Leben aufs Spiel zu setzen. Die schreiend ungleiche Verteilung von Land und Reichtum ist genauso krass wie damals. Aber kein Politiker wagt es, daran zu rütteln. Die mächtigen Unternehmer drohen schon mit einem Aufstand, wenn die Einführung einer Vermögenssteuer auch nur diskutiert wird.
Honduras
Was passiert, wenn die Interessen der wirtschaftlich und politisch dominanten Oberschicht bedroht werden, zeigt sich gerade in Honduras. Präsident Manuel Zelaya, der sich anschickte, via Verfassungsreform die verkrusteten Strukturen aufzubrechen, wurde am Vorabend einer Abstimmung über die Einberufung einer Verfassunggebenden Versammlung weggeputscht. Militärs holten ihn am 28. Juni aus dem Bett und verfrachteten ihn in ein Flugzeug nach Costa Rica. Der Kongress nahm wenige Stunden später ein Rücktrittsgesuch „aus gesundheitlichen Gründen“, das auch das ganze Kabinett Zelayas betraf, mit großer Mehrheit an. Parlamentspräsident Roberto Micheletti wurde in Windeseile als neuer Staatschef vereidigt. Dass das Rücktrittsschreiben eine grobe Fälschung war, sollte nicht stören: der Oberste Gerichtshof erklärte die Vorgangsweise als verfassungskonform.
Diese Staatsgewalten sollen jetzt darüber befinden, ob Zelaya wieder eingesetzt wird. Kein Wunder, dass ein von den USA eingefädeltes Abkommen nach wenigen Tagen in der Sackgasse endete. Zelaya sitzt in der brasilianischen Botschaft, die ihm Unterschlupf gewährt hat. Eine breite „Widerstandsfront gegen den Staatsstreich“ mobilisiert auf den Straßen und trifft dabei immer wieder auf brutale Repression. Es sind nicht nur die traditionell kämpferischen Bauernorganisationen, die sich gegen das De-facto-Regime und dessen rückwärtsgewandte Politik wenden. Da gibt es auch „Künstler gegen Putsch“, „Feministinnen gegen den Putsch“ und selbst von den politisch konservativen Straßenhändlern schließen sich viele den Demonstrationen an.
Die Demonstranten, die sich täglich mit Transparenten, Trillerpfeifen und Trommeln vor dem Kongress einfinden, sind gut organisiert. Sie vermeiden jede Provokation, die ein Einschreiten der vor dem Gebäude postierten Soldaten und der mit Schlagstöcken und Tränengas bewaffneten Polizisten rechtfertigen könnte. „Compañeros, bleibt auf dem Gehsteig, blockiert die Straße nicht“, schreitet ein Ordner ein. Wenn es dunkel wird, gehen alle nach Hause, um am nächsten Tag zurückzukommen.
Hinter Micheletti stehe eine Handvoll oligarchischer Familien, die immer Privilegien genossen haben „und diese auch behalten wollen“, meint selbst Christian Lüth, der lokale Vertreter der FDP-nahen Friedrich-Naumann-Stiftung, die anfangs viel Verständnis für die Putschisten zeigte. Die Stiftung hatte sich von Zelaya abgewandt, als dieser sich dem von Venezuelas Hugo Chávez dominierten Wirtschaftsbündnis ALBA anschloss und seine Rhetorik dem linken Jargon anpasste. Der Import billigen venezolanischen Öls traf die Interessen der Oligarchie ebenso wie der Stop verschiedener Privatisierungsprojekte, bei denen sich Unternehmerclans bereits saftige Gewinne versprochen hatten.
Am 29. November wird ein neuer Präsident gewählt. Welche Legitimität der genießen wird, wenn die Wahlen unter Bedingungen von Putsch und Repression stattfinden, muss sich erst zeigen. Sicher ist, dass die Widerstandsbewegung weiter für eine Reform der verkrusteten Verfassung demonstrieren wird. Die Beseitigung des Wiederwahlverbots, die Zelaya anstrebte, ist da nur ein Nebenaspekt.
Nicaragua
Das in der Verfassung verankerte Wiederwahlverbot machte auch Daniel Ortega zu schaffen. Der Sandinistenchef, der 1990 samt der Revolution abgewählt wurde, schaffte vor drei Jahren beim vierten Anlauf ein Comeback. Und er versucht nicht nur in der Rhetorik, sondern auch in der Politik an die Revolution anzuknüpfen. Die schleichende Privatisierung von Unterricht und Gesundheit wurde gestoppt. Schulgeld und Krankenhausgebühren gehören der Vergangenheit an. Auf dem Land wird den Kindern in der Schule sogar ein Frühstück geboten. Ein Null-Hunger-Programm soll die Armut der Kleinbauern bekämpfen. Billiges Öl und weiche Kredite aus Venezuela helfen, diese Programme zu finanzieren. Doch inzwischen geht Ortega das Geld aus. Das Budget kracht aus den Nähten und die großzügigen Sozialleistungen werden nächstes Jahr drastisch gekürzt.
Wie einst im Realsozialismus scheinen im heutigen Nicaragua Sozialstaat und Demokratie in einem unauflöslichen Widerspruch zu stehen. Vor den Kommunalwahlen vor einem Jahr wurden zwei Oppositionsparteien aus windigen Gründen verboten. Bis heute kämpfen die Sandinistische Erneuerungsbewegung (MRS) und die Konservative Partei um ihre Wiederzulassung. Organisationen, die zu Demonstrationen gegen die Regierung aufrufen, werden als „Werkzeuge des Imperialismus“ verunglimpft und von sandinistischen Schlägertrupps auseinandergetrieben. Dass Ortega trotz zunehmender Unzufriedenheit noch lange regieren kann, ermöglichte Mitte Oktober der Oberste Gerichtshof. In einer von Juristen als hanebüchen bezeichneten Argumentation hat er auf Antrag von Ortegas Anwälten erklärt, das Wiederwahlverbot verstoße gegen den Gleichheitsgrundsatz. Schließlich könnten ja Abgeordnete auch unbeschränkt wiedergewählt werden. Dieser Meinung schließt sich auch der Historiker und ehemalige Diplomat in Ortegas Diensten, Aldo Díaz Lacayo, an. Er sieht nichts Undemokratisches an einer neuerlichen Kandidatur: „Die Opposition hat ja nur Angst, gegen Ortega antreten zu müssen.“
Dora María Téllez, einst Guerillakommandantin und später Gesundheitsministerin, jetzt in der oppositionellen MRS: „Das Problem ist, dass in Nicaragua Wiederwahl und Wahlschwindel immer Hand in Hand gehen.“ Der offene Betrug bei den Kommunalwahlen vom November 2008 ist für die Opposition ein deutliches Indiz, dass für die Präsidentschaftswahlen in zwei Jahren Ähnliches vorbereitet werde. Wie es aussieht, werden dann zwei alternde Caudillos gegeneinander antreten: Daniel Ortega und der korrupte Frontmann der Liberalen, Arnoldo Alemán, der nach seiner Amtszeit (1997–2002) wegen Unterschlagung von Millionenbeträgen zu 20 Jahren Haft verurteilt wurde. Ortega hat inzwischen die Aufhebung dieses Urteils veranlasst.
El Salvador
Aufbruchsstimmung herrscht in El Salvador. Das kleinste Land des Isthmus wird seit einem halben Jahr von Mauricio Funes, dem Kandidaten der ehemaligen Guerillafront FMLN, regiert. Der ehemalige Starjournalist versucht nach 20-jähriger Herrschaft der rechtsextremen ARENA zunächst die Rechtsstaatlichkeit herzustellen. Viele seiner Anhänger hätten sich radikale Reformen erwartet. Doch bevor etwa das Steuersystem umgekrempelt wird, so argumentiert Funes, müsse einmal das bestehende Gesetz durchgesetzt werden. Reiche und Unternehmer haben sich mit der Komplizenschaft der bisherigen Regierungen immer um das Zahlen von Abgaben gedrückt. Fast jede Woche wird ein neuer Skandal aufgedeckt, wie ARENA-Funktionäre und deren Freunde sich am Staat bedienten. Der frühere Präsident Antonio Saca hat in seinen letzten fünf Amtsmonaten je sieben Millionen Dollar aus dem „vertraulichen Budget“ ausgegeben, einer Art Privatschatulle, über deren Verwendung der Staatschef keine Rechenschaft legen muss.
Funes und seine Minister erleben derzeit jedenfalls einen Höhenflug in den Umfragen, während die ARENA in eine tiefe Krise geraten ist.
Das von Hurrikan Ida ausgelöste Unwetter, das mehr als 150 Menschen das Leben gekostet und Tausende weitere ihrer Existenzgrundlage beraubt hat, lieferte einen Hinweis auf die prekäre Lage der Bevölkerungsmehrheit. Dass die neue Regierung in fünf Jahren mit Armut und Ungerechtigkeit aufräumt, wird kaum jemand erwarten. Dass sie sich um eine Trendumkehr bemüht, kann man aber von ihr verlangen.