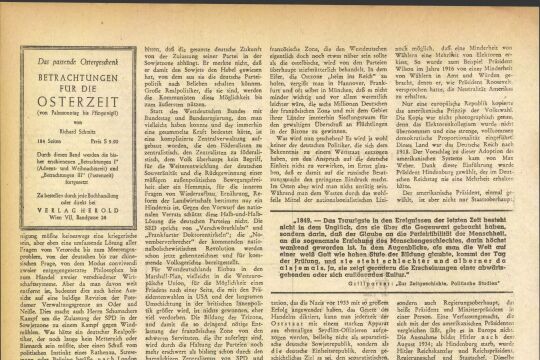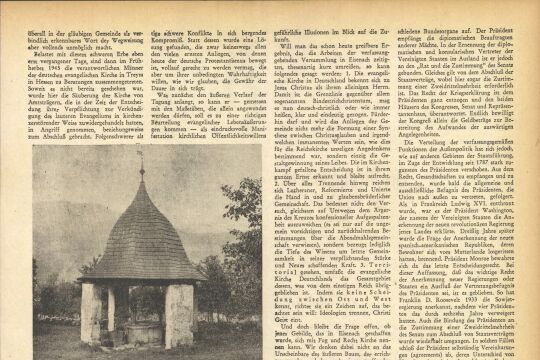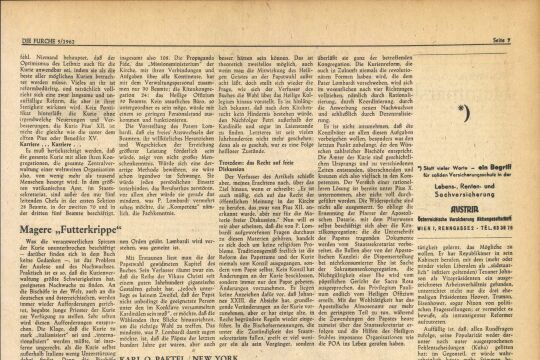Barack Obama wird in seiner zweiten Amtszeit Wunderbares bewirken müssen. Die Gräben im Inneren glätten, die Wirtschaftskrise eindämmen und den Staat wieder handlungsfähig machen. Eine Vorschau auf die kommenden Jahre.
Die Innenpolitik
Der Zwang, ein Wunder zu vollbringen
Barack Obamas zweite Amtszeit beginnt wesentlich gedämpfter als die begeisterungsschwangere erste. Wenn er es nicht schafft, die republikanische Partei zu einem Konsens zu bewegen, wird er zur Lame Duck.
Im Sommer 2011 reiste US-Finanzminister Timothy Geithner persönlich nach Europa, um in einer Tour de Force Europas führenden Politikern die Leviten zu lesen: Zu langsam und mutlos sei die Reaktion auf die Schuldenkrise in Griechenland, zu schwerfällig das Mischsystem aus Politgipfeln und Mitspracherecht der nationalen Parlamente. Geithner traf mit seiner Kritik wohl einen wunden Punkt der Unionspolitik. Aber verglichen mit den politischen Hemmnissen, denen Barack Obama ausgesetzt sein wird, wirkt die EU geradezu wie ein Hort demokratischer Effizienz.
Schon Obamas erste Amtszeit litt unter einem ungewöhnlich hohen Maß unter Blockaden in Senat und Kongress: In der Gesundheits-, der Umwelt-, der Budgetpolitik - nirgendwo konnte der Präsident durchsetzen, was er eigentlich vorhatte. Obama und der "Patient Amerika“ (Spiegel) verloren dadurch einen Teil ihrer Handlungsfähigkeit - und Obama selbst scheiterte an seinem wohl wichtigsten Krisenprojekt: Der Herstellung eines nationalen Konsens über Wege aus der ökonomischen Misere.
Doch die Voraussetzungen für einen solchen Gemeinssinn sind nun düsterer denn je. Dafür hat die Teapartybewegung gesorgt, die vor allem ein Ziel hat - die Indoktrinierung der eigenen Klientel auf radikale Positionen und die Ausgrenzung aller Andersdenkenden. So wurde auch die Wahl als Entscheidung zwischen dem Guten und dem Bösen (Obama) schlechthin stilisiert: "Will we vote out liberty?“ "Will the evil reign our country“ - das waren Geschichten, mit denen den Teapartisten die Nachrichtenkanäle fluteten. Diese Front wird auch durch das matte Bekenntnis des unterlegenen republikanischen Herausforderers Mitt Romney zur politischen Zusammenarbeit mit Obama nicht aufbrechen.
In der US-Politik, die noch vor wenigen Jahren als weitgehend ideologiefrei galt, ist Teaparty so etwas wie die Selbstermächtigung der Grundrechts-Rechten. "Die Entdeckung des Klassenkampfs“, nennt das die Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Ausgrenzungs-Strategien
Tatsächlich bestimmen soziale Ängste das politische Credo. Bei der Teaparty werden die Abstiegs-ängste des Mittelstandes in politische Aggression umgesetzt. Wer in der Tea-Party ist, ist demgemäß nicht für etwas, sondern zunächst und vor allem gegen etwas: Gegen das Establishment, gegen Obama, gegen Medicaid, die Abtreibung, die Kriminalität und die Verwässerung des Leistungselite-Traums. Vor dem Hintergrund einer nicht bewältigten Wirtschafts- und Jobkrise stellt die "We are the people“-Partei konsequenterweise auch fest, wer nicht zum Volk gehört: Immigranten, Schusswaffengegner, Abtreibungsbefürworter, Klimawandel-Besorgte.
Mit dieser einflussreichen Lobby muss sich Obama nicht nur auseinandersetzen, sondern ihr zu einem Teil auch gehorchen, will er Gesetzesvorschläge mit breiter Mehrheit abstimmen. Dabei geht es nicht nur um das Budget, sondern auch um Weichenstellungen in der Klima- und Außenpolitik. Bei der in den Wahlen am Dienstag neuerlich zementierten Dominanz republikanischer Abgeordneter im Repräsentantenhaus kann der demokratische Präsident zu einer handlungsunfähigen "Lame Duck“ wird, wenn die Republikaner systematisch ihren Konsens verweigern. Die Auseinandersetzung zwischen den Systemen wird sofort sichtbar werden, wenn der Kongress noch in diesem Jahr eine neue Entscheidung über die Schuldenobergrenze des Budgets braucht. Schon einmal, 2011 hatte die Unfähigkeit der Parteien, eine gemeinsame Strategie zu entwickeln, zu einem bankrottähnlichen Zustand geführt. Ein massiver Vertrauensverlust und eine Spekulationeswelle auch gegen die Staatsanleihen notleidender Eurostaaten war die Folge.
Statt einer nachhaltigen Lösung verschoben die Parteien das Problem auf die Zeit nach den Wahlen. Es ist also die erste Bewährungsprobe für Barack Obamas zweite Amtszeit. Es ist, wie die Washington Post kommentierte, der Zwang ein Wunder zu vollbringen.
Die soziale Lage
Superreich oder arm
Die USA stehen zunehmend unter massiven sozialen Spannungen, die politisch gelöst werden müssen.
Es war nur noch ein Häuflein teils nostalgischer New Yorker, die sich zum Jahrestag der Occupy-Wallstreet-Bewegung aufmachte, erneut die Stätte ihres sechs Monate langen Wirkens aufzusuchen und vielleicht doch einen Neustart der Bewegung zu versuchen, die die Welt in Erstaunen versetzt hatte. Doch die "Wir sind die 99 Prozent“ -Bewegung verlief sich nach dem Ehrentag so schnell wie sie zustandegekommen war. Die sozialen Probleme und die massive Ungleichverteilung der Vermögen, auf die Occupy aufmerksam gemacht hatte, bleiben bestehen. Nach einer Studie der Ökonomen Thomas Piketty und Emmanuel Saez wuchs das Vermögen der Amerikaner in den vergangenen 17 Jahren um 13 Prozent. Jenes der reichsten vier Millionen US-Bürger stieg dagegen um mehr als 50 Prozent. Dieser Trend wurde durch den Wirtschaftseinbruch 2008 geringfügig gedämpft. Die aktuelle Verschuldung der US-Privathaushalte beträgt mehr als 90 Prozent des BIP.
Vom Geben der Nehmer
Die New York Times las aus den vorliegenden Daten, dass der Anteil des einkommensstärksten Hundertstels der Bevölkerung am Gesamteinkommen heute so hoch ist, wie zuletzt bei der Weltwirtschaftskrise in den 30er-Jahren. Der Schweizer Finanzexperte Marc Faber, der zahlreiche Investmentfirmen berät, hält diese Entwicklung für gefährlich für die Volkswirtschaft. Denn die Reichen allein könnten die Wirtschaft nicht unterhalten.
Immer wieder machen einzelne Superreiche von sich reden, wenn sie mit Hunderten Millionen Dollar soziale Projekte unterstützen, wie Microsoft-Gründer Bill Gates oder der Filmressigeur George Lucas. Doch die Reichsten sind im Schnitt weniger freigiebig als andere Bürger.
Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Chronicle of Philantrophy, der die Spendenfreudigkeit der US-Bürger nach Einkommen aufgeschlüsselt hat. Demnach geben Bewohner von Bezirken in denen über 40 Prozent der Bewohner über 200.000 Dollar pro Jahr verdienen nur 2,8 Prozent ihres Gehalts für Spenden an sozial Bedürftige aus. In der Einkommensklasse zwischen 50.000 und 75.000 Dollar waren es dagegen 7,6 Prozent. Doch der Anteil dieser sozialbewussten Einkommensklassen sinkt - der Mittelstand schrumpft seit den 90er Jahren massiv. Die Zahl der vom Abstieg in die Armut bedrohten Menschen wird derzeit mit 120 Millionen angegeben. Über 42 Millionen US-Bürger leben bereits unter der Armutsgrenze und laut US-Zensus werden es jährlich um etwa 2.3 Millionen Arme mehr.
Die Erderwärmung
Die Klimapolitik der List
Barack Obama konnte trotz politischer Blockade in der Klimapolitik einiges bewegen - vor allem dank der Initiative einzelner Bundesstaaten.
Sind die USA mit ihrer Weigerung sowohl den Kyotoprozess beizutreten als auch ein haltbares Nachfolgeabkommen zu mitbeschließen tatsächlich der "Klimakiller Nummer 1“, wie europäische Boulevardzeitungen meinen? Ein Blick auf die Präsidentschaft Obama I zeigt ein wesentlich differenzierteres Bild der Initiativen der USA.
Richtig ist, dass Barack Obamas Gesetzespaket zur Senkung der Treibhausgase wegen republikanischen und innerparteilichen Widerstands nicht den Senat passiert konnte. Es gibt also weiterhin weder bundesweit geltende Klimaziele noch Ausbauziele für erneuerbare Energien. Aber immerhin schaffte es der Präsident sozusagen über die Hintertüre einige Regulative an den Klimaskeptikern in Washington vorbei in die Gesetzgebung einzuschleusen.
Klimaschutz über die Hintertür
Mit dem Konjunkturpaket wurden beispielsweise Investitionen von rund 80 Milliarden Dollar in "grüne“ Projekte wie Energieeffizienz, die erneuerbaren Energien und den Ausbau der Stromnetze gelenkt. Mehr als 51 Milliarden davon sind bereits investiert. Außerdem sollen ab 2020 strengere Abgasvorgaben für Kraftfahrzeuge gelten. Die USA schließen in dieser Hinsicht sogar zu den strengen EU-Richtlinien auf.
Das alles verkaufte Obama auch unter dem Deckmantel eines neuen Plans, der die Vereinigten Staaten "energieautark“ machen soll und von den Republikanern schwer abgelehnt werden kann. Darüber hinaus ist die US-Umweltbehörde EPA wesentlich strenger in ihren Vorgaben geworden. So wurde der Einsatz von Schadstoff- und CO2-Filtern bei Kohlekraftwerken verpflichtend.
Doch die eigentlichen Betreiber der US-Klimapolitik sitzen nicht in Washington, sondern in den einzelnen US-Bundesstaaten, die einerseits rigide Gesetze zur Senkung des CO2-Ausstoßes erlassen haben, andererseits in den CO2-Zertifikatehandel eingestiegen sind, wie etwa Kalifornien. Der Thinktank "Ressources of the Future“veröffentlichte jüngst eine Studie, wonach der CO2-Ausstoß im Land im Sinken begriffen ist und die USA auch ohne jedes Bundesgesetz bis 2020 an das in Kopenhagen vereinbarte Ziel einer 17 prozentigen Reduzierung von Treibhausgasemissionen herankommen dürften. So weit die Fortschritte einzelner Teilstaaten sind, so mangelhaft wird der globale Einsatz der USA in Sachen Klima bleiben. Wenn am 26. November die Weltklimakonferenz in Doha beginnt, dann wird wieder eine Regierungsdelegation mit Untätigkeit und Achselzucken glänzen und anderen mit schlechtem Beispiel vorangehen: jene der USA.
Die Aussenpolitik
Ein Weltpolizist auf Abruf
Afghanistan, Iran, Syrien und die Demokratiebewegungen im Nahen Osten: Die Außenpolitik von Barack Obama steht bis 2016 vor einigen kaum zu lösenden diplomatischen Aufgaben.
Wer die Geschichte der US-Wahlen zurückverfolgt, wird kaum einen Wahltag finden, an dem es in der laut Experten gefährlichesten Region der Welt - dem Nahen Osten zu kriegerischen Aktionen gekommen wäre. Es ist gerade so, als macht die Krise für diesen einen Tag Pause, um jenen Politiker (wieder) zu beäugen, der bis 2016 versuchen wird, Frieden oder zumindest eine Form von Stabilität zu bringen zwischen dem östlichen Mittelmeer und dem Hindukusch.
Die Wahl 2012 machte da eine Ausnahme - denn die Herren des Gemetzels in Syrien kümmerten sich nicht um das Wollen und Werden der USA. Darin wird auch die erste große Herausforderung der zweitzen Amtszeit Barack Obamas liegen - sich mehr als bisher Gehör in einem Raum zu verschaffen, der zwischen Demokratieversuch, relativer Anarchie und Bürgerkrieg gefangen ist.
Bei allen Beteuerungen der ausgehenden Administration, den Roadmaps und Konferenzen - noch in kaum einer Periode der vergangenen dreißig Jahre war die Hoffnung auf Fortschritt so gering. Das liegt an mehreren Faktoren, von denen die Spätfolgen des "Kriegs gegen den Terror“ wohl die Gewichtigsten sind. Weder der Irak noch Afghanistan, die nach den Terroranschlägen von 9/11 zum US-Kriegsziel wurden, können als stabile Demokratien bezeichnet werden.
Bis 2014 sollen die ISAF-Truppen aus dem von Taliban-Terror, Stammes-Archaik und Korruption gezeichneten Afghanistan abziehen. Aber wenn die USA und ihre Verbündeten durch ihren raschen Abzug nichts als einen neuen Bürgerkrieg hinterlassen, ist es mit der Glaubwürdigkeit des Weltpolizisten endgültig dahin.
Die Weltgemeinschaft hätte unter US-Führung nicht nur eine militärische Niederlage erlitten. Auch einer der teuersten Versuche zur Einführung von Menschenrechten und Demokratie wäre gescheitert.
Dazu muss sich Amerika auch noch auf eine neue Hegemonialmacht in der Region einstellen, wenn Afghanistans Nachbarland Iran tatsächlich atomwaffenfähig wird. Wie wird Israel darauf reagieren? Ein möglicher Militärschlag gegen den Iran könnte einen Flächenbrand auslösen, meinen Experten.
Peking neu, Washington neu
Eine neue Politik werden die USA auch gegenüber China verfolgen müssen, wo heute Donnerstag eine neue Führung bestellt wird. Xi Jinping als neuer Präsident wird der wohl wichtigste außenpolitische Gesprächspartner Barack Obamas werden. China ist nicht nur der wichtigste Auslandsinvestor in den USA und mit 800 Milliarden Dollar an US-Staatsanleihen der wichtigste Gläubiger der USA. Es ist auch der politisch Einflussreichste Gegenspieler in Asien - jenem Gebiet, auf das sich das Hauptaugenmerk der US-Außenpolitik in den vergangenen Jahren richtete. Wirtschaftlich aber ist China wiederrum der einflussreichste Mitstreiter Obamas im Kampf gegen die Rezession in Europa und die drohende Stagnation in den USA selbst.
Die US-Wirtschaftspolitik im Rahmen der G20 wird der neue alte Präsident jedenfalls mit einer Niederlage beginnen. 2010 versprach Obama die Halbierung des Defizits bis 2013 - eine reine Illusion. Das Land steuert nun auf eine Verschuldung von 120 Prozent zu. Damit nähern sich die USA dem Niveau eines Landes mit dem es wohl nicht gerne verglichen wird: Italien.