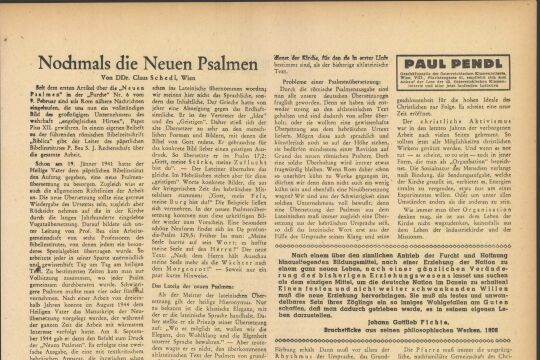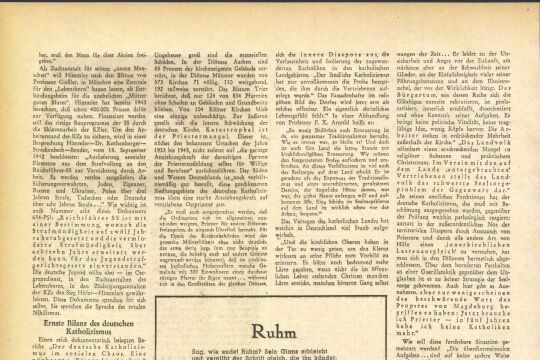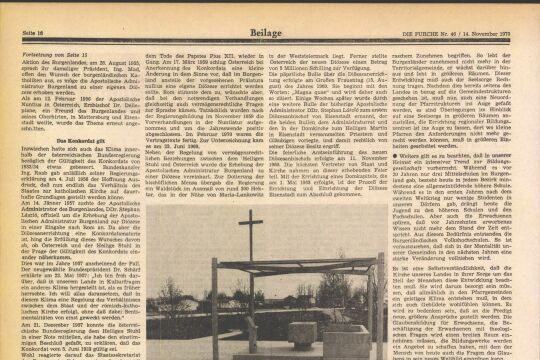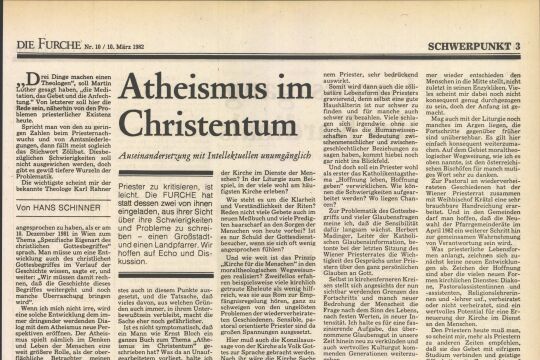Die klassische Pfarrgemeinde löst sich als Identität mehr und mehr auf. Pastoraltheologe Rainer Bucher über das Scheitern der Gemeindetheologie. Am 18. März ist es wieder soweit: Fast fünf Millionen Katholik(inn)en können in 3000 Pfarren 30.000 Pfarrgemeinderät(inn)e(n) wählen; 1,1 Millionen machten 2002 von ihrem Stimmrecht Gebrauch: Beeindruckende Zahlen - dennoch steht anno 2007 das "Modell" Pfarre auf dem Prüfstand wie selten zuvor. Im Dossier kommen dazu der Pastoraltheologe (S. 21), der "initiative" Pfarrer (S. 22), Pfarr-Bewegte in Land und Stadt (S. 23) zu Wort sowie Entwicklungen in Deutschland in den Blick (S. 24). Redaktion: otto frIedrich
Religionen organisieren sich unterschiedlich, selbst die katholische Kirche. Das frühmittelalterliche germanische Eigenkirchenwesen war etwas anderes als die stolze Kirche des Hochmittelalters und der Josephinismus des 18. Jahrhunderts etwas recht anderes als die Papstkirche der Pianischen Epoche 1850-1960. Die konkrete Sozialgestalt der Kirche hat epochale Wechsel hinter sich. Es scheint so, als ob in unseren Breiten wieder einmal ein solcher Wechsel bevorsteht. Besser: sich gerade vollzieht.
Der Grund dafür liegt außerhalb kirchlicher Verfügungsmacht: Religion vergesellschaftet sich seit einiger Zeit grundlegend neu. Religiöse Praxis wird, wie vieles andere, in die Freiheit des Einzelnen gegeben. Innerhalb der Freiheitsgeschichte der Moderne geschieht das übrigens ziemlich spät, lange nach der Freigabe beruflicher Selbstbestimmung etwa und ungefähr zeitgleich mit der Verflüssigung der Geschlechterrollen. Religion als das Verhältnis zur obersten Macht und die Geschlechterrolle als das Verhältnis zum eigenen Körper sind offenbar ausgesprochen prekäre Relationen der menschlichen Existenz: Sie blieben lange massiv reguliert, nun aber geraten auch sie in den Freiheitsspielraum des Einzelnen.
Kirche gerät auf den Markt
Besonders für Katholiken und Katholikinnen ist das etwas ziemlich Neues. Sie wurden noch bis in die 60er Jahre des 20. Jahrhunderts hinein von ihrer Kirche fürsorglich geführt. Diese Versuche gibt es natürlich auch heute noch, aber die Entscheidung, ob man ihnen folgt, liegt nun beim Einzelnen. Für die katholische Kirche bedeutet das eine revolutionäre Neukonstellation: Sie gerät in ihrer konkreten Existenz plötzlich unter den Zustimmungsvorbehalt ihrer eigenen Mitglieder und wird von einer religiösen Schicksalsgemeinschaft zu einer von vielen Anbieterinnen auf dem Markt von Religion und Lebenssinn.
Zwischen der Hierarchie und den Gläubigen walten denn auch de facto - Angestellte und Priester ausgenommen - nicht mehr Herrschaftsbeziehungen zwischen Anweisenden und Ausführenden, sondern Tauschbeziehungen zwischen Anbietern und Nachfragern. Man geht wegen spezifischer Bedürfnisse in die Kirche, nicht mehr der Norm wegen - und sei es das Bedürfnis nach Norm. Wenn die Gatter der "kirchlichen Herde" offen sind, ändert sich auch die Situation für jene, die in ihm bleiben: Sie tun es nämlich ab sofort freiwillig.
Die pastorale Fokussierung auf die Gemeinde war bereits eine Reaktion auf diese neue Lage der katholischen Kirche. Zentrale Bezugsgröße der Kirchenmitgliedschaft war nicht mehr so sehr die römisch-katholische Kirche an sich, sondern der überschaubare Nahraum einer kommunikativ verdichteten, letztlich nach dem Modell einer Großfamilie ("Pfarrfamilie") konzipierten Gemeinde. "Gemeinde": Das sollte ein intensiver, "lebendiger" Raum voller einander zugetaner und engagierter Entscheidungschristen sein. Viele haben vieles und höchst Ehrenwertes in dieses Konzept investiert.
Vormoderne Identität
Doch es kommt gegenwärtig unübersehbar an seine Grenzen. Zum einen geht die Gemeindetheologie, zumindest wenn sie sich mit dem Territorialprinzip verbindet, von einer vormodernen Identität von sozialem Beziehungsraum, lokalem Nahraum und gesellschaftlichem Organisationsraum aus. Diese Identität aber löst sich zunehmend auf. Soziale Beziehungen werden in der modernen Gesellschaft immer stärker örtlich entbettet, soziale Identität wird immer weniger über lokale Beziehungen definiert. Unsere Nächsten sind nicht zuerst jene, die zufällig um uns herum wohnen, sondern jene, deren Nummer in unserem Handy gespeichert ist.
Zudem gehen der "Pfarrfamilie" die priesterlichen Väter aus. Alle aktuellen pastoralplanerischen Initiativen haben ja eines gemeinsam: Sie lösen das klassische "Normalbild" einer um den Pfarrpriester gescharten, überschaubaren, lokal umschriebenen, kommunikativ verdichteten Glaubensgemeinschaft auf. Sie beenden also, was man seit 40 Jahren propagierte. Der "Pfarrfamilie" entziehen sich aber auch die "Kinder": Niemand kann heute irgendjemanden mehr dazu zwingen, sich seinen religiösen Erfahrungsort ausschließlich oder auch nur primär in einem sozialen Raum, gar noch an seinem Wohnort zu suchen. Das aber heißt: Gemeinden werden von selbstverständlich aufgesuchten, integrierenden Orten von Religion zu einem von vielen religiösen Orten. Nicht die Gemeinde ist mehr der soziale Mikrokosmos der persönlichen Religion, sondern das aktuelle religiöse Bedürfnis ist der Kosmos, nach dem die Gemeinde gesucht - oder verworfen - wird.
Eine neuere Studie für Deutschland ("Sinus-Milieustudie") hat zudem recht drastisch aufgezeigt, was wohl mit Modifikationen auch für Österreich gilt: Die katholische Kirche ist in das Spannungsfeld unterschiedlicher, teilweise konträrer gesellschaftlicher Milieus geraten und kann sich gerade noch auf drei konservativ-bürgerlichen der zehn Milieuschollen halten, während die anderen schon mehr oder weniger weit aus ihrer Reichweite abgedriftet sind. Anders ausgedrückt: Die "Milieuverengung" (Michael N. Ebertz) der Gemeinden ist unübersehbar.
Realer Funktionsverlust
Der konzeptionellen Privilegierung der Gemeinde entsprach zudem ganz gegenläufig ein realer Funktionsverlust. Die alte Pfarrerrolle wurde in ein Set von pastoralen Berufen ausdifferenziert. Professionalisierung bedeutete dabei langsames, aber unaufhaltsames Hinauswandern der entsprechenden Handlungsfelder aus der Gemeinde. Diakonie, Religionsunterricht, Erwachsenenbildung: Sie alle haben sich weit gehend von der Gemeinde wegpro-fessionalisiert. Das war übrigens ganz unvermeidlich und soll nicht beklagt werden. Nur: Die vorherrschende Gemeindefixierung übersieht dies nur zu leicht.
Die Gemeindetheologie war und ist in ihrer positiven Sicht der Gläu-bigen, in ihrer anfänglichen Überwindung eines patriarchalen bis paternalistischen pastoralen Umgangsstils und in ihrer Option für eine basisnahe, gemeinschaftsorientierte Sozialform von Kirche verdienstvoll und unhintergehbar. Und natürlich kann man Christsein nur in Gemeinschaft lernen und kommt es nur in ihr zu sich selbst. Die Gemeinde als Sozialisationsort christlicher Lebensführung, als naher Erfahrungsort von Religion in Wort und Tat wird und sollte auch die zentrale Sozialform mittlerer Reichweite der Kirche bleiben.
Kirche: nicht nur Gemeinde
Doch der Slogan der Gemeindetheologie "Kirche ist Gemeinde" beansprucht alleine für die Gemeinde, was nicht nur ihr zusteht und woanders gar vielfach mindestens genauso gut realisiert wird: Kirche zu sein. Die Kirche ist eben nicht nur Gemeinde, sondern die Gemeinde ist Kirche. Weder geschieht allein in der Gemeinde Pastoral, noch kann die Gemeinde Kirche in ihrer ganzen Breite verkörpern.
Was bleibt? Unverzichtbares, selbst wenn man die Territorialgemeinde, wie ich es vorschlage, realistischerweise nur noch als niederschwellige Angebotsstruktur des Volkes Gottes versteht. Zum einen bleibt die Liturgie als der zentrale gnadentheologische Vollzug der Kirche. Zum anderen muss die Gemeinde dort, wo sie hingestellt ist, die Perspektive des Evangeliums vorschlagen. Drittens aber soll eine Gemeinde nur all das tun, was sie kann und gut tun kann. Was ihr geschenkt ist, soll sie verwirklichen - und auch verwirklichen dürfen. Aber was ihr nicht geschenkt ist, soll sie nicht machen müssen. Es dürfen nicht länger alle an der Arbeit für die "lebendige Gemeinde" müde werden, sondern es sollen möglichst viele in der Kirche Leben und Erlösung finden.
Nicht müde werden
Jenseits der unchristlichen Pastoralkonkurrenz und des noch unchristlicheren Pastoralneids hätte die Gemeinde weiter zu verweisen auf jene kirchlichen Orte, die etwas besser können als sie.
Und sie hätte diese Orte, von der Sozialstation bis zum Religionsunterricht, von der Krankenhausseelsorge bis zur Citypastoral, wahrzunehmen und wertzuschätzen - in jener gleichstufigen Kommunikation, wie sie unter denen herrschen soll, die gemeinsam versuchen herauszufinden, was es heute heißen könnte, an den Gott Jesu zu glauben.
Der Autor ist Pastoraltheologe und Dekan der Kath.-Theol. Fakultät der Universität Graz.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!