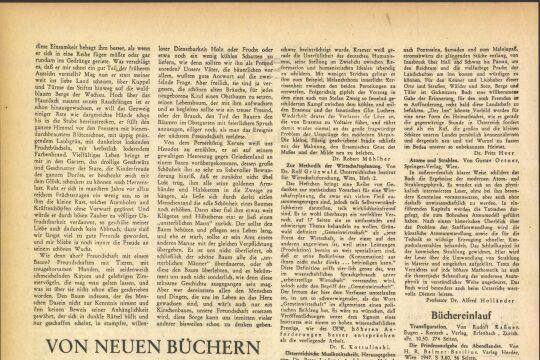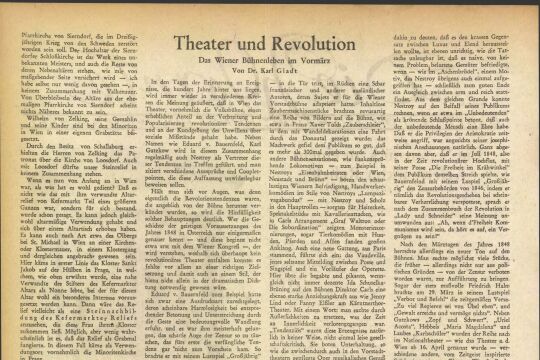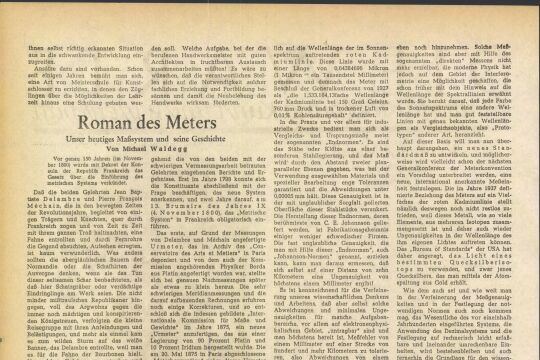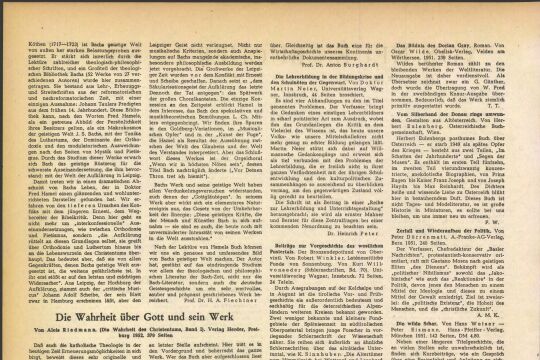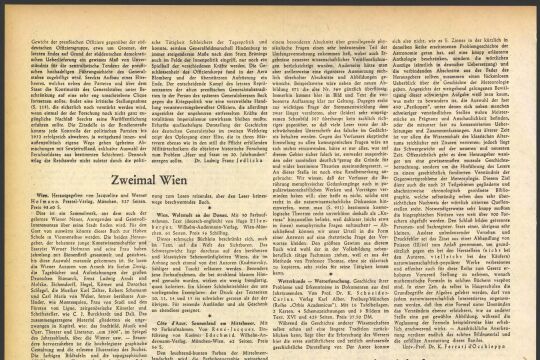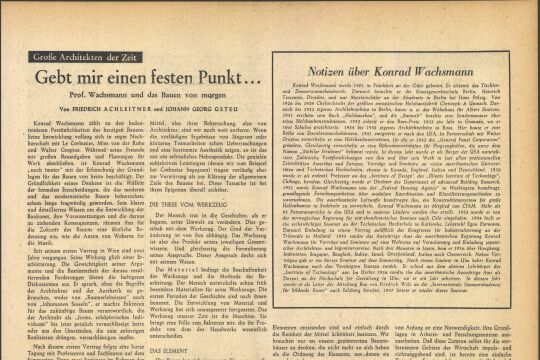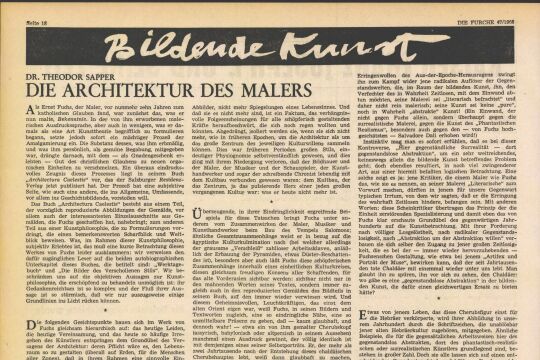Ist Kunstwahrnehmung stets individuell oder gibt es Gemeinsamkeiten zwischen Epochen und Kulturen? Wiener Kunsthistoriker wollen diese Frage empirisch beantworten.
Es mag bequemere Arten des Kunstgenusses geben, als dabei einen Fahrradhelm zu tragen. Am Institut für Kunstgeschichte der Universität Wien wird die "behelmte“ Form der Betrachtung historischer Meisterwerke regelmäßig praktiziert. Es handelt sich allerdings um keinen gewöhnlichen Helm, sondern um ein 25.000 Euro teures Messgerät, einen "Eye Tracker“. Eine drauf montierte Kamera zeichnet die Augenbewegungen der Versuchsperson auf, während diese ein Bild ansieht. Die Bewegungsdaten werden anschließend am Computer ausgewertet. So zeigt sich, welche Teile des Bildes zuerst betrachtet wurden, wo visuelle Schwerpunkte liegen und welchen Weg der Blick des Betrachters genommen hat. Empirische Methoden sind in der kunsthistorischen Forschung eine Seltenheit. "Technische Entwicklungen erlauben es heute, Fragen der Geisteswissenschaften mit einer Genauigkeit zu beantworten, die man früher nicht hatte“, sagt Raphael Rosenberg. Der Professor für Mittlere und Neuere Kunstgeschichte ist einer von weltweit wenigen Vertretern seines Fachs, die moderne Technologien mit offenen Armen in den Methodenkanon ihrer Disziplin aufnehmen. Ihn interessiert, wie Menschen Kunst wahrnehmen. Die Analyse der Blickbewegungen liefert dafür einen Schlüssel.
Es ist die alte Frage: Worauf blickt man?
"Seit dem 17. Jahrhundert beschreiben Autoren Kunstwerke häufig, indem sie auf Blickbewegungen Bezug nehmen“, sagt Rosenberg. So analysierte etwa der Enzyklopädist Denis Diderot 1776 das Gemälde "Saint Denis prêchant la foi en France“ (siehe Foto) von Joseph-Marie Vien als Blickfolge von Gott über die Engel zum heiligen Dionysius und schließlich zu den Menschen. Diderot postulierte damit eine "ligne de liaison“, eine "Verbindungslinie“, der das Auge nicht nur faktisch folgt. Sondern der es auch folgen muss, will der Betrachter die Komposition des Künstlers richtig verstehen. "Dass ein Bild eine bestimmte Leselinie hat, ist in der Kunstgeschichte eine sehr verbreitete Meinung“, sagt Rosenberg. "Mit meiner Forschung möchte ich prüfen, ob sich das empirisch bestätigen lässt.“ Dafür lässt der Forscher Versuchspersonen ein Bild 15 Minuten lang ansehen. Gleichzeitig nimmt der Eye Tracker 50-mal pro Sekunde die Pupillenbewegung des Probanden auf.
Die Auswertung der Blickbewegungen erfolgt auf dem Computer. Dabei macht Rosenberg sich die Funktionsweise des menschlichen Auges zu Nutze. Das Auge bewegt sich beim Betrachten unbewegter Objekte nämlich nicht kontinuierlich. Stattdessen springt es mehrmals pro Sekunde hin und her und tastet so das Gesichtsfeld ab. Diese Sprungphasen nennt man Sakkaden. Um etwas wahrnehmen zu können, muss das Auge mindestens 80 Millisekunden ruhen. Diese Periode heißt Fixation. Mithilfe eines dafür geschriebenen Computerprogramms kann die rasante Abfolge von Fixationen und Sakkaden visualisiert werden. So lässt sich ein visueller Sprung von einer Figur im Gemälde zur nächsten als Linie darstellen. Je öfter das Auge während des Betrachtungszeitraumes einen bestimmten Weg wiederholt hat, desto dicker wird die Linie dargestellt. Häufungen von Fixationen, also Areale im Bild, auf denen das Auge besonders oft oder lange ruht, werden farblich hervorgehoben. Nimmt man die Blickverläufe mehrerer Versuchspersonen, lässt sich daraus ein statistisches Mittel bilden. Das Ergebnis dieser Auswertung ergibt eine Grafik aus Kreisen, Punktwolken und Linien, die man über das Originalbild legen kann. Dabei zeigt sich, dass Diderot völlig falsch gelegen ist, soweit es den zeitlichen Ablauf der Blickbewegung betrifft. Tatsächlich schweift das Auge bei der erstmaligen Betrachtung eines Bildes chaotisch hin und her. Andererseits beweisen die Visualisierungen, dass sich nach einiger Zeit bestimmte Blickmuster wiederholen. Es scheint, als würde der Betrachter sukzessive bestimmte Strukturen im Bild erkennen. Diese Strukturen stimmen sehr genau mit Diderots Beschreibung der zentralen Verbindungslinie überein. Das gleiche Phänomen bestätigt sich mehrfach an unterschiedlichen Bildern und zugehörigen Beschreibungen aus der Kunstliteratur. "Das ist interessant, weil diese Autoren offensichtlich die richtige Intuition hatten, ohne die physiologischen Mechanismen des Sehens zu kennen“, sagt Rosenberg.
Mit der Methode des Eye Tracking lässt sich auch überprüfen, ob Kunstexperten Bilder grundlegend anders betrachten als Laien. Überraschenderweise ist das nicht der Fall. "Experten entdecken die Struktur einer Komposition sehr schnell, Laien brauchen dafür länger“, sagt Rosenberg. Grundsätzlich verschlossen bleibt sie ihnen jedoch nicht. Sie müssen lediglich mehr Zeit für die Betrachtung aufwenden. "Das ist beruhigend, weil es sonst für Laien gar keinen Sinn machen würde, ohne professionelle Führung eine Ausstellung zu besuchen.“ Bei Bildern mit einfacher Struktur gibt es oft keinen Unterschied in der Wahrnehmung.
Künftig wollen Rosenberg und sein Team fragen, ob es Gemeinsamkeiten in der Kunstwahrnehmung über Kulturkreise oder Epochen hinweg gibt. So untersucht eine Dissertantin am Institut die Blickmuster von Japanern und vergleicht sie mit jenen von Österreichern. Schwierig ist es hingegen, die Betrachtungsweisen vergangener Generationen, etwa aus der Renaissance zu rekonstruieren. So vertrat der verstorbene Kunsthistoriker Michael Baxandall die These, dass verschiedene geschichtliche Perioden eine jeweils eigene Art der Kunstwahrnehmung aufweisen. Demnach hat ein Florentiner des 15. Jahrhunderts Kunst anders rezipiert als es ein Florentiner der Gegenwart tut. "Das ist empirisch zwar nicht prüfbar“, schränkt Rosenberg ein. "Aber wenn sich zeigen lässt, dass verschiedene heutige Kulturen eine ähnliche Kunstwahrnehmung haben, ist das ein starker Hinweis darauf, dass die Unterschiede generell nicht so groß sind.“
Junge Forschungsplattform
Bevor Rosenberg nach Wien kam, arbeitete er in Heidelberg. Die dortigen Kollegen standen seiner Forschung eher skeptisch gegenüber. "In der Wiener Kunstgeschichte dagegen gibt es eine starke Tradition, systematische Fragen zu stellen“, sagt Rosenberg. "Das war auch ein wichtiger Grund für mich, hierher zu kommen.“ An der Universität Wien besteht seit heuer eine Forschungsplattform für Kognitionswissenschaft. Wissenschaftler aus der Biologie, Linguistik, Hirnforschung oder Psychologie arbeiten interdisziplinär an Forschungsfragen zur Wahrnehmung. Gemeinsam mit dem Wiener Psychologen Helmut Leder untersucht Rosenberg in einem Projekt, ob es universelle Merkmale bei der Wahrnehmung von Schönem gibt. "Wir gehen davon aus, dass ästhetische Erfahrungen länger dauern als nicht-ästhetische“, erklärt Rosenberg. "Damit haben wir eine messbare Größe mit der wir arbeiten können - die Zeit.“
Neben dem Eye Tracking sollen dabei physiologische Faktoren wie Herzrhythmus und Hautwiderstand gemessen werden. Der Philosophie ins Handwerk pfuschen will Rosenberg aber nicht. "Wir beanspruchen nicht, das Wesen ästhetischer Wahrnehmung zu erklären“, sagt er. "Wir suchen lediglich nach physiologischen Korrelaten.“
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!