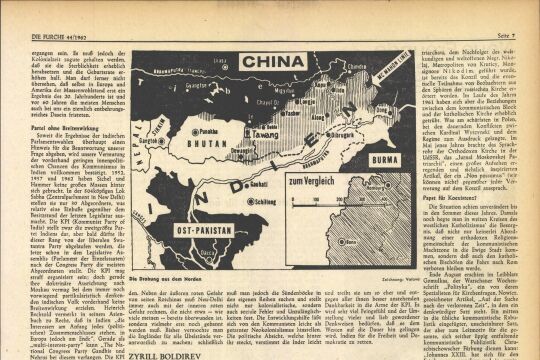Der Papst lud Religionsführer zum Gebet nach Assisi. Viele kamen, beteten in getrennten Räumen und legten dennoch gemeinsam Zeugnis für den Frieden ab.
Als Papst Johannes Paul II. 1986 zum ersten Mal Religionsführer zu einem Friedensgebet nach Assisi rief, schien in Teilen der Kirche der Teufel los. Was sucht ein Papst neben dem Dalai Lama, neben Indianern und Buddhisten, neben Schamanen und Animisten? Entweder er bekehrt sie oder er wendet sich mit Grausen.
Schwer vorstellbar, dass solches vor fünfzig Jahren noch als normal galt. Der Streit um das Verhalten Papst Pius XII. im Zweiten Weltkrieg illustriert anschaulich (siehe auch Meldung "Hitlers Exorzist" auf dieser Seite rechts), wie tief sich Kirche seither gewandelt hat. Bis zu Pius XII., dem letzten Vertreter einer auslaufenden Epoche, sahen sich die Päpste in erster Linie als Wahrer der Interessen der katholischen Kirche in der Welt. Pius XII. nachträglich vorzuwerfen, dass er das Leben seiner Gläubigen oder gar die Existenz der Kirche in Deutschland nicht zur Rettung der Juden in die Waagschale geworfen hat, ist daher zwar verständlich, aber ungerecht. Der Vorwurf übersieht den Traditionsbruch, den erst sein Nachfolger herbeigeführt hat.
Humanistische Wende
Johannes XXIII. hatte andere Vorstellungen von der Stellung der katholischen Kirche in der Welt. Das epochale Dokument "Nostra Aetate", das - ganz im Geiste des Reformpapstes - von den Konzilsvätern des II.Vatikanums 1965, zwei Jahre nach Johannes' Tod, verabschiedet wurde, spricht mit zuvor nie gekannter Hochachtung von anderen Religionen und fordert von Katholiken, sich gemeinsam mit den Gläubigen anderer Religionen "aufrichtig um gegenseitiges Verstehen zu bemühen und gemeinsam einzutreten für Schutz und Förderung der sozialen Gerechtigkeit, der sittlichen Güter und nicht zuletzt des Friedens und der Freiheit für alle Menschen."
Die "humanistische Wende", die Johannes 500 Jahre nach dem historischen "Humanismus" auch seiner Kirche verordnete, erschütterte deren Selbstverständnis nachhaltig. Offenbar besorgt um die Identität der römischen Kirche hielt es die Glaubenskongregation im Jubiläumsjahr 2000 für nötig, den Universalanspruch des Christentums in seiner katholischen Ausprägung erneut festzuschreiben. Die heftigen Reaktionen bestätigen, dass das Dokument "Dominus Iesus" einen neuralgischen Punkt getroffen hat: Wie kann man den Absolutheitsanspruch der eigenen Religion aufrechterhalten und zugleich tolerant und friedfertig mit konkurrierenden Religionsgemeinschaften leben? Die Kritiker sahen in dem Papier eine Abkehr von "Nostra Aetate", eine neuerliche Verhärtung und Abschottung der Kirche.
Johannes Paul II. ist überzeugt davon, dass Identität und Öffnung einander bedingen und keinesfalls ausschließen. Kein Papst hat so heftig wie er am Bild der Kirche als "feste Burg" gerüttelt, keiner hat den Widerspruch der Übervorsichtigen in den eigenen Reihen konsequenter missachtet als er, der seinen Kritikern stets als kirchenpolitischer Reaktionär galt.
Angst vor Relativismus
Der interne Konflikt nahm in letzter Zeit an Schärfe zu. Unter Berufung auf den 11. September mehren sich die Stimmen der Warner, die den Papst und seine konfessions- und religionsübergreifenden Friedensinitiativen auch öffentlich kritisieren. Die Drohworte "Synkretismus" und "Relativismus" schwirren durch den Raum, von Verwirrung der Gläubigen ist die Rede. Hinter einer kleinen Speerspitze um den Bologneser Kardinal Giacomo Biffi steht die schweigende Schar derer, die eine offene Konfrontation mit dem Papst scheuen, aber die Bedenken teilen.
Zur Vorbereitung solcher Treffen kann sich Johannes Paul II. seit jeher nur auf einen kleinen Kreis von Männern verlassen, die an den Fingern einer Hand abzuzählen sind. Von Anbeginn an zählte der französische Kardinal Roger Etchegaray dazu. Lange galt der Australier Edward Idris Cassidy, der heute emeritierte Präsident des Päpstlichen Rats für die Einheit der Christen, als treibende Kraft. Sein Nachfolger Walter Kasper übernahm die Funktion engagiert, gemeinsam mit Kardinal Francis Arinze vom Rat für den interreligiösen Dialog. Der päpstliche Sekretär, Bischof Stanislaw Dziwisz ist mit den Jahren zum unverzichtbaren Vermittler geworden.
Dass Kardinal Joseph Ratzinger die ausgreifenden Aktivitäten des Papstes mit Skepsis verfolgt, galt lange als selbstverständlich. Schließlich hatte er als Präfekt der Glaubenskongregation das zitierte Dokument "Dominus Iesus" unterzeichnet. So überraschte es, Joseph Ratzinger in den Zug nach Assisi steigen zu sehen. Er finde es "ermutigend", dass Menschen unterschiedlicher Religionen gemeinsam diese Reise unternehmen, sagte Ratzinger unterwegs. "Wir erwarten uns keine unmittelbaren Effekte, aber wir alle wollen den einzigen Gott erkennen und dem Frieden dienen".
Das Friedensgebet von Assisi wäre unvorstellbar ohne eine andere Frucht des Konzils: Die Aufwertung der Laien und die Entstehung neuer Gemeindeformen. Die Comunità di Sant'Egidio entstand Ende der sechziger Jahre in Rom. Ihre vorwiegend jungen Mitglieder widmen sich den Armen der Stadt, gründeten Sprachschulen für Immigranten und Altenheime, versuchen sich mit wechselndem Erfolg in Friedensvermittlung und pflegen die Kontakte zu anderen Religionsgemeinschaften. Nach dem Erfolg des Treffens von 1986 beschloss die Gemeinde, solche Gebete auch gegen interne Widerstände in der Kirche zu einer Institution zu machen. "Sie hätten Euch ja fast exkommuniziert", sagte Johannes Paul II. zur Delegation von Sant'Egidio, die nach dem Treffen zu ihm gekommen war. "Macht weiter so".
Wunder der Begegnung
Ohne die persönlichen Freundschaften einzelner Gemeindemitglieder mit Vertretern anderer Religionsgemeinschaften wäre auch die christlich-islamische Dialogkonferenz unvorstellbar gewesen, die wenige Wochen nach dem 11. September in Rom stattfand. Zwar dominierten damals von Seiten der Muslime harte Worte der Anklage gegenüber dem Westen, doch immerhin war das misstrauische Schweigen gebrochen.
Viel lässt sich gegen das Friedensgebet von Assisi einwenden: Dass der hierarchisch klar gegliederten katholischen Kirche keine vergleichbar repräsentativen Vertreter anderer Glaubensgemeinschaften gegenüberstehen. Dass der rituelle Ablauf solcher Veranstaltungen kaum mehr als Sonntagsreden zulässt. Dass Gebet hilflos wirkt angesichts von Kriegen.
Doch solche Argumente können das Ereignis nicht schmälern. Das "Wunder von Assisi" besteht schon darin, dass überhaupt Begegnung stattfindet.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!