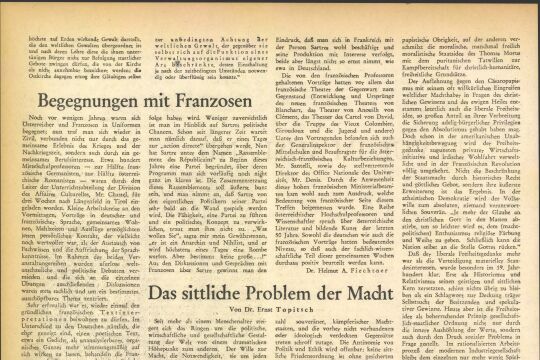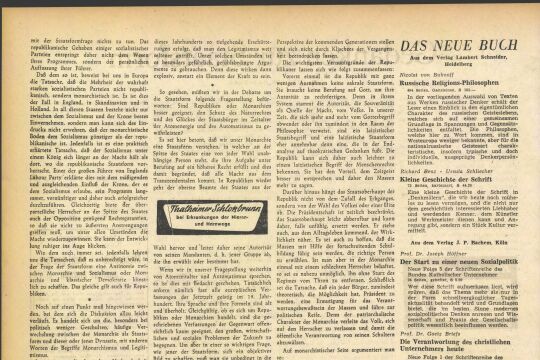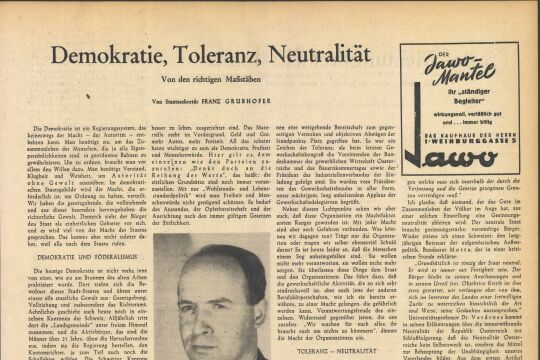Primat der Politik? Aber ja, gewiß, absolut. Natürlich kann die Politik, so sie es will, immer und überall den Vorrang behaupten. Sie hat, wie die Geschichte des 20. Jahrhunderts zeigt, auch absolut kein Problem damit, ihren Vorrang absolut zu setzen. Religion, Ethik, Ökonomie, Kultur haben gefälligst zurückzutreten, wenn die Politik ihren Primat anmeldet. Der Primat der Politik ergibt sich aus dem Begriff des Politischen ganz von selbst: Kollektive Entscheidungen sind individuellen übergeordnet, weil das Kollektiv nun einmal stärker ist als das Individuum. So einfach ist das im Grund genommen: Jede Politik beruht letztlich, ob sie es zugeben will oder nicht, auf der Möglichkeit, Zwang auszuüben über die Horde der Primaten. Zwang ist die Androhung oder Ausübung von Gewalt zu dem Zweck, seinesgleichen zu einem bestimmten Verhalten zu bewegen.
Es empfiehlt sich, totalitäre Denker zu lesen. Im Gegensatz zu Denkern, die sich der Demokratie verpflichtet fühlen, zögern sie nämlich nicht, diesen Zusammenhang klar auszusprechen. "Die Politik muß in allem die Führung innehaben", heißt es zum Beispiel bei Mao Tsetung. Von ihm stammt auch der Satz "Die politische Macht kommt aus den Gewehrläufen". Beide Sätze hätte, dialektische Bildung vorausgesetzt, auch Hitler gesagt haben können. Wahrscheinlich auch Carl Schmitt. In der Mißachtung der individuellen Entscheidungsfreiheit waren sich Kommunismus und Nationalsozialismus, linker und rechter Totalitarismus und Etatismus von jeher einig: Der Mensch muß zu seinem Glück gezwungen werden. Die Weisheit des Führers oder das Wissen der Avantgarde um die Bewegungsgesetze der Geschichte berechtigen nicht nur zur Anwendung von Zwang; sie machen Zwang geradezu obligatorisch.
Latent ist diese Tendenz in jedem Staat vorhanden, auch in demokratisch organisierten Staaten. Alexis de Tocqueville hatte am Beispiel der amerikanischen Demokratie vor der Tyrannei der Mehrheit gewarnt. Nicht wie Macht entsteht, durch Usurpation oder durch freien Volksentscheid, ist das eigentliche Problem, sondern ob und wie sie beschränkt werden kann. Der Begriff der Freiheit, verstanden als individuelle Freiheit, als Abwesenheit von Zwang, deckt sich keineswegs mit dem Begriff der politischen Freiheit, verstanden als das Recht des Bürgers, über seine Regierung zu entscheiden. Ein Ausländer, der in Österreich lebt, hat im Gegensatz zum österreichischen Staatsbürger nicht das Recht, sich an Nationalratswahlen zu beteiligen. Ist er deshalb "unfrei"? Die Bewohner des Kosovo hatten das Recht, sich an den Wahlen in Jugoslawien zu beteiligen. Sind sie deshalb "frei"?
"Primat der Politik", das könnte einen passenden Titel abgeben für ein Buch über die Schreckensgeschichte des 20. Jahrhunderts. Der amerikanische Historiker R.J. Rummel schätzt, daß in diesem Jahrhundert 169.198.000 Menschen staatlich organisierten Verbrechen ("democide") zum Opfer gefallen sind (Death by Government; 1994 New Brunswick, New Jersey). Die Opfer von Kriegshandlungen sind in dieser Zahl nicht enthalten.
Unter "democide" subsumiert Rummel "genocide" (Völkermord aus rassischen, ethnischen, religiösen oder sprachlichen Motiven), "politicide" (Mord aus politischen Gründen) sowie "mass murder" (willkürliche Ermordung von Menschen und Menschengruppen). Totalitäre, autoritäre und in Ausnahmefällen auch demokratische Regierungen haben Verbrechen angeordnet, die sich ihrem Umfang und ihrer Brutalität nach mit nichts vergleichen lassen, was Wegelagerer, Piraten, Serienmörder, Mafiagangs oder beliebige andere Tätergruppen je angerichtet haben oder anrichten könnten. "Power kills; absolute Power kills absolutely", variiert Rummel den berühmten Satz Lord Actons von der Macht, die korrumpiert. Der Staat, der vorgibt, eine Barriere gegen das Gesetz des Dschungels darzustellen und die Schwachen gegen die Starken zu verteidigen, war stets die Quelle der allergrößten Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Und je mehr er erziehen, gestalten, ausgleichen, "Gerechtigkeit" schaffen wollte, desto krimineller hat er sich aufgeführt.
Aber all das haben die Verteidiger des Primats der Politik ja nicht im Sinn, wenn sie den Primat der Politik gegenüber der Ökonomie betonen. "Nur die Starken können sich einen schwachen Staat leisten", argumentieren zum Beispiel die Grünen in Deutschland negativ, denn das positive Bekenntnis zu einem "starken Staat", das darin enthalten ist, klar auszusprechen, würde bei ihren Wählern vielleicht doch nicht so gut ankommen. Hans-Peter Martin, ehemaliger "Spiegel"-Korrespondent, Mitautor des Bestsellers "Die Globalisierungsfalle" und neuerdings SPÖ-Spitzenkandidat für das Europa-Parlament, will mit Hilfe eines starken politischen Europa die global operierenden Multis in ihre (multi)nationalen Schranken weisen, sie durch die Harmonisierung und Zentralisierung der Steuerpolitik in der EU zur Kasse bitten und über Umverteilungsmaßnahmen eine "Gerechtigkeitslücke" (welche eigentlich?) schließen. Auf der rechten Hälfte des Spektrums wird der Primat der Politik zum Beispiel von kommunitaristisch argumentierenden Christdemokraten in Österreich, Gaullisten in Frankreich und deutschen Nationalkonservativen verfochten, die der "kalten Anonymität" der liberalisierten und globalisierten Wirtschaft respektive dörflich-familiäre Wärme, nationale Solidarität und traditionelle Werte entgegenhalten.
Der Primat der Politik wird von allen Seiten mit guten Absichten begründet. Allseits wehren sich Politiker gegen den Vorwurf, den Entscheidungsspielraum der Bürger beschränken und sie durch Parteien und Staat gängeln zu wollen. Zugleich führen sie zwei Motive für die Notwendigkeit an, der Politik den Primat einzuräumen, nämlich erstens die Herstellung von Gerechtigkeit durch den Schutz der Schwachen vor den Starken, zweitens den ordnenden Eingriff in ein anarchisches Marktgeschehen. Eines ergibt sich hier aus dem anderen: die Ablehnung der spontanen, keiner zentral planenden Instanz unterworfenen, sondern sich frei aus der Interaktion einer Vielzahl von Individuen herstellenden Ordnung des Marktes, und der Eingriff in die Entscheidungen autonomer ökonomischer Subjekte.
Vorrang der Politik vor der Ökonomie kann aber wohl nur heißen, daß sich Politik erstens auf besonderes Wissen stützen kann, das den anderen Teilnehmern des Marktes nicht zur Verfügung steht, und zweitens, daß sie es - im Gegensatz zu den erklärtermaßen eigennützigen ökonomischen Subjekten, seien sie nun Konsumenten oder Produzenten - uneigennützig, gemeinnützig einsetzt. Beide Voraussetzungen sind reine Fiktion, auch noch boshaft vorgetragene. Denn jeder Politiker, der über einen Funken von Wirklichkeitssinn verfügt, weiß natürlich, daß er im Grunde nichts weiß, daß er sich wie alle anderen festhält an Bruchstücken des Wissens, die in einer Flut des Unwissens hin und her getrieben werden.
Wirtschaftspolitische Absurditäten, wie zum Beispiel das gebetsmühlenartige Wiederholen des Bekenntnisses zum Kampf gegen die Arbeitslosigkeit bei gleichzeitigem Festhalten an einem Mindestlohn oberhalb des Marktlohnes ("Gerechtigkeitslücke") sind das Ergebnis ideologischer Reflexe; mit Wissen haben sie nichts zu tun. Aber durchaus weiß jeder Politiker, oder sollte es zumindest wissen, daß Gemeinnutz seine eigentliche Sache nicht ist, sondern Stimmenmaximierung, Machtvermehrung, Machterhalt.
So ist das nun einmal, und an sich ist dagegen auch gar nichts einzuwenden, unter der Voraussetzung allerdings, daß der Macht (=Politik) möglichst enge Grenzen gezogen werden und der Entscheidungsspielraum des Bürgers soweit geöffnet wird wie nur irgend möglich. Der Freiheit den Primat zuzusprechen und nicht der Politik, das hieße, den Staat auf seine elementaren Aufgaben zu beschränken, auf die Sicherung des Friedens, der Sicherheit, des Eigentums, auf die Überwachung einfacher und nicht-diskriminatorischer Regeln des Zusammenlebens. Das ist ein alter, ein sehr alter Traum. Aber träumen wird man ja wohl noch dürfen.
Der Autor ist Stellvertretender Chefredakteur der Tageszeitung "Die Presse".
Zum Dossier Die Gestaltungsspielräume der Politik sind enger geworden - diesen Befund teilen viele, manche jubelnd, nicht wenige besorgt. Die Politik habe "die Definitionsmacht über die Wirklichkeit verloren", urteilte die FAZ (siehe "Zitiert", Seite 14) anläßlich des Rücktritts von Oskar Lafontaine. Vielleicht aber ist obiger Befund allzu einfach, eine bequeme Ausrede gar - und die Politik müßte ihre Rolle angesichts einer globalisierten Wirtschaft erst neu finden. Und vielleicht auch erweist sich eine Politik, die mehr sein will als Standortsicherung, letztlich auch als die ökonomisch klügere.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!