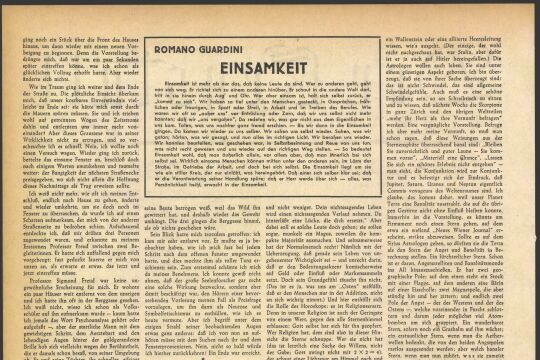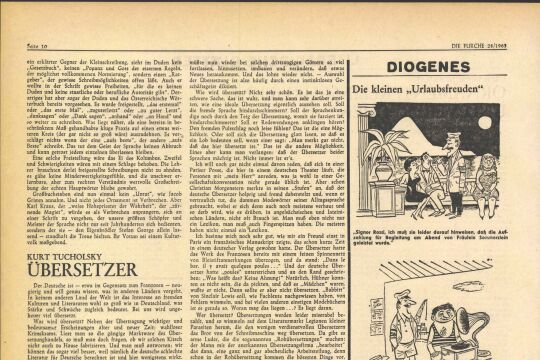Utopische Literatur zeigt selten erbauliche Zukunftsbilder - sie soll schließlich die Wachsamkeit der Leser schüren.
Das Mobiltelefon kann fotografieren und Lärm messen, es hat eine Taschenlampe und einen Kompass, man surft damit im Internet und nützt es als Adressenspeicher, nützlich ist es auch als Wecker, Notizbuch, Kalender oder Ersatz für die Sekretärin, die einen an Termine erinnert. Und es soll auch Menschen geben, die einfach nur damit telefonieren.
Was soll ein Gerät eigentlich noch alles können? Was spielt die Zukunftsmusik?
Stanislaw Lem beschrieb einst in den 70er Jahren in seiner Erzählung "Die Waschmaschinen-Tragödie" eine wundersame "Neuentwicklung, die waschen, wringen, bürsten, spülen, bügeln, stopfen, stricken und sprechen konnte, nebenbei die Schularbeiten der Kinder erledigte, dem Familienoberhaupt ökonomische Horoskope erteilte und selbsttätig die Freudsche Traumanalyse anstellte ..." Die literarische Utopie liest sich heute wie eine Parodie der Wirklichkeit: der Multifunktionswahn hat uns tatsächlich eingeholt - wenn auch vielleicht nicht direkt in Bezug auf Waschmaschinen.
Man sagt, literarische Utopien seien oft vor allem versteckte Gesellschaftskritik an der Gegenwart, aus der sie stammen, ein Fingerzeig auf Trends, die den Autor bedenklich stimmen, mit einem Wort, die Zukunftsbilder seien meist höchst gegenwärtig zu verstehen. Die berühmtesten Zukunftsvisionen zeichnen oft alptraumhaft ein Bild ungemütlicher Gesellschaftsformen, in der das Individuum nicht viel gilt und sich nicht wehren kann.
Auflösung bis zur Apokalypse
George Orwell hat das so gesehen und Aldous Huxley auch, jeder ganz auf seine Weise. Und Paul Auster sowieso. Da löst sich die Zivilisation auf bis zur Apokalyse, "Im Land der letzten Dinge" stehen nur Ruinen, und Wracks sind die Bewohner.
Ganz so schlimm ist es dann doch nicht gekommen, bis jetzt jedenfalls, was nicht ist, kann ja immerhin noch werden. Die Konzeption so manches wolkenkratzenden Wohnsilos erinnert vielleicht tatsächlich bereits an J.G. Ballards "Hochhaus", zum Einkaufen oder Kaffee trinken braucht man das Gebäude jedenfalls nicht zu verlassen. Davon dass die Bewohner daraufhin durchdrehen, ihre Katzen verspeisen und das eigene Blut trinken, ist allerdings noch nichts bekannt.
Positive Zukunftsvisionen sind selten, utopische Literatur ist zum Aufrütteln da, malt den Teufel an die Wand, damit ihn alle sehen und ihm die Pirsch verderben. Und nachdem bestimmt nie alles läuft, so wie es soll, gibt's auch immer was zu tüfteln, wie es noch schlechter weiter laufen könnte. Daran weidet sich die Phantasie.
Wo ist Utopia geblieben? Thomas Morus hat sich's wahrlich anders vorgestellt - aber das blieb eben doch utopisch. Ganz nett klingt Zukunft allenfalls noch bei Jules Verne, der vor allem von der Technik träumte und davon heute wohl begeistert wäre, eine Ehrenrunde rauf zum Mond müsste man ihm sicherlich spendieren und ein bisserl U-Boot-Fahren obendrein, aber bitte nicht die Kursk.
Im düsteren Philosopheneck
Jules Verne treibt mehr die Forscherseele, drum ist er Optimist, die Pessimisten sitzen lieber im düsteren Philosopheneck und nörgeln geistreich vor sich hin - und haben meistens Recht. Auch wenn die Utopien beinahe Gegensätzliches prophezeien, wie eben Orwells "1984" und Aldous Huxleys "Schöne neue Welt". Die tollen neuen Reisepässe, der gläserne Mensch und Diskussionen um die Rasterfahndung gemahnen dran: Big Brother is ganz gerne watching you, doch auf der anderen Seite hat er's gar nicht nötig, weil vieles immer noch von selber läuft, weil jeder vieles zu verlieren hat, es sei denn in den Suburbs von Paris. Die "Schöne neue Welt", sie bröckelt schon, die Fassade hält nicht stand. Zumindest nicht mehr lange.
Big Brother zeigt sich heute manchmal sogar lächerlich, man gewöhnt sich dran, vielleicht ist eine Überwachungskamera besser als gar keine Aufmerksamkeit? Was soll man denn alles tun, um ins Fernsehen zu kommen? Da lief die "Truman-Show" im Kino und erregte die Gemüter, wie da einer live sein Leben im und für das Fernsehen lebt, und wenig später sitzen schon die ersten im Container und sind auch noch stolz darauf.
Leben im und fürs Fernsehen
Hart ist es geworden, jeder hat zu schauen, wo er bleibt. Und wahrscheinlich wird's noch härter, hoffentlich nicht ganz so schlimm wie bei Richard Bachmann alias Stephen King, in seinem "Todesmarsch" kann es nur einen Sieger geben, während alle anderen auf der Strecke bleiben. Umverteilung an die Spitze, sehr extrem.
Etwas oligarchischer bei Jean-Christophe Rufin, da gibt es noch die oberen Zehntausend, auch wenn keiner mehr die Fäden zieht, weil die Vätersväter dies schon längst getan haben, gleich für alle Zukunft mit. Und die anderen dürfen auch ein bisserl mit am Kuchen naschen, wenn sie in "Globalia" leben. Außerhalb das Nichts wird verbannt, verfolgt, bekriegt und spielt nicht mit in der Welt der Zivilisation, außer wenn's drum geht, ein paar Terroristen zu erfinden, damit Globalia wieder mehr zusammenhält und die Herde Schäfchen sich auch ein bisserl fürchtet vor dem, was außerhalb Globalias liegt. Sonst klappt das nicht so gut mit der Gesellschaft, Xenophobie braucht es für das Gemeinschaftsgefühl. Es lebt sich recht bequem und fade in diesem Freizeitpark, der die halbe Welt umspannt mit Kuppel, Schutz und Künstlichkeit.
Moderne Technik eben. Heute Science fiction, morgen Science und State of the Art. Uferlos auch das, ein nicht nur literarisch weites Feld, das wuchert bis in Kinderbücher, die Phantasie kennt keine Grenzen, und die Science kriegt sie manchmal vorgesetzt, damit etwa Bücher wie Charlotte Kerners "Blaupause", wo die Mutter mit dem Tochter-Klon Teenagerkämpfe um Identitäten ausfechten muss, eben nur Gedankenspiele bleiben.
Keine strahlende Zukunft
Die Zukunft bleibt dann doch ein Rätsel und die Literaten warnen uns davor. Behaltet euer Herz und Hirn, meint Jean-Christophe Rufin, verliert euch nicht an Hirngespinste: "Da es sich um die Zukunft handelt, kann ein Roman höchstens dazu beitragen, dass der Leser ein gesundes Misstrauen bewahrt. Die strahlende Zukunft, wie immer sie auch aussehen mag, selbst wenn sie mit ihrem lächelnden Antlitz des demokratischen Individualismus zu uns kommt, sollte man mit klarem Kopf empfangen."
Nur dass die Zukunft in der Literatur eben nicht strahlend daher kommt. Und in den Nachrichten eigentlich auch nicht. Strahlend lächelt die Zukunft nur dann, wenn ihr kaum einer zuschaut - die schönen Dinge sind nur zu oft privat. Und dass einer davon lesen will, das ist utopisch.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!