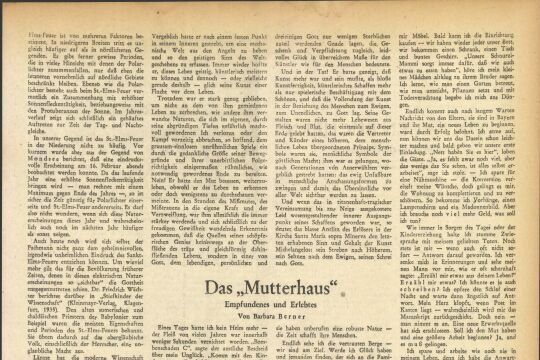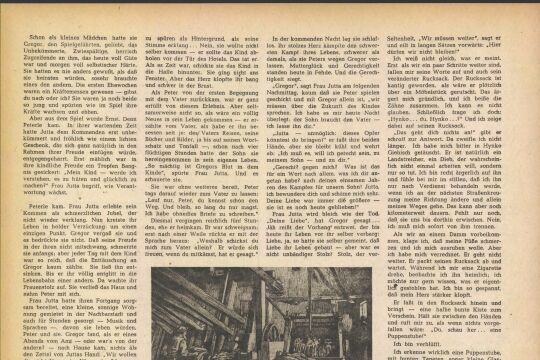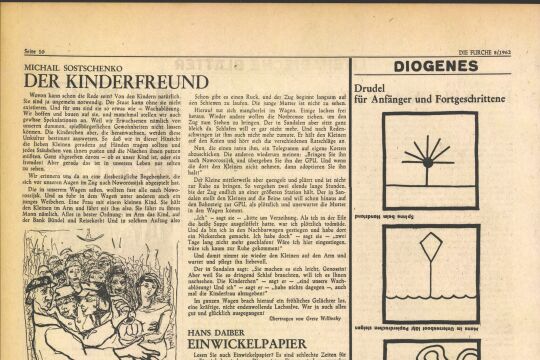Von einer Sekunde zur nächsten ist alles anders: Auf einer Party stürzt Kristof Meixner – seither ist er gelähmt. Der Student erzählt, wie es ist, wenn die geistige Freiheit die körperliche übersteigt.
Es ist ungefähr Mitternacht, als Kristof Meixner während einer Geburtstagsfeier auf einen Baum klettert. Er ist nicht wirklich angetrunken, seine Schuhbänder sind nur notdürftig gebunden. In dem Moment macht es einfach Spaß, auf den Baum zu klettern. Plötzlich rutscht der damals 21-Jährige ab. Es geht schnell: Er greift nach einem Ast, doch der reißt ab. Mit dem Hals landet er in einer Baumstammgabelung und liegt da. Niemand ist in der Nähe, der ihn bemerken könnte. Bewegen kann sich Kristof nicht. Irgendwann läutet das Handy neben ihm, doch er kommt nicht ran. „Die genaue Zeitdauer, bis mich wer gefunden hat, kann ich nicht abschätzen, aber es muss eine halbe bis dreiviertel Stunde gewesen sein“, erinnert sich der Student der Technischen Universität neun Jahre später. Da sitzt er im Rollstuhl und führt im Café vorsichtig mit seinen unbeweglichen Fingern die kleine Espressotasse an seinen Mund. Wenn sein Schal verrutscht, wird am vorderen Hals eine lange Narbe sichtbar.
Querschnittslähmung sub C 5
Vier Halswirbel bricht er sich in dieser Nacht, vom dritten weg bis zum sechsten. Als er mit der Rettung abtransportiert wird, weiß er davon nichts. Er war zwar zuvor beim Zivildienst und ahnt, was es heißen könnte, wenn man sich nicht bewegen kann. Seiner Mutter und seiner Schwester sagt er aber später im Krankenhaus, sie bräuchten sich keine Sorgen machen.
In der ersten Nacht geht alles schnell: Schockraum, Computertomografie, Röntgen, Stabilisieren. Primarius und Oberarzt werden von zu Hause aus dem Schlaf gerufen. Die Verletzung ist kompliziert. Um vier Uhr früh wird Kristof zum ersten Mal operiert. In dieser Nacht beginnt der erste Tag vom Rest eines anderen Lebens. „Was es bedeutet, gelähmt zu sein, und dass das nicht zeitlich begrenzt ist, habe ich nicht realisiert. Das dauert sehr lange, das ist keine Sache von Wochen oder Monaten“, erinnert sich Kristof. Der Wirtschaftsinformatikstudent verbringt sechs Monate auf der Intensivstation und ein Jahr auf Rehabilitation. Er wird mehrmals operiert, der fünfte und sechste Halswirbel sind so zertrümmert, dass sie entnommen und mit Hüftmaterial ersetzt werden müssen, außerdem entstehen Komplikationen mit der Speiseröhre.
Als „Querschnittslähmung sub C 5“ erfährt er seine offizielle Diagnose. Für Kristof bedeutet das, dass er im Körper unterhalb seiner Brust nichts spürt. „Das Gefühl ist nicht komplett weg. Wenn man mir aufs Knie greift, spüre ich das nicht. Aber es ist so, als würde ich von innen im Körper noch etwas spüren.“ Bei den oberen Extremitäten ist unter anderem der Trizeps betroffen, seinen Arm könnte er also „nicht aktiv ausstrecken“. Mit Hilfe eines Tricks, den er während des Rehabilitationsaufenthalts lernte, schafft er es doch: Er dreht den Arm leicht und lässt den Unterarm nach unten gleiten. Auch den Daumen kann er ein wenig mit Hilfe der Sehnen bewegen, um kleine Gegenstände zu nehmen und zu heben – und das ist schon viel wert.
Neun Jahre sind seither vergangen – eine lange Zeit. Ob man einen solchen Unfall je verkraften, je akzeptieren kann? „Ich weiß es eigentlich nicht“, sagt Kristof. Er ist um Humor nicht verlegen und macht sich Gedanken über das Leben. „Es gibt Momente, in denen ich mir denke, das kann ja alles nicht wahr sein. Situationen, wo man dran zweifelt, dass man das je akzeptieren kann. Wenn etwas passiert, das auf die Behinderung zurückzuführen ist. Ich denke da an andere Menschen, bei denen etwa eine Beziehung zu Ende geht aufgrund der Behinderung. Oder wenn Leute spontan auf Urlaub fahren, und ich kann nicht mit. Das ärgert einen.“
Verlangsamtes Leben
Freunde und Familie oder einfach die Natur geben Kristof Mut und Kraft. „Dann, wenn ich die Sonne spüre oder die Vögel höre. Ich habe das früher gar nicht so wahrgenommen“, erzählt er. „Querschnitt verlangsamt das Leben. Man braucht für alles länger und plant den ganzen Tag.“ Alles, was im Alltag spontan passiere, werde zur Hürde. Ein organisierter Tag bedeute keine Hürde mehr, erklärt der gebürtige Grazer. Geplant sind sämtliche Wege untertags, beim Duschen, Anziehen oder Zubereiten des Essens braucht er Hilfe. Oft begleitet ihn Thomas, ein BOKU-Student, von der „Wiener Assistenzgenossenschaft“ für Menschen mit Behinderungen. Etwa dann, wenn Kristof für seinen Tutorenjob oder für Lehrveranstaltungen auf die Uni nach Wien muss. Seit einiger Zeit wohnt Kristof nämlich im burgenländischen Bezirk Mattersburg in einem eigenen Haus, seine Mutter wohnt nebenan und unterstützt ihn. EDV-Projekte kann er von zu Hause aus am Computer erledigen. „Man muss schon beim Vorstellungsgespräch sagen: Es tut mir leid, aber es gibt Tage, da kann ich erst später kommen, dafür kann ich länger bleiben. Wenn man mit den Leuten redet, merken die ganz schnell, dass sie normal mit dir umgehen können“, erklärt der 30-Jährige.
Kristof kommt viel herum und empfindet Wien im Vergleich zu deutschen, italienischen, englischen oder französischen Städten großteils behindertenfreundlich, weil es hier noch eher möglich sei, sich mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu bewegen. Er spricht ein weiteres Problem an: „Unsere Gesellschaft ist auf Ökonomie aufgebaut. Wenn man eine Rampe am Gehsteig baut, kommt eigentlich kein ökonomisch messbarer Nutzen zurück. Die Probleme werden von vornherein vielleicht nicht so gesehen.“ Man müsse Politiker darauf hinweisen, wo Probleme liegen. Sinnvoll findet er auch Lehrveranstaltungen an der TU, bei denen angehende Bauingenieure einen Tag im Rollstuhl durch die Gegend fahren, damit sie sehen, was Hürden bedeuten. Auch Ergotherapie- und Physiotherapie-Studentinnen und -Studenten sitzen im Zuge ihrer Ausbildung zumindest einmal im Rollstuhl.
Neue Intensität der Begegnungen
Vorhaben der Regierung, Menschen mit Behinderungen zu unterstützen, klingen meist engagiert und umfassend, können sich jedoch als Worthülsen entpuppen, wenn die Umsetzung unrealistisch ist. „Behindertengerecht: Was ist das überhaupt? Und für wen ist das gerecht?“, erkennt Kristof ein Problem. „Im Zug braucht ein Rollstuhlfahrer eine Rampe, ein Gehörloser erkennt in der Nacht schlecht, an welcher Station er gerade ist. Ein Blinder tut sich schwer mit mangelhaften Durchsagen.“ Zusammenschlüsse von Menschen mit verschiedenen Behinderungen – der Behindertenverband etwa ist ein solcher – seien da sinnvoll.
Es ist nicht alleine das Beseitigen von räumlichen Hürden, das das Leben für Kristof einfacher macht. Humor spielt eine wichtige Rolle. „Wenn einige Rollstuhlfahrer beisammen sind, wird es ziemlich sarkastisch, man pflanzt sich gegenseitig“, lacht Kristof. „Manche Witze sind böse. Das bekommt eine lustige Eigendynamik, und Leute, die dazukommen, sind verwundert.“ Ernst ist das Leben selbst genug. Besonnen wird er, wenn er nachdenkt, wie die Behinderung seine Persönlichkeit beeinflusst hat. Neue Leute habe er auf einer anderen Ebene kennengelernt, manchmal in einer Intensität, die er nicht missen möchte. Vielleicht wäre er ohne den Unfall oberflächlicher geworden, überlegt er.
Ob er an eine schicksalhafte Fügung glaubt? „Ich bin mir nicht sicher“, grübelt er. „Ich war als Kind ein irrsinniges Bewegungsbündel. Ich weiß nicht, ob es so ist, dass es in der Kindheit kompensiert wurde, dass ich mich jetzt länger nicht bewegen kann.“ Ein Gedanke beschäftigt ihn: „Es gibt ein Musikvideo, da wird eine Schulklasse gezeigt und dann wird diese Schulklasse 20 Jahre später gezeigt. Einer sitzt dann im Rollstuhl. Irgendwie hat mich dieser Rollstuhlfahrer damals schon angesprochen oder besonders getroffen – ich weiß nicht warum. Ob das eine Vorsehung war?“
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!