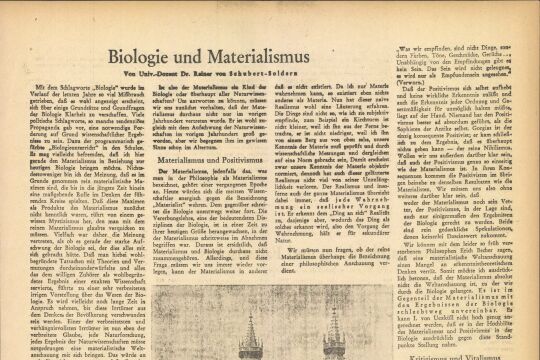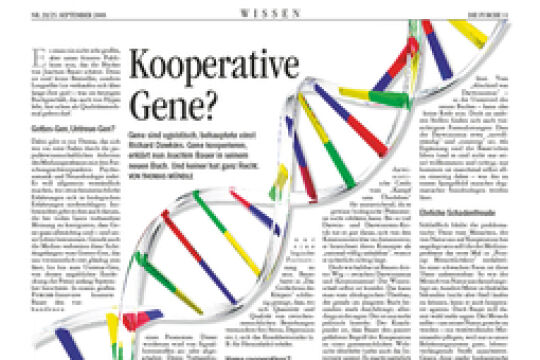Es gibt keine Menschengesellschaften ohne Religion(en). Das ist kein Gottesbeweis. Aber ist es vielleicht ein Hinweis auf einen evolutionären Vorteil des Gläubigseins?
Eine Ameise klettert einen Grashalm hoch, fällt herunter, klettert wieder hoch, fällt wieder herunter usw. Was für einen Sinn macht das seltsame Verhalten des kleinen Krabbeltiers? Für die Ameise keinen, erläutert US-Philosoph und Darwinist Daniel Dennett in seinem Buch „Den Bann brechen“ (Insel Verlag, 2008) und erklärt weiters: Das Gehirn der Ameise ist mit einem Parasiten, dem Kleinen Leberegel, infiziert; der Hirnwurm steuert die Ameise und hofft so, in den Magen eines Schafs oder einer Kuh zu gelangen, wo er sich fortpflanzen kann. Ob es das auch beim Menschen gibt? Ja, meint Dennett. Gewisse Menschen würden ein ähnliches Virus im Kopf tragen, das sie dazu bringt, ihre eigenen Interessen, ihre Gesundheit, ja das Wohl ihrer Kinder aufs Spiel zu setzen. Das Virus ist dabei eine Idee und hat auch einen Namen: Religion.
Religion: Bloß ein Ideen-Virus?
Dennett betont mit der Virus-Metapher ein irrationales Element der „Unterwerfung“ (die wörtliche Übersetzung von Islam, worauf er hinweist), das alle Religionen von ihren Gläubigen forderten und sich nur allzu oft in religiösem Fanatismus – Blut, Krieg, Terror – zeige. Kurzum, Dennett, der übrigens ein Fürsprecher der atheistischen Brights-Bewegung ist, entwickelt in seinem Buch eine sehr einseitige Sichtweise von Religion. Dem entspricht, dass er ein einziges biologisches Konzept zur Erklärung besonders hervorhebt: den Parasitismus (siehe auch Buch-Rezension und Dennett-Interview in FURCHE 40/08).
Wie sich Begriffe der Evolutionstheorie dennoch gewinnbringend auf Religion(en) anwenden lassen, zeigen der Biologe Rüdiger Vaas und der Religionswissenschafter Michael Blume in ihrem neuen Buch „Gott, Gene und Gehirn“ (siehe auch das Interview mit Michael Blume unten). Die Vielschichtigkeit von Glauben und Spiritualität wird von den Autoren eingangs herausgearbeitet. Dann wird erläutert, auf wie viele Weisen Religion als evolutionäres Geschehen verstanden werden kann.
Eine wichtige Frage lautet etwa, ob die Evolution der Religiosität sozio- oder biokulturell abläuft. Ersteres hieße, dass religiöse Ideen einfach als Kulturgut gelernt und weitertradiert werden – eine relativ schwache Behauptung (wobei die Autoren explizit die Option von Dennetts Gedanken-Virus als Möglichkeit offen lassen). Zweiteres wäre die härtere These: dass Religiosität biologische Wurzeln hat. Die Entdeckung des „Gott-Gens“ VMAT2 wäre hierfür ein Hinweis und auch die Existenz eines „Gott-Moduls“ im Gehirn würde diese Position stärken. Aber beide Konzepte sind wissenschaftlich nicht unumstritten. Weitere Untersuchungen könnten in Zukunft mehr Klarheit bringen. Zu Recht betonen Vaas und Blume immer wieder, dass Gott damit nicht automatisch auf einen neuronalen Schalthebel oder ein Stück DNA-Sequenz reduziert würde.
Eine andere interessante Frage ist, ob Gläubigkeit einen evolutionären Nutzen bringt und wenn ja, wo der Selektionsvorteil ansetzt. Biologen unterscheiden etwa Individualselektion (Vorteil für den Einzelnen), Verwandtenselektion (Vorteil für nahe Verwandte) und Gruppenselektion (Vorteil einer Gruppe gegenüber einer anderen). Tatsächlich lässt sich mit vielen Statistiken belegen, dass religiöse Gruppen mehr Kinder als nichtreligiöse haben. Die besonders gläubigen US-Amerikaner bilden zum Beispiel mit „2,1 Geburten pro Frau die demografische Spitze freiheitlicher und wohlhabender Nationen“ – und das ohne staatliche Familienförderung.
Zölibat: Biologischer Unsinn?
Das Fehlen einer finanziellen Familienförderung kann zum Beispiel durch kirchliche Einrichtungen wettgemacht werden. Das von manchen Religionen propagierte Zölibat, das zunächst aus evolutionsbiologischer Sicht unerklärlich wirkt, kann so auf einmal biologisch sehr sinnvoll erscheinen: Mit ihren sozialen Diensten unterstützen insbesondere Nonnen das Fortbestehen von Gemeinden. So schlossen Forscher in einer „gewagten“ Hochrechnung, dass in Italien eine einzelne Nonne zwischen 1960 und 2000 einen Reproduktionsunterschied von „bis zu 295 Kindern“ ausgemacht habe.
Schließlich wird in einem spannenden Kapitel mit einfachen spieltheoretischen Überlegungen gezeigt, wie Religion als „Kooperationsverstärker“ wirkt. Gleichzeitig wird betont, dass ein Mehr an Kooperativität für sich noch kein positiver Wert ist. Denn: „Damit lässt sich eine Katastrophenrettungsaktion genauso organisieren wie ein Kreuzzug“. Dieses vorsichtige Abwägen ist ganz allgemein eine große Stärke des Buchs. Die Autoren vermeiden allzu pauschalisierende Urteile für oder gegen Religion – und werden so ihrem überaus komplexen Studienobjekt durchaus gerecht.
Gott, Gene und Gehirn
Von Rüdiger Vaas und Michael Blume. Hirzel Verlag, Stuttgart 2009, 254 S., kart., E 24,70
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!