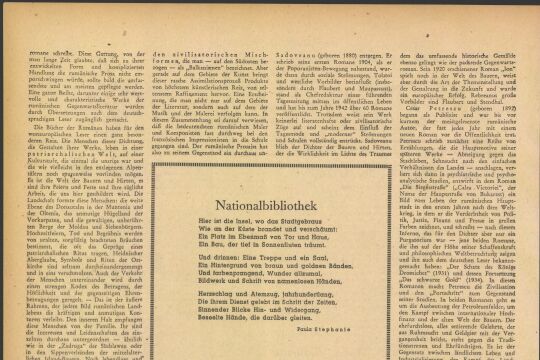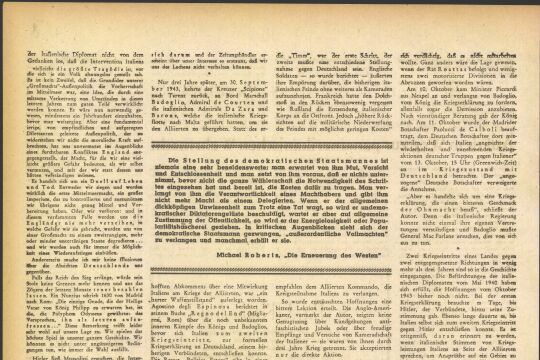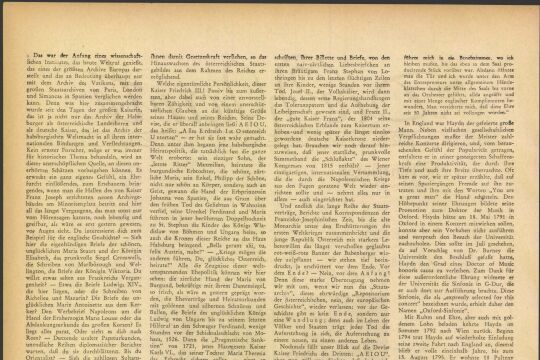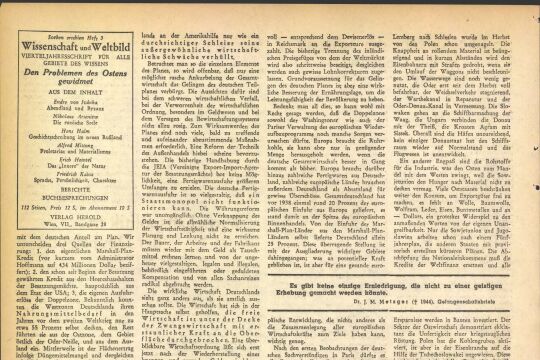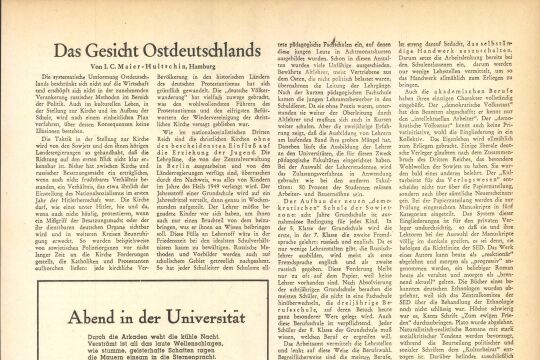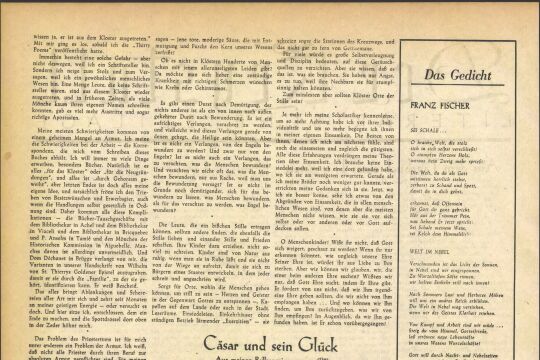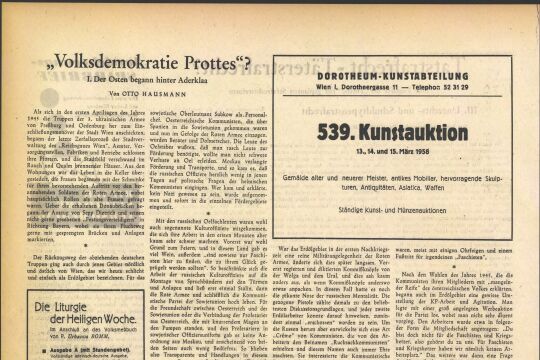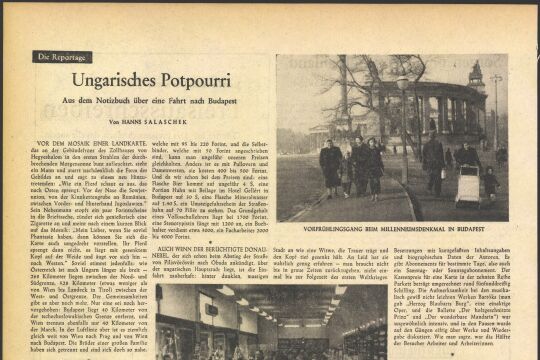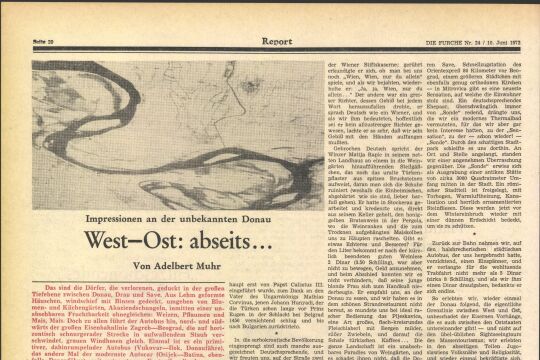Eine Reise durch Geschichte und Gegenwart der Grenzregion im Norden Österreichs. Von Helden, rebellischen Pfarrern und der sterbenden Hoffnung auf Gemeinsamkeit.
Zahlen haben etwas Beruhigendes. Sie machen schwer Verständliches messbar, stutzen Übertreibungen zu Rohdaten zurück und geben einen sicheren Boden. Deshalb beginnt diese Reise an die österreichisch-tschechische Grenze nummerisch und ohne viel Brimborium. Der Eiserne Vorhang braucht das nicht. Die Zahlen reichen aus: 362,6 Kilometer doppelter Stacheldrahtzaun, 590,8 Kilometer militärische Spezialstraßen, 49 Bunker, 314 Wachtürme, davon 265 aus Stahl, 26 Beobachtungsstellen des Luftraums, 64 Beobachterstandorte, 47 Kasernen. Auf diese Weise zäunte die kommunistische Tschechoslowakei ihre Bewohner ein. Dieser Zustand dauerte von 1948 bis 1989. 1038 Menschen starben an den zum Teil mit Starkstrom und Minenfeldern versehenen Sicherungsanlagen.
November 2009: Die eherne Grenze ist seit 20 Jahren abgetragen. Doch wer Reisen ins Mühl-, Wald- und Weinviertel unternimmt, sich dem vorwinterlichen Nebel, der klammen, feuchten Kälte, der Einschicht der Dörfer aussetzt, der wird wenig Neues oder gar Gemeinsames zwischen Hüben und Drüben finden. Die Grenze liegt offener denn je zutage, seit man ihr die Soldaten, den Stacheldraht und die Minenfelder genommen hat. Nun ist sie nackt und zeigt ihre wahren Ursachen: die Vorurteile, die Verstocktheit und das Unvermögen – hunderte Kilometer lang und abgrundtief zwischen Schwarzenberg im Böhmerwald und Deutsch-Jahrndorf bei Bratislava. Nur wenige durchbrachen vor 1989 die bewehrte Grenze, wenige durchbrechen heute die unsichtbar gewordene. Jene, die es wagen, kommen meist nicht von hier. Die Alteingesessenen schweigen.
100 Kilometer nordwestlich von Wien, dort wo die Thaya sich in langen Mäandern Richtung Vranov windet, liegen die Orte ÇSafov (Schaffa) und Langau. Sanfte Hügel, „Biegl“ genannt, birkengesäumte Granitteiche, saure Wiesen und Mischwald ziehen sich ohne erkennbare Bruchstelle von Mähren Richtung Geras, von Nord nach Süd. Trotz scheinbarer Gleichförmigkeit ist hier Grenze, und das seit über neunhundert Jahren: Seit 1150 wacht Schaffa am Rand des mährischen Reiches gegen das niederösterreichische Langau hin.
Grenzsteine mit kunstvollen Gravuren zeugen noch heute von den blutigen Streitigkeiten zwischen den Dörfern um Grund und Boden. Anno 1673, als sich die Bewohner im nahen Grenzwald einmal mehr im Kampf ums Leben brachten, suchte man gar ein Gottesurteil, das noch heute mit eigentümlicher Leuchtkraft die Absurdität der Fehde erhellt: Man sattelte ein Pferd, setzte einen Knecht mit verbundenen Augen rücklings darauf und trieb es in wildem Galopp über die Felder. Der vom Tier genommene Weg war fortan die Grenze – und ist es bis heute. 1945 wurde die deutsche Einwohnerschaft Schaffas von den Tschechen vertrieben, die jüdischen Bürger waren 1941 von den Deutschen deportiert und ermordet worden. Ab 1948 kam die Stille des Eisernen Vorhangs. Heute zählt ÇSafov kaum 180 Einwohner, ein heruntergekommener Flecken im Niemandsland.
Die Rebellen Gottes
Dem drei Kilometer entfernten Langau erging es kaum besser. Andreas Brandtner, kam 1986 als Pfarrer hierher. Er fand einen idyllisch verschlafenen, sich langsam entvölkernden Ort am Eisernen Vorhang vor. Ein Grundsätzliches aber schied den Pfarrer von seiner Gemeinde. Brandtner akzeptierte die Grenze nicht. Sein tschechisches Gegenüber, der Prämonstratenserpfarrer JiÇri Veith in ÇSafov, tat das ebenso wenig. Die Pfarrer setzten sich ins Einvernehmen und bald begann sich ein turbulentes Grenzleben zu entfalten. Etwa wenn Brandtner seine Langauer Schäfchen zum grenzüberschreitenden Ausflug nach ÇSafov vergatterte oder am Jahrestag des Prager Frühlings mit einer Schwadron Autos am Grenzübergang zum Hupkonzert auffuhr. Für JiÇri Veith, der bei solchen Aktionen in vollem Habit auf der anderen Seite winkend und rufend auf und ab marschierte, endete das regelmäßig mit der Festnahme durch die Grenztruppen und nicht nur einmal sperrten ihn Polizisten in Zivil tagelang im Pfarrhaus von ÇSafov ein. Ein Silvesterfeuerwerk, das Brandtner 1987 direkt an der Grenze abhielt, führte zu einem Alarmeinsatz der tschechischen Truppen und einem Schreiben des Regimes an das Außenministerium in Wien mit der Aufforderung, solche „Störaktionen“ in Zukunft zu unterbinden. Als Antwort zog Brandtner damals mit wehenden Bannern über die Heide bis zum Zaun um lauthals grenzenlosen Frieden zu predigen.
Die wilden Jahre sind lange vorbei. Es ist wieder still geworden an der Grenze. Die Stichstraße nach Schaffa ist geöffnet, aber die Schaffinger bleiben unter sich, wie die Langauer auch. Nur ein internationales Sommerlager für Kinder und Jugendliche ist erfolgreich. Manchmal sitzen Brandtner und Veith zusammen im mächtigen Pfarrhaus von Langau und schwärmen bei Kaffee und Wein von alten Taten. Bis zu einem Punkt, wo der fidele, pausbäckige Veith traurig in seine Tasse blickte und brummt: „Der Glaube ist schwach geworden. Er hat keine Funktion mehr. Früher war er Hoffnung für die Menschen. Heute nicht mehr.“
Die Eingeschlossenen
30 Kilometer westlich von Langau, an den letzten Ausläufern der böhmischen Seenplatte, liegen die Orte Fratres und Slavonice. Dazwischen markiert ein Hügel den Grenzübergang. Alle fünf Minuten passiert ein Auto das Denkmal an der ehemaligen Zollstelle, auf dem zu lesen steht: „Geduld ist der Schlüssel zur Freude. Zur Wiederherstellung des Grenzübergangs am 21. März 1991.“ Auch sonst mangelt es nicht an großen Worten. „Wohin verschwinden die Grenzen?“, fragt eine 30 Meter lange Installation aus Metall. Und vor der ehemaligen Zollstation prangt ein blaues Schild, darauf steht: „Vítáme Vás, sousedé, Willkommen Nachbar.“ Dahinter parkt ein Polizeiauto.
Der Grenzschutz ist in Niederösterreich immer noch ein großes Thema, vor allem nachdem die Grenzkontrollen zu Tschechien am 1. Mai 2004 abgeschafft wurden. Die Grenzschützer sind jedenfalls geblieben, die Polizisten und die Soldaten des Bundesheeres. Sie kontrollieren und beobachten die Fremden jetzt eben „im Hinterland“ und spenden damit den Einheimischen Sicherheit, wie die Politiker aller Parteien betonen.
Früher, so erzählen die Bewohner von Fratres, gingen die Kinder über die grüne Grenze nach Slavonice zur Schule, die Bauern verkauften dort ihre Waren am Markt, feierten die großen Feste in der Stadtkirche, jeder sprach ein paar Brocken Tschechisch. Slavonice hieß damals Zlabings, ein regionales Zentrum mit weitläufigem Hauptplatz und Renaissance-Stadtkern an der Straße nach TelÇc. 1945 wurde Zlabings zu einem toten Ende des kommunistischen Imperiums. Freiwillig kam niemand mehr hierher, gezwungenermaßen nur noch die Grenztruppen und Geheimpolizisten zur Überwachung der Bevölkerung.
In Slavonice leben Jan und Hana Javurek. Sie haben, wenn man so will, durchgehalten. Hana Javurkovás Familie war gemischt deutsch. Das reichte, um nach 1945 unter den Generalverdacht des Regimes zu geraten. Hana, eine kleine Frau mit dicken Hornbrillen und freundlichen Augen, erzählt leise von der Anfeindung durch ihre Lehrer in der Schulzeit, von der Angst, auf der Straße Deutsch zu sprechen, von den Polizeiverhören, denen sie und ihr Mann ausgesetzt waren, von den Grenzpolizisten‚ die harmlose Joggingläufe mit angehaltener Kalaschnikow beendeten und vor allem von der permanenten Beobachtung durch Mitbürger und Spitzel der Staatssicherheit. Noch im Dezember 1989, als die Samtene Revolution das alte Regime schon weggefegt hatte, versuchte eine Nachbarin die Javureks Hana Javurkováwegen „antikommunistischer Umtriebe“ anzuzeigen.
Heute ist Slavonice eine durch Tourismus und Handel blühende Kleinstadt. Im Sommer frequentieren tausende zumeist tschechische Gäste die Kaffeehäuser und Restaurants. Die Javureks haben Freunde in Österreich gefunden, doch auf eine „echte“ Grenzöffnung, wie sie es formulieren, warten sie noch immer.
Zuletzt sollte Hana als Übersetzerin bei der grenzüberschreitenden NÖ-Landesausstellung arbeiten. Gemeinsam mit anderen deutschsprachigen Tschechen sollte sie Führungen für tschechische Schüler gestalten. Der Einschulungskurs war absolviert, doch dann vereitelte das geltende Arbeitsverbot für Tschechen in Österreich die Sache. Der Titel der Ausstellung, „Tschechien Österreich – geteilt, getrennt, vereint“ klang übrigens so viel versprechend, wie die Ankündigung Österreichs, die Thayathalbahn bei Slavonice wieder an das tschechische Bahnnetz anzuschließen. Inzwischen haben die Tschechen den Bahnhof Slavonice hoffnungsfroh ausgebaut. Auf österreichischer Seite wurden die Schienen dagegen teilweise abgebaut.
Die Bewacher
Von Slavonice zieht sich eine Straße nach Osten, durch den ärmlichen Süden Mährens, über 50 Kilometer bis Znaim/Znojmo. Hier war Milan RáÇcek von 1962 bis 1964 Grenzsoldat. Einer von 16.000 Grenzbewachern. Seine Funktion: „Arbeitstechnische Kompanie“. Mit sieben anderen Soldaten fuhr er zwei Jahre lang in klapprigen Militär-LKWs über das weite Hügelland und reparierte Telefonleitungen. Endlose, gerade Straßen, tagaus tagein, bei jedem Wetter. RáÇcek sagt: „Alle waren frustriert, alle hatten Heimweh. Wir fühlten uns wie im Knast.“ Abends, nach Zapfenstreich in der Kaserne, ritzten sie Kerben in Holzstäbe, eine Kerbe für jeden Tag. So zählten sie die Zeit herunter. Erst viel später erfuhr er von den Zuständen beim bewaffneten Teil der Truppe, der in weitgehender Isolation in den Unterständen und Bunkern an der Grenze lebte und mit Hunden und Gewehren flüchtende Landsleute jagte: Selbstmorde, tödliche Unfälle am elektrischen Zaun und in den Minenfeldern, Selbstverstümmelungen und Mord. Von den tausend Todesopfern am Eisernen Vorhang waren 648 Soldaten.
Mitte August 1968, als der Prager Frühling noch in voller Hoffnung stand, ging RáÇcek mit seiner Frau bei Mitterretzbach über die nun offene Grenze nach Österreich. „Wir hatten ein komisches Gefühl“, sagt RáÇcek. Am 21. August rollten russische Panzer die Reformbewegung nieder. Die RáÇceks blieben in Österreich und wurden von einem tschechischen Gericht in Abwesenheit zu 20 Jahren Haft wegen Spionage verurteilt. Heute lebt RáÇcek als Schriftsteller in Sitzendorf.
Die Fliehenden
Der österreichisch-tschechische Grenzübergang Haugsdorf liegt 20 Autominuten von Znojmo entfernt. 1986 war die Straße nach Haugsdorf eine einsame Straße an der Grenze. Nur hin und wieder fuhren hier blaue Karosa-Busse der tschechischen Staatslinien auf dem Weg nach Jaroslavice und Mikulov. Der Waldarbeiter Robert Ospald benutzte den Bus täglich: Immer die gleichen Gesichter, immer die gleiche trübe Aussicht mit dem immer gleichen verzweifelten Blick Richtung Horizont. Dann ist Ospald, dem Rebellen, dem Eingesperrten, Fluchtsuchenden, plötzlich eine Hochspannungsleitung aufgefallen. Sie führte quer über die Felder nach Süden – geradewegs nach Österreich. Als er mit weit aufgerissenen Augen aufschrie: „Ich hab’s“, haben sich die Menschen im Bus verwundert umgedreht. Ospald verstummte, kauerte sich in seinen Sitz und begann, seinen Plan zu schmieden.
In der Nacht des 26. Juli 1986 turnte er sich einen Mast der Hochspannungsleitung hinauf. Auf seinen Rücken hatte er einen Sitz geschnallt, an dessen Oberseite ein schwerer Metallbügel mit zwei Rollen montiert war. Ganz oben, am nicht stromführenden Blitzableiterkabel, hat Ospald seinen Sitz eingehängt und ist Richtung Österreich gerollt – direkt über den Eisernen Vorhang hinweg. Bei Haugsdorf ist er gelandet, in strömendem Regen. Der erste Mensch, den er sah, war ein Gendarm. „Du nix sprechen Deutsch?“, fragte der. Robert Ospald hat Deutsch gelernt und lebt heute in Wien. Die Zeitungen berichteten von seinem Fall in selbstzufriedenen Artikeln, von seiner Flucht vor dem Bösen ins Land des Guten. Die Grenze hatte so gesehen etwas sehr Praktisches, Selbstbestätigendes.
Zeit für eine Korrektur
Drei Jahre später würde sich der Umgangston geändert haben, würden „Oststinker“ die gute österreichische Luft verpesten so wie heute „Ostbanden“ im Boulevard alle paar Tage „Kriminalitätsrekorde“ brechen.
Wir müssen hier, am Ende der Reise, eine Korrektur anbringen. Zahlen, so stellen wir fest, können auch beunruhigende Disharmonien erzeugen: Vor 240 Monaten, vor 7300 Tagen, siegte das tschechische Volk und die Freiheit über die Unmenschlichkeit der kommunistischen Diktatur. Aber: Was ist seither geschehen? Am 17. November 2009, dem 20. Jahrestag der Revolution, hängt Nebel über der Straße von Haugsdorf nach Znojmo. Es ist Nachmittag. Bald wird es dunkel. Rote Schilder blinken links und rechts, kilometerweit reiht sich Bordell an Bordell, Plakate – einsprachig deutsch – versprechen „frische Mädchen“ und „Sex für 20 Euro“. Morgen wird es 7301 Tage her sein, seit hier die Freiheit Einzug hielt.