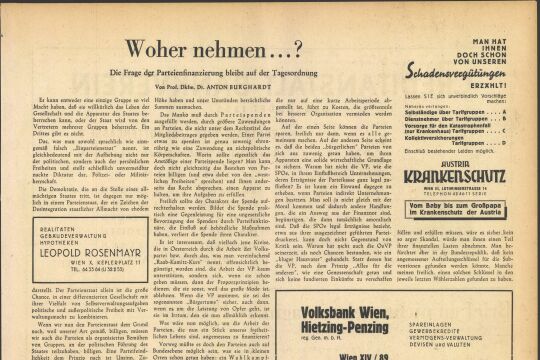Die Wiederkehr der streitbaren Demokratie
Der Möglichkeit eines Parteiverbots kann eine mäßigende Wirkung auf extremistische Parteien zugeschrieben werden.
Der Möglichkeit eines Parteiverbots kann eine mäßigende Wirkung auf extremistische Parteien zugeschrieben werden.
Sind Parteiverbote sinnvoll, oder muss der Staat neutral gegenüber den politischen Parteien sein, egal welche Inhalte sie vertreten? Diese Frage wird derzeit beim Nachbarn Deutschland heftig diskutiert. Unbestritten ist, dass Parteiaktivisten auch unter dem Deckmantel der parteipolitischen Betätigung keine Gesetze brechen dürfen. Es geht vielmehr darum, ob Parteien, welche die Beseitigung der Demokratie beabsichtigen, aus dem demokratischen Wettbewerb ausgeschlossen werden sollen. Beide Seiten haben gute Argumente.
Das historisch ältere der beiden Konzepte geht davon aus, dass die Entscheidung, welche politischen Inhalte legitim sind, nur der Wählerschaft zusteht. Diese Konzeption hängt damit zusammen, dass die nach dem Ersten Weltkrieg entstandenen Verfassungen Kompromisse zwischen Parteien mit konträren Gesellschaftskonzepten (von unterschiedlichen Sozialismusmodellen bis zum christlichen Ständestaat) waren. Demokratie war die Spielregel, aber damals nur teilweise auch ein Wert an sich. Würde die Bevölkerung mehrheitlich für eine Partei stimmen, welche die Abschaffung des geltenden repräsentativdemokratischen Systems - mit Parteienpluralismus, Meinungsfreiheit, Grundrechten - vertreten würde, dann wäre dies im Rahmen einer derartigen "neutralen Demokratie" zu akzeptieren.
Als Antwort auf den Zusammenbruch zahlreicher demokratischer Systeme in der Zwischenkriegszeit und die spätere Machtübernahme der Kommunisten in den Satellitenstaaten der Sowjetunion wurde die Doktrin der "streitbaren Demokratie" entwickelt. Dabei spielte eine Rolle, dass Machtübernahmen totalitärer Parteien zwar formal teilweise legal erfolgten, in der Praxis aber von massiver Gewalt auf der Straße und dem terroristischen Einsatz des Staatsapparats zur Beseitigung der Opposition geprägt waren. "Keine Freiheit für die Feinde der Freiheit", lautete das Motto bei der Ausarbeitung des Bonner Grundgesetzes 1949. Nach diesem sind verfassungswidrige Parteien vom Bundesverfassungsgericht zu verbieten. In den fünfziger Jahren wurden auf diesen Weg die (neonazistische) Sozialistische Reichspartei und die KPD verboten.
Gegen solche Verbote spricht, dass die Grenzziehung zwischen erlaubten und verbotenen Positionen fließend sein kann. Gesinnungsdruck ist mit der Wahrung der Meinungsfreiheit schwer vereinbar. Mit dem Tauwetter im Kalten Krieg und der Konsolidierung der demokratischen Parteien wurde daher die deutsche Politik toleranter. Seit den sechziger Jahren verzichtete die Regierung auf Verbotsanträge: Sowohl NPD, DVU und später Republikaner, als auch die (nur formell keine Nachfolgepartei der KPD darstellende) DKP konnten sich als Parteien betätigen. Die Toleranz war immer eine Toleranz auf Abruf und mit deutlichen Einschränkungen: Diese Parteien wurden meist vom Verfassungsschutz überwacht, was bei reinen Untergrundorganisationen schwieriger gewesen wäre. Ihre Mitglieder hatten aufgrund von Radikalenerlässen berufliche Nachteile: Mit dem juristisch problematischen Kunstkniff, dass diese Parteien nicht verfassungswidrig seien, ihre Mitglieder aber dennoch nicht die vom (deutschen) Beamtendienstrecht erforderliche Verfassungstreue erbringen könnten, wurden in den Siebzigern vor allem Linksextreme vom öffentlichen Dienst ausgeschlossen. Der immer vorhandenen Möglichkeit eines Parteiverbots kann durchaus eine mäßigende Wirkung auf das Auftreten extremistischer Parteien zugeschrieben werden.
Erst heuer, unter dem Eindruck rassistischer und antisemitischer Ausschreitungen und Terrorakte, ist wieder ein Verbotsantrag in Ausarbeitung: Die internationale Schande, als Ursprungsland der Schoa mit der radikalisierten NPD wieder eine nur wenig verhüllt neonazistische Partei zu dulden und mit rechtsextremen Ausschreitungen nicht zu Rande zu kommen, scheint die demokratiepolitischen und kriminalistischen Vorteile einer Nichtuntersagung zu überwiegen. Das Motiv ist ehrenvoll, der Erfolg zweifelhaft, die Maßnahme möglicherweise dennoch sinnvoll.
Der Autor ist Politikwissenschafter am Institut für Konfliktforschung.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!