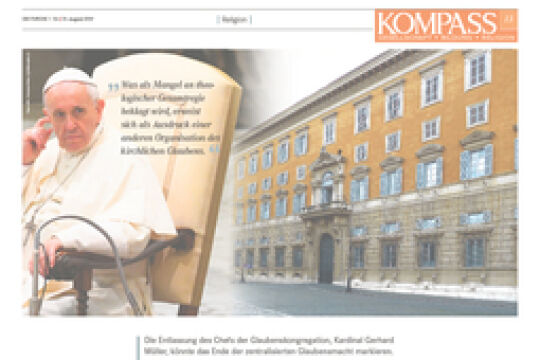Bernd Jochen Hilberath: „Dieser Text ist eine Katastrophe“
Bernd Jochen Hilberath, Direktor des Instituts für Ökumenische Forschung in Tübingen im Interview mit Doris Helberger-Fleckl über die jüngste Post aus Rom, alte und neue Modelle von Kirche und das ökomenische Miteinander.
Bernd Jochen Hilberath, Direktor des Instituts für Ökumenische Forschung in Tübingen im Interview mit Doris Helberger-Fleckl über die jüngste Post aus Rom, alte und neue Modelle von Kirche und das ökomenische Miteinander.
Zuerst der Segen für die "Alte Messe", dann die Ohrfeige für die Evangelischen: Bernd Jochen Hilberath, Direktor des Instituts für Ökumenische Forschung in Tübingen, leidet unter der jüngsten Post aus Rom - und plädiert umso mehr für ein ökumenisches Miteinander an der Basis.
Die Furche: Herr Professor Hilberath, die vatikanische Glaubenskongregation hat zuletzt ein Dokument veröffentlicht, in dem den Kirchen der Reformation das eigentliche "Kirche-Sein" abgesprochen wird - fast gleichlautend wie in der Erklärung "Dominus Iesus", die im Jahr 2000 unter dem damaligen Präfekten Kardinal Joseph Ratzinger publiziert worden ist. Wie bewerten Sie als katholischer Theologe den neuen Text?
Bernd Jochen Hilberath: Es ist für die ökumenische Bewegung ein Schlag, man könnte sagen eine Katastrophe - auch wenn von den Bischöfen gesagt wird, da stünde gegenüber Dominus Iesus nichts Neues drin. Umso mehr fragt man sich: Warum jetzt dieser Nachschlag? Offenbar ist es so, dass bestimmte Kreise, die ich im Blick auf unsere Kirchenlandschaft als Minderheit bezeichnen würde, Anfragen an den Vatikan stellen, um von ihm die Antworten zu bekommen, die sie sich wünschen. Es ist aus gewöhnlich gut unterrichteten Kreisen bekannt, dass Schlimmeres geplant war und dass das von den ökumenisch Gesinnten in der Glaubenskongregation verhindert werden konnte. Hier wird jedenfalls versucht, zu einem alten Modell von Kirche und einem damit verbundenen Modell von Ökumene zurückzukehren. Wir können einerseits glücklich sein, dass viele evangelische Kolleginnen und Kollegen das einzuordnen wissen und dass die Ökumene an der Basis weitergehen wird. Aber ich habe auch schon Stimmen von sogenannten Basischristen gehört, die gesagt haben, es werde immer schwieriger, sich in dieser Kirche noch beheimatet zu fühlen.
Die Furche: Die Kirchen der Reformation sind nach Ansicht der Glaubenskongregation deshalb keine Kirchen, weil sie nicht in der "apostolischen Sukzession" stünden …
Hilberath: Wenn die Glaubenskongregation wahrnehmen würde, was in der ökumenischen Theologie seit dem Vatikanischen Konzil erarbeitet worden ist, dann wäre sie auf die Unterscheidung gestoßen zwischen einer grundsätzlichen Apostolizität der Kirche und einer apostolischen Nachfolge im Amt. Die grundsätzliche Apostolizität der Kirche kann mit Kapitel 2 Vers 42 der Apostelgeschichte belegt werden - dort steht: "Sie hielten an der Lehre der Apostel fest und an der Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und an den Gebeten." Das sind die Grundvollzüge von Kirche: Verkündigung, Gottesdienst und Diakonie. Alle christlichen Gemeinschaften, die das realisieren, müssten eigentlich schon Kirchen genannt werden. Die Frage nach der apostolischen Sukzession der Ämter, diese ununterbrochene historische Kette der Handauflegung, ist zwar der orthodoxen, der katholischen und zum Teil auch der anglikanischen Kirche wichtig, aber wenn das nur etwas ist, was der Apostolizität der gesamten Glaubensgemeinschaft dient, könnte es vielleicht auch eine größere Flexibilität geben.
Die Furche: Was soll jetzt aus ökumenischer Sicht geschehen, um Schadensbegrenzung zu üben?
Hilberath: Vermutlich ist es das Beste, wenn die Kirchen, die Gemeinschaften, die das ökumenische Miteinander leben, einfach weitermachen. Proteste werden nichts nützen. Es scheint ja vor allem eine rote Karte für die Theologen zu sein. Man muss abwarten, ob es gegenüber Theologen, die dagegen argumentieren, irgendwelche Maßnahmen gibt oder ob eine dritte Erklärung kommt. Manche Kreise, die den Theologen prinzipiell misstrauen, wenn sie nicht genau ihrer Meinung sind, wollten das so. Natürlich sagen nun Kollegen zu mir: "Na, Hilberath, ich habe schon immer gesagt, nur in Rom wird das Zweite Vatikanum interpretiert." Da kann ich nur sagen: Ich glaube nicht, dass das eine authentische Interpretation des Konzils ist.
Die Furche: Wie ist der Umstand einzuschätzen, dass der Text unmittelbar nach dem Motu Proprio "Summorum Pontificum" des Papstes über die Freigabe der "Alten Messe" nach dem tridentinischen Ritus veröffentlicht wurde?
Hilberath: Man hat den Eindruck, dass diese zwei Dinge zusammenpassen - wobei man zum Motu Proprio eines klar sagen muss: Es geht hier nicht darum, Choral singen oder etwas auf Latein feiern zu dürfen. Das ist ohnehin zugestanden. Aber mit dieser alten Form der Messfeier wird ja auch ein Bild von Kirche, von Abendmahl, von Opfer, von Priestertum transportiert, das nach dem Konzil nicht mehr ungebrochen gelten kann.
Die Furche: Wobei die Glaubenskongregation betont, dass die Gläubigen nunmehr selbst zwischen den "zwei Anwendungsformen des einen Römischen Ritus" wählen könnten …
Hilberath: Das war eher ein raffinierter vatikanischer Schachzug, um die Bischöfe auszuhebeln. Jetzt sollen die Priester vor Ort entscheiden, ja eigentlich die Minderheiten vor Ort. Das hat es nach dem Konzil immer wieder gegeben, dass der Vatikan versucht, an den Ortsbischöfen vorbei eine ganz bestimmte Klientel im Kirchenvolk zu bedienen.
Die Furche: So umstritten der aktuelle Papst ist: Er ist - wie das Papstamt insgesamt - eine katholische "Marke", die nach Meinung mancher Medienexperten noch bewusster eingesetzt werden sollte. Was wären die Vor- und Nachteile eines solchen Marketings?
Hilberath: Zu den Nachteilen der "Marke Papst" gehört nicht nur das Autoritätsproblem: Wenn der Papst die Marke ist, dann wird ja - bildhaft gesprochen - der Autoverkäufer anstelle des Autos beworben. Es geht aber um das Auto, also um Gott, um in diesem Sprachspiel zu bleiben. Gott ist unsere Marke, und alle anderen sind dazu da, diese Marke zu präsentieren. Bei der Verlagerung von dem, worum es eigentlich geht, auf eine Amtsperson - egal, wie fromm, heilig oder unbescholten sie sein mag - stimmt einfach die Relation nicht. Deswegen ist die Strategie, den Papst als Marke zu bezeichnen, abzulehnen. Man muss sich auch darüber unterhalten, was eigentlich mit Gott als Marke gemeint ist. Gott ist ja nicht unser Produkt, das wir vermarkten können, sondern im Gegenteil: Wenn wir eine Gotteserfahrung machen, sind wir von Gott markiert und sollen das entsprechend markant leben.
Die Furche: Sie erforschen als "kommunikativer Theologe", inwiefern das Bild eines dreieinen Gottes für unser Leben relevant sein kann. Auf welche Antwort sind Sie gestoßen?
Hilberath: Nun, das Bild eines dreieinigen Gottes zeigt uns, dass Gott ein beziehungsfähiges und ein beziehungswilliges Wesen ist. In Gott selber gibt es schon Beziehungen. Er braucht eigentlich die Welt und uns Menschen nicht, um Beziehung einzugehen. Umso großartiger ist es, dass Gott trotzdem aus sich herausgeht und auf uns zugeht. Er ist durch und durch ein Beziehungswesen. Und wenn das für Gott gilt, der ja das Modell von Wirklichkeit ist, dann heißt das doch: Es kann Einheit geben und Pluralität, ohne dass das ein Gegensatz ist. Darin sähe ich die Relevanz dieses Gottesbildes für unser Menschenbild. Leonardo Boff hat das etwas kantig ausgedrückt, indem er sagte: Die Trinität, dieses Modell einer prinzipiellen Gleichheit von Unterschiedlichen, ist unser wahres Gesellschaftsprogramm.
Tacheles-Redner mit Gegenwind aus Rom
Eigentlich sollte es ja um "Die Marke Gott - zwischen Bedeutungslosigkeit und Lebensinhalt" gehen. Doch zumindest Anfang und Ende der diesjährigen Ökumenischen Sommerakademie in Kremsmünster (veranstaltet u. a. vom ORF Oberösterreich, dem Ökumenischen Rat der Kirchen in Österreich und der Katholisch-Theologischen Privatuniversität Linz) standen ganz im Zeichen jener beiden Vatikan-Dokumente, die weltweit für Aufregung sorgten: des Motu Proprio "Summorum Pontificum" von Papst Benedikt XVI. über die Freigabe der "Alten Messe"; und jenes Textes der Glaubenskongregation, der den Kirchen der Reformation abermals abspricht, Kirche im Wortsinn zu sein ("Antworten auf Fragen zu einigen Aspekten bezüglich der Lehre über die Kirche"). Da traf es sich gut, dass Bernd Jochen Hilberath als erster Vortragender das Wort ergriff: "Gehen Sie Ihren Weg der Theologie des rechten Lebens weiter", forderte der katholische Theologe die Anwesenden im Kaisersaal des Benediktinerstiftes auf. "Man soll sich mit Fragen, die nicht zu den zentralen gehören, nicht über Gebühr aufhalten." Keine Frage: Der 1948 in Bingen am Rhein geborene Dogmatik-Professor (Schwerpunkt Kommunikative Theologie) und Direktor des Instituts für Ökumenische Forschung an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Tübingen spricht Tacheles - fast ebenso wie Hans Küng, der Gründer dieses Instituts. Die Ursache für sein Ökumene-Engagement sieht der vierfache Vater, der von 2004 bis 2006 auch Präsident der Societas Oecumenica war, in seiner Herkunft: "Ich komme aus einer sehr katholischen Stadt. Doch die Kooperation mit den Evangelischen, die war immer selbstverständlich."