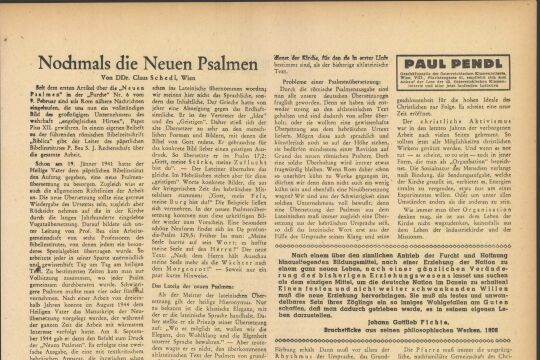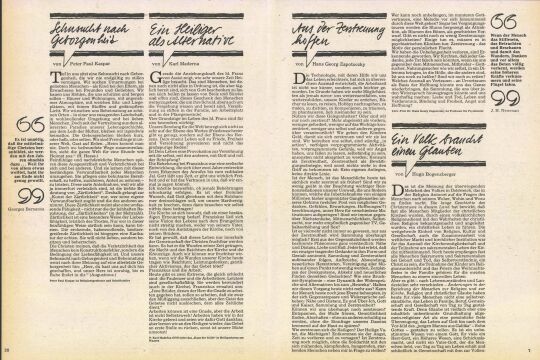Pfarrgemeinden: Erfahrungsorte für die "eigene Religion"
Die persönlichen Geschmäcker in Bezug auf Religion haben sich in den letzten Jahrzehnten massiv verändert. Zur Zukunft der Pfarrgemeinden.
Die persönlichen Geschmäcker in Bezug auf Religion haben sich in den letzten Jahrzehnten massiv verändert. Zur Zukunft der Pfarrgemeinden.
Unsere Pfarren müssen zu Gemeinden werden": So forderte es 1970 Ferdinand Klostermann und prägte damit eine ganze Epoche der katholischen Pastoralgeschichte. "Gemeinde": Das war die Hoffnung auf einen intensiven, geschwisterlichen Raum, geprägt und gestaltet von engagierten Katholiken und Katholikinnen, die ihr Leben im Geist Christi miteinander teilen.
Dieser Ansatz war für die traditionell eher juridisch als kommunitär denkende katholische Kirche ziemlich neu und ein wirklicher Fortschritt. Denn er überwand das vorkonziliare repressive katholische Milieu, wertete die Laien auf und stand für ein grundsätzlich positives Verhältnis zur zeitgenössischen Moderne.
Seit einiger Zeit zeigen sich aber die Grenzen dieses Konzepts. Zum einen gehen der Pfarrfamilie die Väter aus. Der schon länger absehbare Mangel an Priestern wandert gegenwärtig aus den prognostischen Statistiken in die Erfahrungsrealität des kirchlichen Alltags. Das löst das gemeindetheologische Normalbild einer um den Pfarrpriester gescharten, überschaubaren, lokal umschriebenen, einander verbundenen und kommunikativ verdichteten pfarrlichen Glaubensgemeinschaft auf.
Der Pfarrfamilie gehen aber nicht nur die Väter aus, es bleiben auch die Kinder weg, und nicht nur sie. In einer Gesellschaft, die "eigenes Leben" erzwingt, lassen sich die Einzelnen nur mehr schwer in eine einzige, gar monopolistische religiöse Sozialform eingemeinden. Die lokale Entbettung des sozialen Lebens greift auch im Bereich der Religion. Religion vergesellschaftet sich immer weniger in dauerhaften Gemeinschaftsformen, vielmehr zunehmend marktförmig, also situativ und nicht normativ.
Kirche ist mehr als Pfarrgemeinde
Das aber heißt: Nicht die Gemeinde ist mehr der soziale Mikrokosmos der persönlichen Religion, sondern die "eigene Religion" ist der Kosmos, in dem man sich, wenn überhaupt, religiöse Erfahrungsorte sucht. Seit der Mitte des 20. Jahrhunderts haben sich zudem die gesellschaftlich legitimen Lebensstile enorm pluralisiert. Diverse Studien haben gezeigt, dass die Pfarrgemeinden spezifische dieser Lebensstile nur schwer integrieren können. Die territoriale Pfarrgemeinde erlitt denn auch nach 1950 in Österreich einen massiven und kontinuierlichen Reichweitenverlust: Der Sonntagskirchgang etwa hat sich um zwei Drittel reduziert.
Nun braucht Kirche ohne Zweifel eine basisnahe Sozialform jenseits der Primärgruppe und diesseits der gesamtgesellschaftlichen Ebene. Aber ebenso klar ist auch: Kirche ist mehr als Pfarrgemeinde. Sie existiert auch in hohem Maße recht erfolgreich jenseits von ihr. All das, was etwa in Diakonie und Bildung an Vergegenwärtigung des Evangeliums in Wort und Tat geschieht, besitzt unbestreitbar kirchliche Würde.
Nun lernt man Christsein in Gemeinschaft und lebt man Christsein in Gemeinschaft. Die Pfarrgemeinde als Sozialisationsort christlicher Lebensführung, als naher Erfahrungsort von katholischer Religion in Wort und Tat wird die zentrale Sozialform mittlerer Reichweite der Kirche bleiben. Aber das beantwortet noch nicht die Frage, welche Aufgaben sie als spezifischer Ort der Kirche heute in religiös ziemlich neuen Zeiten erfüllen kann und muss.
Liturgie und Deutung der Zeichen der Zeit
Keine Sozialform der Kirche gibt es um ihrer selber willen. Alle sind dazu da zu tun, wofür es Kirche gibt: heutiges Leben mit dem Evangelium zu konfrontieren, kreativ und hilfreich, neue Wege eröffnend, Wege, die man ohne das Evangelium nicht hätte. Das nennt das Konzil Pastoral. Auch Pfarrgemeinden sind dazu da -und nur dazu -, Pastoral zu ermöglichen. Sie müssen also alles tun dürfen, was jenen Männern und Frauen, die sich in ihr versammeln, an Kreativität aus dem Evangelium geschenkt ist. Denn Pastoral als wechselseitiger Entdeckungsprozess von Evangelium und Existenz, in Wort und Tat, ist bei aller Vorbildlichkeit der Väter und Mütter unseres Glaubens ein offener, risikoreicher, gewagter Prozess, unabgeschlossen und von Rückschlägen nicht frei, aber auch erregend und voller intensiver Erfahrungen.
Potenziell soll eine Gemeinde also all das an Pastoral tun, was sie kann. Das kann an verschiedenen Orten ganz Verschiedenes sein. Was der Pfarrgemeinde an Charismen durch Gottes Gnade geschenkt ist, soll sie mit aller Kraft verwirklichen und auch verwirklichen dürfen. Aber was ihr nicht geschenkt ist, soll sie nicht machen müssen. Freilich gibt es zwei Aufgaben, der sich keine Pfarrgemeinde entziehen darf: der Liturgie und der Deutung der Zeichen der Zeit vor Ort.
Die Liturgie ist der zentrale gnadentheologische Vollzug der Kirche, sie ist der "Ort und jene Zeit, in der sich das Volk Gottes von der Menschenfreundlichkeit Gottes anstecken, formen und zu neuem Handeln inspirieren lässt"(Peter Ebenbauer). Nie darf eine Pfarrgemeinde aufhören, nichts und niemand darf eine Pfarrgemeinde daran hindern, Liturgie zu feiern, in vielfältigen Formen, geleitet von Männern und Frauen und immer in Demut vor der größeren Gnade Gottes. Die gemeinsame Feier, das gemeinsame Gebet, das Hören und Bedenken des Evangeliums: Sie sind tatsächlich die Mitte einer jeden Pfarrgemeinde.
Zum anderen aber darf sich keine Pfarrgemeinde der Aufgabe entziehen, auf die "Zeichen der Zeit" vor Ort im Lichte des Evangeliums zu deuten. Dazu muss eine Pfarrgemeinde den Sozialraum wahrnehmen, in dem sie und für den sie lebt. Die Territorialität der Pfarrgemeinde wird dann zur diakonischen Selbstanbietung der Kirche an alle. Das Territorialprinzip steht für das Angebot der Gnade Gottes an alle Menschen, wo immer sie leben und wer immer sie sind. Es zwingt die Kirche hinein in die Gesellschaft, zwingt Kirche, sich mit den Sorgen und Nöten der Menschen vor Ort zu identifizieren, sie in sich aufzunehmen, ihnen gerecht zu werden.
Sich ins große kirchliche Netz einweben
Es würde dabei die Pfarrgemeinden entlasten, wenn sie sich selbst stärker einweben würden ins große kirchliche Netz pastoraler Orte. Es gibt viele Orte, an denen die kreative Konfrontation von Evangelium und Existenz geschieht, so die diakonischen Orte konkreten Einsatzes für Barmherzigkeit und Gerechtigkeit. Sie alle können voneinander lernen, einander helfen: gleichstufig, neugierig, respektvoll. Eine so verstandene Gesamtpastoral fordert eine reversible, wertschätzende Kommunikationskultur jenseits der bürokratischen und religiösen Vermachtung. Man muss nach den Stärken der jeweils anderen suchen und alle Rivalitäten um theologische Bedeutung und finanzielle und personelle Ressourcen hinter sich lassen.
Liebende Aufmerksamkeit, Demut, Vertrauen
Die Pfarrgemeinde hat Zukunft, wenn sie ein Ort ist, an dem wir die Gnade Gottes in der Liturgie erfahren, ein Ort ist, an dem jeder und jedem angeboten wird, mit seinem Leben, mag es noch so fragil und beschädigt sein, mit der Botschaft des Evangeliums in Kontakt zu kommen, wenn die Pfarrgemeinde ein Ort ist, an dem Charismen nicht verwaltet und diszipliniert, sondern gefördert und begrüßt werden und wo man sich selbst als Teil der großen und reichen kirchlichen Landschaft begreift. Die Pfarrgemeinde ist dann Teil des großen pastoralen Projekts, Zeichen und Werkzeug der Liebe Gottes unter den Menschen zu sein und für alle Menschen.
Die zentralen geistlichen Kompetenzen, die man dafür braucht, sind liebende Aufmerksamkeit, Demut und Vertrauen. Liebende Aufmerksamkeit heißt, die Wirklichkeit wahrzunehmen, wie sie ist, und ihr, so wie sie ist, mit Liebe und Aufmerksamkeit zu begegnen. Demut aber heißt, den anderen wichtiger zu nehmen als sich selbst, und Ermutigung durch Vertrauen bedeutet, dem anderen (und auch sich selbst) ein wenig mehr zuzutrauen, als er (und man selbst) es eigentlich verdient, und deshalb für ihn und mit ihm mehr zu wagen, als eigentlich vernünftig ist.
Das ist der pastorale Habitus, der überall in der Kirche, vor allem aber in den Pfarrgemeinden notwendig ist, wollen sie zukunftsfähig werden. Es geht um die Freude des Evangeliums, die entsteht, wenn es auf die Wirklichkeit des Lebens heute trifft. Spürt man diese Freude in den Pfarrgemeinden, werden sie leben.
Der Autor ist Prof. für Pastoraltheologie an der Kath.-Theol. Fakultät der Uni Graz
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!