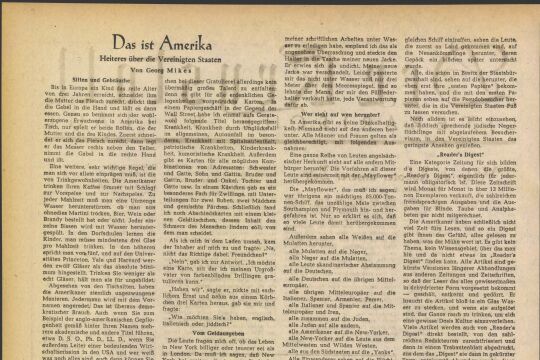Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
HoflicMceit und M anieren der Amerikaner
Man hat behauptet, daß Amerikaner im allgemeinen große Höflichkeit und schlechte Manieren hätten. Da man aber in Europa nur selten zwischen beiden zu unterscheiden gewohnt ist, neigt man dazu, Amerikanern auch einen Mangel an Höflichkeit zuzuschreiben. Während Manieren ein reines, auf Regungslosigkeit des menschlichen Verkehrs abzielendes Formabkommen bedeutet, sind Herz, Geist und Takt der Höflichkeit unentbehrlich. So kann man manierlos höflich sein, wie man ja auch unmoralisch, aber gleichzeitig völlig legal handeln kann.
In Amerika, wo alles im Flusse ist und ein elastisches Gefüge der Gesellschaft Freiheit der Bewegung c~i der Umgangsformen verbürgt, fühlt sich der Europäer oft durch die Abwesenheit zeremonieller Manieren betroffen. Diesen Mangel mag er zunächst als Respektlosigkeit empfinden, ohne zu erkennen, daß der Amerikaner jeder hierarchischen Wertung abgeneigt ist. Beim Vorstellen verbeugt er sich nicht, sondern sucht einen Augenkontakt, er schüttelt nicht die Hand, er pumpt sie geradezu, er besteht auf genauer Namensnennung bis zur Buchstabierung; wobei er nicht selten die linke Hand in der Hosentasche ruhen läßt. Er befleißigt sich eines Lächelns, das etwas zu stereotyp erscheinen mag, er zwingt sich nicht zum längeren Konversationmachen, wenn es ihm nicht paßt, und es liegt ihm wenig daran, auf andere „Eindruck zu machen“. Er macht Besuche, ohne sich vorher formell angemeldet zu haben, spricht ungezwungen und häufig laut, eröffnet ohne Umstände seine Geld- und Familienverhältnisse bis zur Religion hin, räuspert sich ungezwungen, legt einem ohne viele Umstände die Hand auf die Schultern, geht im Sommer mit heraushängenden Hemden spazieren, lüftet beim Grüßen den Hut nicht, sondern berührt ihn nur leicht, beeilt sich, auch Bekannte entfernteren Grades so schnell wie möglich mit dem Vornamen anzusprechen und nennt die Dinge ohne Umstände beim Namen. Er hat beneidenswert gute Nerven.
Auch er hat natürlich seine Manieren, seine Etikette: im Lift nimmter wie in der .Kirche den -,rt}t| atp? wenn Frauen einsteigen, er bedient sich der Gabel in recht umständlicher Weise, da er sie nur mit der rechten Hand zum Munde führt, sie also wieder zur linken bringt, wenn er einen Bissen Fleisch zurechtschneidet und vor seinem Genuß wieder reversieren muß, er schiebt seiner Tischpartnerin beim Niedersetzen immer den Stuhl unter, er erhebt sich von seinem Stuhle, so oft eine Dame das Zimmer betritt, er wechselt vernünftigerweise auf der Straße immer die Seite seiner Dame, um sie vor Schmutz und Gefahren des Verkehrs zu schützen, und er applaudiert grundsätzlich aus einem sozialen Empfinden heraus, in der Erkenntnis nämlich, daß der Redner sein Bestes getan und der Künstler die Kühnheit seines Auftretens ohnedies mit erhöhtem Blutdruck und Herzklopfen bezahlt hat.
Hier aber sind wir eigentlich schon bei der Höflichkeit angelangt, bei der Rücksichtnahme auf den andern, bei einem unbedingten Bestehen darauf, dem Nächsten die gleichen Rechte einzuräumen und zu verteidigen, auf die man selbst Anspruch erhebt und besteht. Eine der angenehmsten Formen dieser Höflichkeit, die sich fast ausschließlich in Sprache und Stimme manifestiert, ist ein vorsichtiges Vorwärts-tästen, ein Sichermachen und Verankern von Aussagen seitens des Diskussionspartners. Man verkürzt Schlüsse nicht, sondern festigt sie, wobei man darauf bedacht ist, Objektivität zu bewahren, trotz des Wunsches, die Debatte oder den Fall für sich zu entscheiden. Man fragt, ob dies so oder so gemeint sei, ob man richtig verstanden habe, ob jene Aeußerung sich etwa auf etwas vorher Berührtes beziehe, und man verhält sich wie ein zu Belehrender, wobei man die Aussagen des Gesprächspartners nicht benutzt, um sich seine eigenen Gedanken zurechtzulegen. Man vermeidet apodiktische Feststellungen und sucht das Persönliche dem Sachlichen unterzuordnen.
Selbst wenn man eine Diskussion für sich entschieden hat, gibt man sich nicht als Sieger, sondern zieht es vor, zur Tagesordnung überzugehen. Wann immer möglich, sucht man das Gespräch zu entspannen, durch Humor zu würzen, wobei man sogar sich selbst zur Zielscheibe des Witzes wählt, nur um dem andern zu versichern, daß man sich keinesweg einbildet, mehr als er zu sein. Diese Ritterlichkeit — soferne man dieses Wort im Amerikanischen überhaupt gebrauchen kann — beruht auf einer demokratischen Abneigung, sich wertgemäß einzustufen. Da man nie ganz sicher ist, daß man absolut recht hat, ist der Widerstand gegen ein Kompromiß recht gering. Ins politische Leben übersetzt bedeutet das, daß dem Realisten die Führung überlassen bleibt. So gehört eine scharfe, konsequente Frontenstellung zu den Seltenheiten. Leidenschaft und Pathos, nicht selten auch Idealismus werden verdächtigt, da sie leicht zu Einseitigkeiten führen. Einseitigkeiten aber bedeuten dem Amerikaner immer Unsachlichkeit, sie verursachen ihm ein Unbehagen und unterbinden einen freien Meinungsaustausch. Hier hört natürlich auch die Höflichkeit auf.
Er läßt jeden nach seiner Fasson selig werden, auch in der Sprache, die ihm stets Mittel, nie Zweck (selbst in der Dichtung) ist. Hier hat die Höflichkeit freilich bereits einp durch Bequemlichkeit bestimmte Toleranz zur Grundlage. Der Gebildete stellt sich nicht mit seinen akademischen Titeln vor, er begnügt sich mit der Nennung seines Zunamens. Auch dies ist Höf* licelfc-tm'zwfsheh “slcS-untf deW'Wfcfhtaka* demik'er T5istanz zu “vermeiden. Er be'da'rf dieser Würdentitel nicht, die Kontinentaleuropäer wie eine reisende Dienerschaft begleiten. Solch eine Auffassung spricht für eine große innere Sicherheit und für Verhandlungen mit jedermann auf gleichem Fuße.
Paradoxerweise ist die Höflichkeit des amerikanischen Autofahrers viel größer als die des kontinentaleuropäischen — mit Ausnahme der Sonderstädte New York und Chicago. Er hält bei gestrandeten Fahrzeugen an, sucht den Schaden zu beheben, leiht Werkzeuge und nicht selten Geld ohne Garantie und benimmt sich dabei so, als wäre gerade diese Hilfeleistung der Zweck seiner Fahrt gewesen. Diese Höflichkeit der Straße rührt noch von der Pionierzeit her und von der Gewißheit, daß man in ähnlicher Lage mit gleicher Hilfsbereitschaft rechnen kann. Bei Verkehrsunfällen verlegt man sich nicht darauf, die Schuld dem andern in die Schuhe zu schieben, sondern kümmert sich zunächst sachlich um die Verletzten und dann um den Sachschaden, wobei allerdings eine in der Regel reichlich deckende Versicherung den ohnedies starken Nerven zugute kommt. Eine Tendenz, den andern zu belehren, besteht nicht.
Vielleicht läßt sich die spezifische Höflichkeit am besten im Familienleben erkennen. Gehen wir davon aus, daß es fast kein Vater-Sohn-Problem gibt. Woher dieser schöne Mangel? Das Kind wird als durchaus zu respektierende Individualität gewertet, als ein junger Mensch, dem man verständnisvolles Augenmerk auf seiner Ebene schenken müsse wie einem Erwachsenen. Die Redensart „Kinder sollen gesehen, aber nicht gehört werden“ bleibt unverständlich. Man erinnert sich, daß die Kinder um ihren Eintritt in diese so oft fragwürdige Welt nicht bei den Eltern vor ihrer Geburt vorstellig geworden sind. Europäer schließen schnell, daß sich die Amerikaner um die Erziehung ihrer Kinder entweder nicht kümmern oder sie mit zuviel Freiheit heranwachsen lassen. Gerade diese Freiheit aber legt dem Kinde eine Verantwortung auf, der es gerecht zu werden bestrebt ist. Die Autorität des Vaters ist durch Freundschaft temperiert und außerdem auch durch die Mutter im Zaum gehalten. Entscheidungen werden nicht erlassen oder verkündet, sondern lieber durch gemeinsame Besprechung erreicht. Man lese einmal eine so bezeichnende Geschichte, wie „The Pheasant Hunter“ von William Saroyan, um dieses Prinzip, dargestellt zu finden. Solche Familienhöflichkeit fordert zur Nachahmung heraus. In den Schulen sucht man Kinder für die Richtigkeit eines Verhaltens zu gewinnen, sie zu überzeugen, nicht zu überreden. So wird schon sehr früh das Verantwortungsbewußtsein des Kindes erweckt, das sich namentlich in einer Mitarbeit zu erkennen gibt, in zahllosen Ausschüssen, wo der einzelne sich
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!