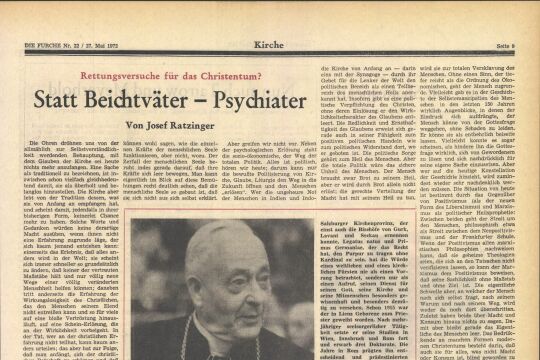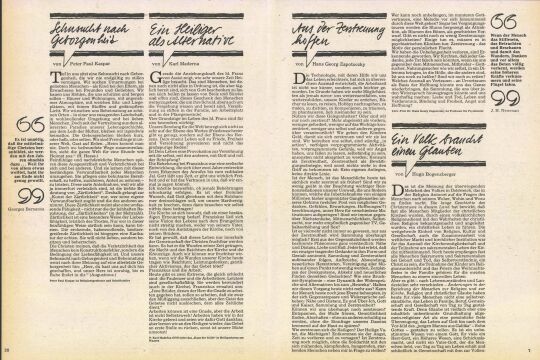Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Ja zur Hoffnung, Nein zu Illusionen
Wolfgang Kraus bezeichnete kürzlich („Hoffen auf das Unmögliche", FURCHE 5/96) den Satz des Heiligen Paulus (Römerbrief) „Gegen alle Hoffnung hat er voll Hoffnung geglaubt" als eine in unserer Situation höchst aktuelle und eine der „stärksten und wirksamsten Formulierungen", die er kennt. Darin kann man sich ihm voll anschließen: Entgegen aller (der Vernunft einsichtiger) Hoffnung, doch zu glauben, ist eben glauben und hoffen zugleich!
Die Frage ist nur, ob diese bloß glaubensbedingte Hoffnung für beide Dimensionen menschlichen Daseins gilt: Für das eigene persönlich-individuelle Heilsgeschehen oder auch für das soziale Heil der ihrem Wesen nach diesseitigen Gesellschaft.
Kraus fühlt sich heute verständlicherweise als Beobachter in einer hoffnungslosen Lage, wenn er sich wünscht, daß ohne Krieg, Hunger und wirtschaftliche Katastrophen dennoch ein entsprechendes Maß an notwendigem Zukunftsdenken erwächst, bevor „die Not da ist", da „die Bettung aller menschlichen Logik widerspricht". Er begründet seine Hoffnungslosigkeit, die nur durch die Hoffnung aus Glaubensgründen überwunden werden könne, damit, daß „die Bevölkerung in einer Demokratie keineswegs bereit ist, über ihren gegenwartsbezogenen Hedo-nismus hinaus in ausreichendem Maß an die Zukunft zu denken".
Befriedigende Antworten setzen klärende Unterscheidungen zweier unterschiedlicher Ebenen voraus. Die nur gläubig sinnvolle Hoffnung auf das eigene (ewige) Heil als existentielles Ziel der Individuakthik jedes einzelnen Menschen kann nicht auf das irdische Heil einer sozialethischen Sol-lens-Ordnung übertragen werden. Schließlich handelt es sich bei beiden um grundsätzlich ganz unterschiedlich heilsrelevante Dimensionen. Auf das eigene (Seelen-)Heil müssen auch jene hoffen dürfen, die unter schier heilswidrigen gesellschaftlichen Bah-menbedingungen leben müssen.
Die Sozialethik hingegen hat gesellschaftliche Bahmenbedingungen zum Ziel, die - in der katholischen Soziallehre als „Gemeinwohl" - soziale Verhältnisse schaffen sollen, die es allen individuellen Menschen leichter machen, ihren existentiellen Lebenszwecken (Johannes Messner), das heißt ihrer wesentlichen Aufgabe zur Persönlichkeitsentfaltung (ihrem „Heilsauftrag") näher zu kommen. Die dafür hilfreichen sozialen Zustände, die - wie wir wissen - selbst durch
eine dauernde und von allen Beteiligten ohne Einschränkung geübte Tugendhaftigkeit nicht erreicht werden können, sind Zielsetzungen, die der Natur des geschaffenen und gefallenen Menschen zufolge nur mit Hilfe von Institutionen (mit oder ohne sichtbare Organisation) kraft deren Begel-sätzen, Anreizen und Sanktionen erreicht werden können.
Daß hier nur eine sehr eingeschränkte Zuversicht am Platze ist, legen die Lern- und Verlernprozesse in der bisherigen Sozialgeschichte der Menschheit nahe (Weltgeschichte als Heilsgeschichte nach Alois Dempf!). Wenn das Seelenheil des individuellen Menschen letztlich von diesen seinen sozialen Bahmenbedingungen abhängen würde, wäre es um das ihnen aufgetragene „geglückte Leben" selbst vieler gläubiger Christen in Vergangenheit, Gegenwart und alle Zukunft geschehen.
Anders als im Falle unseres individuellen Heiles als Kinder eines barmherzigen Gottes haben wir in bezug auf die Erfolge, die in der Gestaltung unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens auf dieser Welt und zur Lösung ihrer sozialen Konflikte erreicht werden könnten, für einen solchen Optimismus keinen Anlaß. Das ergibt sich nicht nur aus der Heiligen Schrift, zum Beispiel aus dem Wort Jesu an die Kritiker seiner Fußwaschung durch Maria Magdalena (die meinten, man möge das teure Ol nicht vergeuden, sondern verkaufen und den Erlös den Armen geben), daß wir Arme immer unter uns haben werden. Das legt doch wohl auch die Apokalypse des Johannes zwingend nahe, die die Welt, in der wir heute leben, im Zusammenbruch ihrer Ordnung schildert, wie immer diese dann auch aussehen möge.
Das ist auch aufgrund der heute erreichten Einsicht in die gesellschaftliche Entwicklung als Evolution menschlicher Institutionen, Systeme und Subsysteme einsichtig: Das häufige Verlangen unwissender Engagierter, „alles von Grund auf ganz anders zu machen ", ist uns im Lichte unseres realistischen und damit christlichen Menschenbildes schlechthin unmöglich. Erstens gibt es nirgendwo die „grüne Wiese", auf der eine solche Gesellschaft aufgebaut werden könnte. Angesichts der Komplexität unseres heutigen gesellschaftlichen Zusammenlebens würde uns - zweitens - auch das notwendige Wissen um ein optimales Zusammenwirken der vielen zwischenmenschlichen Institutionen und Systeme fehlen. Uns steht kein anderer Weg als der des „learning by doing" zur Verfügung.
Jede neue Generation von christlichen und human gesinnten Menschen stößt ferner jeweils auf jene „Tyrannei des Status quo", den ihre Vorgänger hinterlassen haben und der wieder nur stückweise, das heißt abgestellt auf die (hoffentlich) drin-
gendsten Probleme verändert werden kann. Infolge der interdependent verflochtenen Institutionen gibt es schließlich kaum eine Problemlösung, die nicht auch mit ungewollten oder unbekannten, jedenfalls aber kaum vermeidbaren Nebenwirkungen verbunden wäre. Das ist der Grund dafür, daß es bei den politischen Entscheidungen viel häufiger um das geringere Übel geht als um die optimale Lösung.
Ungeachtet unserer Sehnsucht nach Harmonie bleibt die Gesellschaft eine Konfliktgesellschaft. Nur relativ bescheidene Zielsetzungen rechtfertigen beschränkten Optimismus. Was wir bestenfalls erhoffen dürfen ist, daß sie immer mehr und immer wieder aufs neue jene Problemlösungskapazität gewinnt, die es den Menschen erlaubt, mit den Konflikten zu leben.Dem systemlogischen Standard einer menschengerechten Gesellschaft folgend ist der Spielraum für menschenwürdige politische Entscheidungen heute relativ eng: Sie
müssen nicht nur die erhofften Lösungen erwarten lassen, sie müssen auch den Grundsätzen des Bechts- und Verfassungsstaates entsprechen, im Wege demokratischer Entscheidungsregeln zustande kommen und daher jedesmal von einem ausreichenden Mindestkonsens aller Beteiligten getragen werden.
Absoluter Pessimismus ist am Platze, wenn jemand „den Himmel auf Erden" anstrebt, wie zum Beispiel der Priesterpoet Ernesto Cardenal, oder wenn jemand - wie nicht weniger oft! - eine Gesellschaft in „Frieden und gewaltloser Gerechtigkeit" in Aussicht stellt. Was wir bestenfalls erreichen können, ist eine etwas gerechtere und humanere Gesellschaft mit der wünschenswerten Fähigkeit, mehr gegenwärtige Probleme zu lösen als neue zu produzieren und den Einsatz des legitimen staatlichen Gewalten-
monopols (nach innen und nach außen) auf ein unvermeidbares Minimum zu reduzieren.
Gänzlich verfehlt ist auf der anderen Seite jener Pessimismus, der „die Welt" für unrettbar verloren hält und daher jede politische Verantwortung für ihren Zustand ablehnt wie heute zum Beispiel demonstrativ die Zeugen Jehovas.
Was uns allen entmutigenden Mißerfolgen zum Trotz dennoch zum Durchhalten veranlassen muß, ist das Wissen, daß die Hilfe, die jeweils auch nur einem Menschen zugute kommt, ein Erfolg und gleichzeitig ein christlicher Auftrag an uns ist, wie auch die Überzeugung, daß unser persönlicher Einsatz im Sozialinstitutionellen eine wesensnotwendige Bewährung in unserem eigenen individuellen Heilsgeschehen - und damit gerade ungeachtet aller Fehlschläge - sinnvoll ist.
Der Autor ist
ehemaliger Finanzminister und Noten-hankpräsident und Mitherausgeber der
Furche
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!