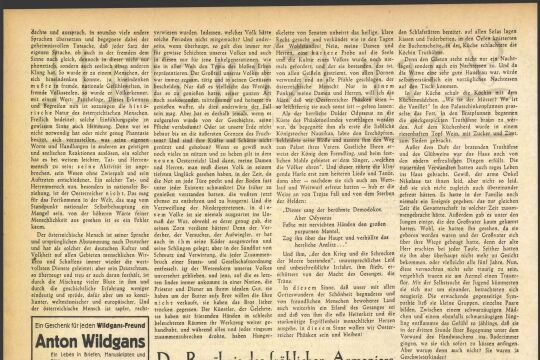Der Tod mache alle gleich, heißt es. Die Bestattung Wien versucht, diesem Sprichwort gerecht zu werden. Armenbegräbnisse auf dem Zentralfriedhof.
Im Leben hatten sie nichts miteinander zu tun. Die Mindestrentnerin und der Obdachlose sind einander vermutlich nie begegnet. Dass sie jetzt Seite an Seite in diesem Raum liegen, ist Zufall: Sie sind am selben Tag gestorben, sie im Spital und er auf der Straße. Nun werden sie auch am selben Tag beerdigt.
Das Wort "Armenbegräbnis" hört man bei der Bestattung Wien nicht gern. "Begräbnis auf Anordnung der Gesundheitsbehörde" heißt es offiziell, "Sozialbegräbnis" geht auch noch durch. Eine ganz normale Beerdigung, die kostengünstigste Variante eben, wird vom Bestattungsunternehmen der Stadt Wien durchgeführt, wenn sich innerhalb von fünf Tagen nach einem Todesfall kein anderer darum kümmert.
So wie bei der Mindestrentnerin Josefine und dem Obdachlosen Sascha. Die beiden grauen Särge, Modell "tapeziertes Weichholz", sind nicht zu unterscheiden. Nur die kleinen, silbernen Namensschilder sichern, dass die Kisten später nicht in den falschen Gruben landen.
Etwa 60 Sozialbegräbnisse werden monatlich auf dem Wiener Zentralfriedhof durchgeführt. Tausend Euro kostet jedes den Steuerzahler: für die Beurkundung des Sterbefalles beim Standesamt, für einen Sarg, für ein paar Blumen und eine Grabstelle samt Kreuz. Dazu eine kurze Trauerfeier mit einem Geistlichen, falls der Verstorbene im Leben einer Glaubensgemeinschaft angehört hat.
Trauergäste kommen selten. Heute ist eine Ausnahme. Fast 30 Leute, Verwandte und Bekannte der alten Frau, füllen die kleine Aufbahrungshalle. Einer von ihnen hat auf den vorderen Sarg lose fünf gelbe Rosen gelegt. Auf dem hinteren liegen ein paar Nelken. Die Blumen eben, die im Tausend-Euro-Paket enthalten sind. Hinterbliebene von Herrn Sascha sind keine gekommen.
Vierzig Sekunden lang erklingt Orgelmusik, während der Pfarrer den Raum durchquert und sich neben die schmalen Totenschreine stellt. Einer der vier Sargträger schließt die Tür, macht sich an dem Kassettenrekorder zu schaffen. Die Musik verstummt. "Wer ist der zweite?", will eine junge Frau von ihrer Nachbarin wissen und deutet auf den hinteren Sarg, während der Pfarrer von Hoffnung und Auferstehung redet. Aber auch die Andere hat keine Ahnung. Auch der Geistliche weiß über die beiden Verstorbenen nichts persönliches zu sagen. Die Fürbitten noch und das Vater Unser, dann ist die Feier vorbei.
Die vier Sargträger stemmen den vorderen Sarg auf die Schultern, tragen ihn im Gleichschritt zum ersten Leichenwagen. Das schwarze Auto setzt sich in Bewegung, fährt, gefolgt von Hinterbliebenen, langsam die Allee entlang. Dahinter, in einigem Abstand folgt das Fahrzeug mit dem zweiten Sarg.
Bis vor zwei Jahren wurden die "Sozialfälle" in einem eigens für sie reservierten Gräberhain in der Gruppe 36 bestattet. Die Grabstellen waren winzig, mit einfachen Holzbrettern statt Grabsteinen, die an zwei kurzen Pflöcken wenige Zentimeter über der Erde befestigt waren. Die Namen darauf waren nicht lange zu lesen. Der Regen machte dem umbehandelten Holz bald zu schaffen, die Buchstaben verwitterten. Mittlerweile ist das Gras dort kniehoch, sind die Tafeln nicht mehr auszumachen. Wer durch die Wiese geht, stolpert darüber. Nur die wenigen Holzkreuze, die von Verwandten oder Freunden aufgestellt wurden, ragen noch heraus.
Seit der Zentralfriedhof parkähnlich umgestaltet wird, gibt es in diesem Teil der Gruppe 36 keine Bestattungen mehr. Die Armengräber werden dezent zwischen anderen Gräbern verteilt. Heute in der Gruppe 70B, inmitten von Familiengräbern mit Steinen aus Marmor und Granit.
Der Pfarrer spricht am Grab den letzten Segen, bevor der Sarg der Mindestrentnerin hinunter gelassen wird. Die Trauergäste eilen zum Ausgang. Bald wird sich ein Friedhofsangestellter daran machen, die Grube mit Erde zu füllen. Am Grab von Herrn Sascha, nur wenige Meter von der ersten Grabstelle entfernt, nochmal die dieselbe Zeremonie: ein Segen, dann die Erde.
Am Schluss wird der Arbeiter in jeden der beiden Erdhügel ein hellbraunes Holzkreuz mit dem Namen des Toten stecken. Zehn Jahre wird es dort stehen bleiben. Dann ist der Platz wieder frei für jemanden anderen. Es sei denn, es meldet sich doch noch jemand, der die Grabmiete übernimmt. Aber das ist selten.