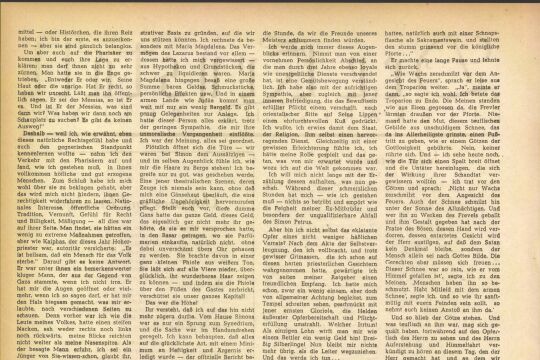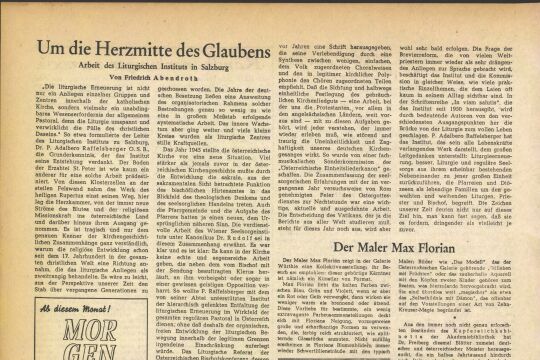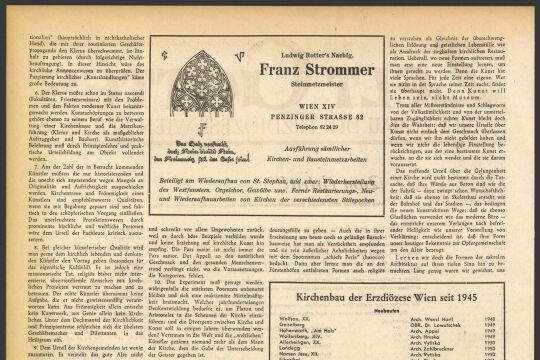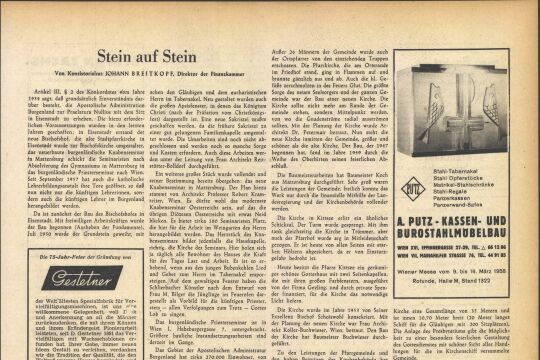Er ist Österreichs international anerkannter Experte für Liturgie und Raum. Architektursemiotik und Bildsymbolik gehörten zu seinen Forschungsgebieten. Von 1960 bis 1994 leitete er an der Akademie der bildenden Künste in Wien das Institut für Kirchenbau. Herbert Muck im furche-Gespräch über den Wiener "Altarstreit", die Entwicklung des Kirchenraums, das Erbe des Josephinimus und die Schwierigkeiten, "alte" Kirchen und "neue" Liturgie in Einklang zu bringen.
Die Furche: Vor kurzem gab es in Wien ein wenig Aufregung darüber, dass in der Kirche St. Rochus der Volksaltar wieder entfernt wurde. War der Volksaltar nur eine nachkonziliare "Mode", wie manche auch behaupten?
Herbert Muck: Für mich ist der Begriff "Volksaltar" ein völlig unsinniger, denn über "Volksaltar" gibt es weder irgendeine Aussage noch eine Vorschrift oder so etwas. Es gibt den frühchristlichen Befund von der "Mensa" …
Die Furche: … also - wörtlich übersetzt - eines "Tisches".
Muck: Der Ort der Mensa war inmitten der Leute, inmitten des Volkes, mitten im Kirchenschiff. Diese Zentralität, dieses Zusammensein im Raum war ein ganz eigenartiges Phänomen, ein Gegenstück zu den damaligen heidnischen Tempeln: Denn dort ist man ja in den Säulenhallen rund um den Tempel gestanden, das Volk war also draußen und das Heiligtum war innen, war unbetretbar. Da, wo Tempel umgebaut wurden, wurden die Verbindungsmauern zwischen den Säulen herausgenommen und die Wand wurde nach draußen gestellt rundherum. Das heißt, die Säulenreihe war nicht mehr der Rand, sondern das Innere. Das waren die Kontraste. Und deshalb hat man auch das Wort "Altar" völlig vermieden. Man hat "Altäre" eigentlich nur zu den Gabentischen gesagt, die an den Seiten aufgereiht waren - in der Laterankirche in Rom waren sieben silberne Gabentische, auf denen zu Beginn der großen Gabenprozession alles, was sie an Naturalgaben mitbrachten, abgelegt wurde. Und dann heißt es: Dann kam die Eröffnung, und der Bischof zog ein und die Mensa wurde aufgestellt …
Die Furche: … die war zu Beginn des Gottesdienstes noch gar nicht da?
Muck: Sie wurde bei manchen Gelegenheiten auch gar nicht gebraucht. Das sind doch eigenartige Befunde. Erst in der Renaissance und der Barockzeit ist es zu so ausführlichem Nachahmen alter Vorbilder von Tempelarchitektur gekommen. Und da wird auch der Begriff "Altar" völlig neu aus der Antike herübergeholt - freilich mit ganz neuer Bedeutung. Das sind Ausgangspunkte gewesen, wo ich mich frage, ob jetzt die Diskussion um den "Volksaltar" richtig geführt wird, wenn man dieses Wort verwendet, denn was heißt "im Volk"? Der Altar war in frühchristlicher Sicht in den Raum hineingestellt. Und war also selbstverständlich genauso wie der Bischofssitz umgeben vom Volk.
Die Furche: Kann man also sagen, die Liturgiereform des II. Vatikanums hat versucht, solches Raumverständnis wieder ins Heute zu bringen?
Muck: Dass es da ein Raumverständnis gibt, das habe auch ich in den ganzen Verhandlungen immer wieder eingebracht. Denn ich kam vom Anliegen des Raums her, weil die Kirche ja einer der wenigen Orte ist, wo man Raum erfahren kann, wo man noch sich bewegen, orientieren kann, wo man etwas spürt - mit allen Sinnen. Aber in der heutigen Situation, wo man mehr oder weniger von rein visueller Darstellung her informiert wird und die Kommunikation über die Bildschirme läuft, hat man ja diese Distanz- und Nähe-Erfahrung wie den Platzwechsel nicht mehr oder nur ausnahmsweise.
Die Furche: Sie beklagen große Erstarrung in der Kirchenraumgestaltung der letzten Jahrhunderte. Wenn Sie eine landläufige Kirche aus Barockzeit oder Klassizismus hernehmen: Die ermöglicht all diese Bewegungen ja gar nicht - da sitzt das Volk in Bänken festgezurrt, die Bewegung wird bestenfalls stellvertretend von Priester, Lektoren oder Ministranten gemacht.
Muck: Die Veränderung gegenüber dem frühchristlichen Befund in den Basiliken hat schon um 600 unter Gregor dem Großen begonnen, der erstmals anordnete, dass der Bereich der Mensa mit Schranken umgeben wird. Gregor der Große hat auch versucht, den Gottesdienst durch möglichst viele Klerusfunktionen, feierlich zu gestalten und die Anwesenden nach damaligen Vorstellungen dem Modell des Lakaienstandes zuzuordnen. Das ist eine sehr wichtige Veränderung gewesen. Dann kam in der weiteren Entwicklung - so wie wir die Kirchen bei uns kennen - der starke Einfluss des Staatskirchentums josephinischer Prägung dazu.
Die Furche: Und dieses aufgeklärt-absolutistische Kirchenverständnis hängt uns immer noch nach?
Muck: Man darf ja nicht vergessen, dass jede dieser Kirchen von Maria Theresia eingerichtet wurde, um verlässliche Durchsagestationen zu haben; sie hat deshalb den Priester als Verantwortlichen in den Beamtenstand erhoben … In josephinischer Zeit blickt alles zur Hoheit auf, zum Aussetzungsthron …
Die Furche: … für das Allerheiligste auf dem Hochaltar.
Muck: Das alles waren ja gute und willkommene Einübungen in das, was man von kaiserlicher Seite her vom Volk erwartete. Vorgeformt war das schon in einigen barocken Saalkirchen, aber dann wurde es richtig zur Staatsräson. Parallel war auch die Schule entsprechend auf den Lehrer hin organisiert - das war ja nicht das Schulsystem, wie wir es heute haben, sondern auch das war Ausrichtung. Das alles passte in dieses Konzept, das sogar die Formen vorgeschrieben hat - der Klassizismus war ja mit seinen die Säulen ersetzenden und Pfeilern oder Pfeilerimitationen eine völlig andere Einstellung, als es in der Barockzeit oder in den Traditionen des frühen Christentums der Fall war. Da wurde viel an Ausrichtung vorgeformt, die wir heute in den Kirchen sehen.
Die Furche: Diese Kirchen sahen ursprünglich nicht so aus wie heute.
Muck: Sie sind mehrfach umgebaut und verändert worden. Und gerade in josephinischer Zeit sind nicht nur neue Kirchengründungen entstanden, sondern auch alte entsprechend umgeformt worden - im Sinn dieser Ausrichtung. Und nun war das eine starke Reduktion anstelle eines zumindest in Motiven noch vorhandenen zentralen Verständnisses im Langhaus - wir haben ja in Wallfahrtskirchen oft noch die zentralen Wallfahrtsaltäre …
Die Furche: … beispielsweise in Mariazell …
Muck: … die Kuppeln und die Bodenmotive deuten noch darauf hin, hier ist das alles überspielt und verändert worden. Mir ist das aufgefallen in der Münchner Jesuitenkirche St. Michael, wo nach dem Konzil überlegt wurde, wo der Volksaltar hinkommen soll - und dann haben sie probiert und Bodenplatten abgehoben - und siehe, da kam das Fundament zutage, wo vor der klassizistischen Reform der Altarplatz war. Auf dem alten Fundament hat man dann den neuen Altar, die neue Mensa aufgebaut: Wir haben also den alten frontalen Altar, auf den alles gerichtet war. Optisch ist es nach wie vor diese Retabel-Situation da …
Die Furche: … der "Hochaltar" mit dem hohen Altarbild …
Muck: … und davor dieses Sims, das der letzte Rest von dem alten Tisch war, an dem die Zelebration stattgefunden hat. Und jetzt steht da ein vorgezogener weiter Altartisch - und nun kommt die Frage: Was ist eigentlich das Wichtige? Natürlich hat man diese Situation nun als eine unsichere empfunden: Wohin soll ich mich wenden? Hier kommt etwas anderes mit zum Vorschein, nämlich, dass uns nicht mehr in der Tradition zugänglich war, dass viele Schwerpunkte im Raum waren, zwischen denen der Gottesdienst gewechselt hat. Gottesdienst war ein Vorgang zwischen verschiedenen Orten. Schon in frühchristlicher Zeit war der Platz des Bischofs zum Sprechen, zur Wortverkündigung in der dann angebauten Apsis, weil - so die Erfahrungen der Rhetorenschulen, die für die Kirchen übernommen wurden - diese Apsis die beste Sprechmöglichkeit war.
Die Furche: Die Apsis wurde also aus akustischen Gründen gebaut?
Muck: Ja. Vom Kirchenvater Chrysostomus aus dem 4. Jahrhundert heißt es, dass er dort von der Gemeinde bedrängt wurde - man sieht, da waren keine Schranken -, der Bischof ging dann in den Raum hinein. Der Tisch, die Mensa, war nach den schon erwähnten Darbringungstischen ein weiterer Ort, und ein Teil der Vorgänge fand überhaupt im Vorbereich der Kirche statt - was etwa als Statio bei der Neuordnung der Feier der Osternacht nach dem Konzil wieder ein bisschen zur Sicht kam …
Die Furche: … beim Osterfeuer und bei der Weihe der Osterkerze vor der Kirche.
Muck: Das waren also mehrere Orte. In der josephinischen Zeit wurde auch der in der Gotik seitlich vorhandene Tabernakel, der ja ein Wandtabernakel war oder in einem kleinen Tabernakelhäuschen seitlich stand, auf einmal in diesen Aufbau zusammen mit dem Aussetzungsthron integriert. Der Liturgiker und Konzilstheologe Josef Andreas Jungmann hat dazu bei den Konzilsvorbereitungen gesagt: Das war eine unerhörte Kumulierung des Nach-vorne-Zwingens, man hat alles an einem Ort kumuliert. Jungmanns Motto war daher, wieder alles an seinen Ort zu bringen - den Ort des Sprechens, der Verkündigung usw. Für den Tabernakel wurde ja schon von Pius XII. in der Enzyklika Mystici Corporis das Bild gebracht, dass Altar und Tabernakel so etwas sind wie Haupt und Herz des Leibes. Da hat Pius XII. also schon rein vom Organismus her …
Die Furche: …verschiedene Orte…
Muck: …insinuiert - und natürlich aus seiner Kenntnis aus der Zwischenkriegszeit, als er als Eugenio Pacelli Nuntius in Deutschland war, dort schon die liturgische Erneuerungsbewegung kennengelernt hat und dort auch feststellte, wie in alten Chorkirchen der Sängerchor von rückwärts wieder in die Nähe der Mensa gerückt wurde. Ich bin auf diese Dinge gestoßen, weil es mich in meiner Tätigkeit beschäftigt hat, wieso denn um 1930 ein Clemens Holzmeister in Berlin die Hedwigskathedrale gebaut hat mit einer eigenen Tabernakelkapelle, mit einer zentralen Mensa, mit einer Versammlung darum herum und auch bei anderen Kirchen die Auseinanderlegung der Orte - den "Tisch des Wortes" und den "Tisch des Brotes" und den Tabernakelort als eine Art szenischer Auseinanderlegung im Sinn der Simultanbühne schon gemacht hat.
Die Furche: Sie haben im Vorfeld des Konzils und danach viel über Kirchenbau gearbeitet und versucht, die Umsetzungen der Liturgiereform beim Kirchenbau in vielfältiger Weise zu begleiten: Wie empfinden Sie die diesbezügliche Situation heute?
Muck: Es hat sich der Ansatz nur deshalb zögernd durchgesetzt, weil wir ja so viele alte Kirchen haben, und die Grundfrage war jetzt: Wie man neue Kirchen baut, da haben wir jetzt ein paar Vorstellungen, aber was machen wir mit den alten? Und die Frage der Neuordnung alter Kirche war etwas ganz Entscheidendes - und war schwierig - denn da ist das Denkmalamt sofort aufgestanden.
Die Furche: Von derartigen Konflikten hört man ja auch heute.
Muck: Ich habe allerdings das Glück gehabt, einen ganz erfahrenen Präsidenten des Bundesdenkmalamtes zu haben, der praktisch mit mir einen Modus eingeführt hat: Machen wir keine generellen Weisungen, sondern untersuchen wir von Fall zu Fall. Und da war jetzt der große Wunsch: Vorgezogener Altar ja, aber wir können ihn von der Denkmalpflege nicht als definitiv genehmigen, wenn er aber mobil, umstellbar oder demontierbar ist, genehmigen wir ihn als Provisorium. So entstand diese Vorläufigkeit. Und ich muss sagen, es ist vielleicht das Hoffnungsvollste, dass man da in eine Situation der Vorläufigkeit gekommen ist, inzwischen sind viele Dinge dieser Neuerungen monumentalisiert worden und kunstvoll definitiv gemacht worden - und sind doch nur neue Barrieren, weil etwa die Stuhlordnung in der Kirche nicht verändert wurde.
Die Furche: Sie machen also aus der Not des Provisoriums eine Tugend?
Muck: Dieses Erwartungsvolle, Vorläufige und Provisorische an dieser ganzen Neuordnung ist nicht etwas, was vom Denkmalpfleger, sondern von den Liturgikern und Theologen den Künstlern gesagt wird: Fixiert das nicht zu früh. Denn das Konzil hat etwas begonnen, aber durchgereift ist es ja noch nicht, weil die zugehörigen Vorgänge zu diesen Ordnungen nur sehr vereinzelt gelingen.
Die Furche: Jetzt hat man also den Hochaltar stehen lassen und etwas Mobiles davor angebracht: Kann man da aber nicht - wie in St. Rochus - sagen: Räumen wir das ganze Vorläufige weg und nehmen wir den Hochaltar wieder, der ist ja doch das Ursprüngliche?
Muck: Das kann man nicht verhindern. Wie lange ist es seit dem Konzil her? 45 Jahre. Die Renaissance hat 30 Jahre gedauert - dann kam der Sacco di Roma und dann der Manierismus. Also: 45 Jahre sind ja schon eine gewaltige Epoche! Es ist nicht ausgeschlossen, dass solche Perioden wiederkehren. Aber die Voraussetzungen, die damals waren, sind jetzt nicht mehr gegeben: Es war begleitend zum Konzil eine große Bildungstätigkeit in den Diözesen und Pfarren da, man hat viel Wert darauf gelegt, das alles auch zu kommunizieren. Durch die totale Blockierung mit dem Fernsehabendprogramm ist das, was da möglich war, wieder weggefallen.
Die Furche: Aber es krankt doch nicht nur an der Fernsehsucht der Katholiken?
Muck: Ich spitze etwas zu: In der Predigt, in den Interpretationen findet die mystagogischen Einführung oder liturgische Bildung nicht statt. Die Theologen sind nicht darauf vorbereitet, dass sie das erst bringen müssten - und können es auch zum Teil gar nicht, was früher in der Auseinandersetzung mit dem Konzil ständig publik war. Wenn jetzt noch dazu die Priester so wenige sind und jeder so viele Pfarren betreuen muss, dann kann sich niemand mehr in dieser Richtung spezialisieren. Die pastorale Praxis der Kirche ist heute enorm weit weg von der Theologie, die einen seltenen Hochstand an Bibelwissenschaft usw. erreicht.
Die Furche: Zur Zeit scheint es mehr und mehr Leute zu geben, die starre Riten wie es der vorkonziliaren tridentinischen Messritus wieder haben wollen, die sagen: Das war ja doch das Eigentliche.
Muck: Gott sei Dank bewegen wir uns in Richtung dessen, was Kardinal König mit "Einheit in der Vielfalt" genannt hat. Diese Vereinheitlichung seit dem Tridentinum war ja tödlich und provozierte das Gegenteil. Lasst doch die Leute in St. Rochus das machen! Warum nicht? Selbstverständlich gibt es diese Auffassung, und es gibt Kirchen, in denen man das machen kann. Ich sehe das als eine notwendige Vielseitigkeit. Das Schlimme ist bloß, dass diejenigen, die die liturgische Bewegung weiterführen, gestoppt werden, während den Anhängern der tridentinische Ritus erlaubt wird.
Das Gespräch führte Otto Friedrich.