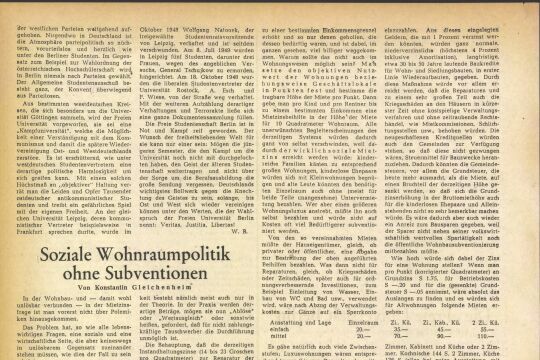Beachtliche acht Prozent des Bruttoinlandsprodukts geben die Österreicher im Jahr für ihre Gesundheit aus. Lange Zeit hindurch war dieser Sektor eine Wachstumsbranche. Maastricht-Kriterien und in deren Gefolge Sparbudgets haben den Zuwachs gedämpft. Das spüren auch die 325 Krankenanstalten, die es in Österreich gibt. Der Großteil der medizinischen Leistungen wird in den 155 sogenannten Fonds-Krankenanstalten erbracht, also in Spitälern mit Öffentlichkeitscharakter, die im Dienst der allgemeinen Gesundheitsversorgung der Bevölkerung stehen. Jeder Sozialversicherte wird in diesen Krankenhäusern "kostenlos" behandelt.
Von den 129 Privatspitälern fallen 31 - alle von Orden betrieben - in diese Kategorie. Ihre Bedeutung ist länderweise verschieden. Am höchsten ist er in Oberösterreich und im Burgenland, wo 38 beziehungsweise 30 Prozent der Spitalsbetten in Ordenskrankenhäusern stehen. In Wien werden 15 Prozent der Patienten in den acht Ordensspitälern der Stadt behandelt.
Diesen gemeinnützigen, also nicht auf Gewinn ausgerichteten Einrichtungen kommt also eine durchaus bedeutende Rolle im Gesundheitssystem zu. Das betont auch der für das Gesundheitswesen zuständige Sektionschef im Sozialministerium Harald Gaugg: "Die Ordensspitäler haben für uns einen hohen Stellenwert."
Haben sie deswegen ein leichtes Leben? Keineswegs, vor allem wenn es um die Finanzen geht. Zwar gibt es seit 1997 ein System der leistungsorientierten Krankenhausfinanzierung (LKF), dieses bewertet jedoch die Leistungen der Spitäler sehr unterschiedlich. Und die Ordenskrankenhäuser steigen dabei schlecht aus.
Wolfgang Huber, Geschäftsführer der Krankenhäuser der Barmherzigen Schwestern in Wien, Linz und Ried, kennzeichnet die Situation folgendermaßen: "Was wir jetzt haben, ist kein leistungsgerechtes Finanzierungssystem. Es gibt ein österreichisches Kuriosum: Jemand muß für eine Leistung, die die öffentliche Hand will, noch etwas zahlen."
Wie kommt es dazu? Die Ordenskrankenhäuser bekommen für dieselbe Leistung (sie wird in LKF-Punkten ausgedrückt), also etwa für eine Blinddarmoperation, einfach weniger Vergütung. In Wien beispielsweise ergibt sich im Durchschnitt zu den übrigen Spitälern (ohne das hochtechnisierte AKH) ein Minus von mehr als ein Drittel. Dazu Pater Leonhard Gregotsch, Generalsekretär der Superiorenkonferenz: "Bei uns ist zwei und zwei nur drei, während es sich für die Gemeindespitäler auf sechs addiert."
Die Folge: Die Mittel, die durch Leistungsentgelt (die LKF-Punkte) hereingespielt werden, decken nur rund 60 Prozent des Aufwandes. Daher entsteht ein Betriebsabgang. Zwangsläufig. Aber wie wird dieser gedeckt? In Wien beispielsweise vereinbarten die Ordensspitäler mit der Gemeinde, daß das so entstandene Defizit durch eine Subvention abgegolten wird. "Aber nicht in voller Höhe," hält Huber fest, "sondern nur zu 96 Prozent. Man bewertet also die Leistung zu niedrig, produziert damit Verluste, die man strafweise nicht zur Gänze abdeckt. Beim orthopädischen Spital in Speising reißt dieses System eine Lücke von 20 Millionen. Ein versorgungsrelevantes Krankenhaus wohlgemerkt! Wo man ein Jahr auf eine Operation warten muß!"
Mehrere Gründe werden für diese mißliche Lage ins Treffen geführt, vor allem das Spannungsverhältnis zwischen öffentlichen und privaten Spitälern. Auf die Frage, ob es zwischen ihnen Konkurrenz gebe, antwortet Gaugg zwar mit einem klaren Nein. Schwester Josefa Michelitsch, Generalprokuratorin der Barmherzigen Schwestern, aber sieht das anders: "Wir stehen in Konkurrenz zu den Landesspitälern. Das Grundübel ist, daß die für das Gesundheitswesen zuständigen Landesräte auch Interessenvertreter der Landesspitäler sind."
In einer Zeit, in der es zu viele Spitalsbetten gibt, wird das zur Bedrohung für die Ordenskrankenhäuser. Pater Gregotsch sieht das nüchtern: "Dem Land ist eben das Hemd näher als der Rock. Wenn es heißt, es gibt zu viele Betten und Einsparungen sind notwendig, so wird man zunächst die Ordensspitäler im Auge haben."
An der mangelnden Leistungsfähigkeit der Privaten liegt deren Unterbewertung jedenfalls nicht. Befragungen über die Zufriedenheit der Patienten mit der medizinischen Versorgung in Wien zeigen, daß die Ordenskrankenhäuser ebenso gut abschneiden wie die Gemeindespitäler. Auch was ihre Wirtschaftlichkeit anbelangt, herrscht Konsens: "Es ist keine Frage: Ordensspitäler haben in Österreich immer sehr, sehr gut gewirtschaftet," hält Sektionschef Gaugg fest, "was nicht heißt, daß die anderen schlecht gewirtschaftet haben."
In diesen Fragenkreis spielten auch ideologische Fragen hinein, ist Huber überzeugt: "Hinten und vorne wird privatisiert, nur nicht im Gesundheitswesen. Hier sind die Pfründen der Landespolitiker in Gefahr. Es ist eine der letzten Spielwiesen, auch ideologiemäßig. Der Landesrat für Gesundheit und Soziales ist meist der ideologische Parkplatz für Ewiggestrige. Die Finanzpolitiker lieben die Ordensspitäler. Die Gesundheitspolitiker lehnen uns ab."
Etwas ist wohl an dieser Argumentation dran, wenn man hört, daß in Linz der Bau einer Frauenklinik mit 100 Betten um 400 Millionen Schilling geplant ist, gleichzeitig aber aufgrund des Krankenanstaltenplanes 130 Betten in den Ordensspitäler abgebaut werden müssen. Dabei haben letztere ein Konzept vorgelegt, die Leistungen der geplanten Frauenklinik zu übernehmen.
Fairerweise muß gesagt werden, daß nicht alle Ordenskrankenhäuser demselben Druck ausgesetzt sind. Die beiden Spitäler in Tirol und im Burgenland (Zams und Eisenstadt) stehen für die regionale Versorgung praktisch ebenso konkurrenzlos da wie das Krankenhaus in Schwarzach-St. Veit. Ihre Kosten werden vollständig gedeckt, und in Schwarzach wurde zuletzt sogar um 1,1 Milliarden Schilling ein neues Krankenhaus gebaut.
Welche Zukunftsperspektiven ergibt das für die Ordensspitäler? Eine dramatisch schlechte, wenn es zu keiner Änderung bei der Finanzierung kommt, meint Huber. Chancen sieht Gregotsch bei einer stärkeren Ausrichtung auf neue Tätigkeitsfelder, insbesondere auf die Akutgeriatrie und die Remobilisation: "Da werden Patienten nach Schlaganfällen oder Herzinfarkten so rasch wie möglich für das tägliche Leben tauglich gemacht. Die Orden haben die Absicht, sich in diese Richtung zu entwickeln." Ein Aufgabenbereich, für den auch Gaugg den Orden eine besondere Rolle zuordnet. Fraglich ist allerdings, ob die stark von der Tradition bestimmten privaten Einrichtungen diese Neuausrichtung schaffen werden.
Einiges geschieht allerdings schon in diese Richtung, wie Huber betont, obwohl auch in diesem Sektor die Finanzierungsfrage offen ist: "Es ist wichtig, daß wir als Katholiken Zeichen der effektiven Liebe setzen. Das versuchen die Barmherzigen Schwestern auch: In Ried wurde ein Hospiz aufgemacht. Eines wird in Linz gebaut. Wir haben außerdem eine Psychosomatik-Station und die Barmherzigen Brüder ihre Armenambulanz. Diese Dienste kommen wirklich an."
Zum Dossier Ein rasanter medizinischer Fortschritt, eine immer aufwendigere medizinische Technik, stark steigende Anforderungen an den Standard von Krankenhäusern prägen die Entwicklung auf dem Spitalssektor. Können private Anstalten da überhaupt mithalten? Und: Welcher Stellenwert kommt in diesem von öffentlichen Einrichtungen beherrschten Sektor den Privatspitälern zu?
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!