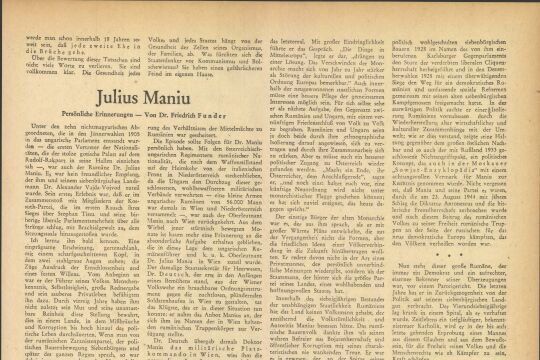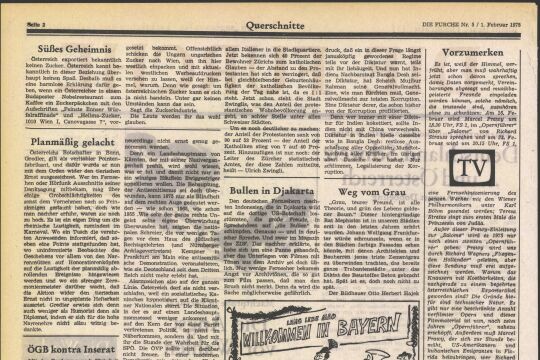Nach dem Mord an Ex-Premier Hariri und dem Abzug der Syrer wählt der Libanon in einer vier Wochen dauernden Wahl ein neues Parlament. Kaum sonstwo auf der Welt spielt die Konfessionszugehörigkeit eine so große politische und gesellschaftliche Rolle wie hier.
Wochenlang stand vor der kleinen protestantischen Kirche im Zentrum Beiruts, nur einen Katzensprung vom prächtigen, aus der Osmanenzeit stammenden und heute als Regierungssitz dienendem Serail gelegen, ein riesiges Transparent. Es wurde von einem großen, stämmigen Mann dominiert, der freundlich, aber entschlossen den Blick in die Ferne richtete. Den Hintergrund bildeten die libanesische Fahne, den Vordergrund der Schriftzug: "Ein Märtyrer für den Libanon."
Märtyrer werden im Libanon erfahrungsgemäß schnell ausgerufen. Die Geschichte jenes Mannes mit dem schmalen Oberlippenbärtchen und korrektem Scheitel ist allerdings symbolträchtig für die jüngste Geschichte des Zedernstaates: Bei Basil Fuleihan handelt es sich nämlich um den langjährigen Wirtschaftsminister und einzigen protestantischen Politiker von Rang. Als enger Vertrauter saß er am 14. Februar im Auto des ehemaligen Ministerpräsidenten Rafik Hariri, auf dessen Konvoi ein Sprengstoffanschlag verübt wurde. Die 1000-Kilo-Bombe töte Hariri. Fuleihan überlebte und wurde mit schwersten Verbrennungen in ein Pariser Spezialkrankenhaus gebracht. Dort starb er im April an den Folgen des Attentats. In einem vom Fernsehen weit über dir Grenzen des Landes übertragenen Trauergottesdienst stellte der leitende Pfarrer der Nationalen Evangelischen Kirche im Libanon, Habib Badr - auch mit Blick auf den Muslim Hariri - die Frage, die die politische Stimmung auf den Punkt brachte: "Wie viele Märtyrer braucht der Libanon noch, um endlich den Weg der Versöhnung zu beschreiten?"
Weiter gespaltenes Land
Zwar hat der Mord an dem wegen seiner Verdienste um den Wiederaufbau des Landes geschätzten und über Religionsgrenzen verehrten Hariri zu einer kaum für möglich gehaltenen nationalen Einheit geführt. Der Leiter des katholischen Informationszentrums in Beirut, Pater Joseph Mouannes, spricht gar von einem "Wunder". Millionen Menschen demonstrierten in der selbsternannten "Intifada der Unabhängigkeit" erfolgreich für den Abzug der syrischen Militärmacht. Ihnen schreiben die meisten Libanesen den noch unaufgeklärten Mord an Hariri zu. Doch die Euphorie des Beiruter Frühlings kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Libanon noch immer ein gespaltenes Land ist, das mit den Folgen des Bürgerkrieges (1975-90) zu kämpfen hat. Damals rangen - mit wechselnden Koalitionspartnern - Christen und Muslime um die Vorherrschaft im über Jahrhunderte mehrheitlich christlich geprägten levantinischen Staat. Es ging nicht um Religion, die allerdings politische und militärische Gruppenidentitäten erzeugte. Am Ende des Bürgerkriegs unterlagen die zeitweilig mit Israel verbündeten Christen gegen die von Syrien und der iranisch finanzierten Hisbollah unterstützten Muslime.
Bei Verhandlungen in der saudi-arabischen Stadt Taif einigten sich die Konfliktparteien auf eine konfessionelle Aufteilung der Macht, wie sie im Libanon bereits seit dem 19. Jahrhundert üblich war. Staatspräsident und Generalstabschef sind seither Christen, der Ministerpräsident ein Sunnit, der Parlamentspräsident ein Schiit. Nach dem Wahlgesetz von 1995 wird auch das 128-köpfige Parlament nach Religionsproporz besetzt. Die größte christliche Kirche, die mit Rom unierten Maroniten, stellt 34 Abgeordnete. 14 Parlamentarier sind griechisch-orthodox, 8 griechisch-katholisch, 5 armenisch. Auf muslimischer Seite werden 27 Sunniten, 27 Schiiten und 8 Drusen gewählt. Die Christen haben also im Parlament eine knappe Mehrheit, was gleichwohl Koalitionen unumgänglich macht.
Ohne Zweifel hat das konfessionelle System zur Befriedung des Landes beigetragen. Unumstritten ist es allerdings nicht. Das hat mit demografischen Veränderungen zu tun. Gingen die Verhandlungspartner in Taif noch davon aus, dass sich das Land zu jeweils 50 Prozent aus Christen und Muslimen zusammensetzte, ist der Bevölkerungsanteil der Christen im Laufe der letzten 15 Jahre auf etwa 37 Prozent zurückgegangen. Von muslimischer Seite wird deshalb eine Reform des konfessionellen Systems und ein demokratisches Wahlrecht gefordert, das die realen Stimmenverhältnisse wiederspiegelt.
Veränderungen müssten mit dem Ende von klassischen Stereotypen beginnen, fordert AbdelRaouf Sinno, Geschichtsprofessor an Beiruts Libanesischer Universität. Während die Christen dächten, sie hätten den Libanon gegründet, träumten die Araber noch immer von einem großarabischen Reich im gesamten Nahen Osten, so der moderate Sunnit. Früher galten die Christen als die Kritiker und die Muslime als die Verbündeten Syriens. Seit der Ermordung Hariris herrsche ein anderes Grundgefühl: "Am 14. März sind in unserem Land mit knapp vier Millionen Einwohnern anderthalb Millionen Menschen beider Religionen auf die Straße gegangen und haben für die Unabhängigkeit des Libanon demonstriert. Genau das brauchen wir in Zukunft: ein gemeinsames Nationalbewusstsein und nicht einen christlich-muslimischen Gegensatz."
Keine "religiöse" Demokratie
Eine moderne Demokratie dürfe Macht nicht nach religiösen Kriterien aufteilen, meint der in Berlin promovierte Wissenschaftler. Er setzt sich für eine Reform des Konfessionalismus ein, hält aber nur eine Politik der kleinen Schritte für sinnvoll. Dagegen fordert etwa die prosyrische Hisbollah eine völlige und zügige Veränderung, damit sich die demografischen Verhältnisse auch im parlamentarischen Prozess niederschlagen.
Für Sinno, der sich mit kritischen Zeitungskommentaren auch in die Tagespolitik einmischt, hängt mit dem Konfessionalismus ein grundsätzliches Problem der libanesischen Innenpolitik zusammen: Die religiös ausgerichteten Parteien würden subkutan weiter die Gegensätze des Bürgerkriegs kultivieren. Deshalb besitze der Libanon "im Grunde keine modernen Volksparteien, die mehr als nur Klientelpolitik betreiben".
Einer Veränderung des Konfessionalismus stehen nicht aber nur macht-, sondern auch gesellschaftspolitische Interessen entgegen. Bis heute werden nämlich alle Personenstandsangelegenheiten von der Wiege bis zur Bahre von den Religionsgemeinschaften geregelt. An der doppelten Dimension des Konfessionalismus sind bisher Reformen stets gescheitert, so Georges Nassif, der Kommunikationsdirektor des Middle Eastern Council of Churches: "Wir Christen sind ja für Veränderungen. Wir fordern schon lange die Umsetzung eines säkularen Systems und die Einführung der Zivilehe. Aber die Muslime wollen das nicht." Der griechisch-orthodoxe Christ kritisiert, die Muslime würden nur auf die Veränderungen im politischen Teil des Konfessionalismus schauen, täten sich aber mit einer Säkularisierung des gesamten staatlichen Systems schwer. Doch auch Nassif bezweifelt die Zukunftsfähigkeit des gegenwärtigen Systems. Allerdings rechnet er damit, dass Veränderungen noch 25 bis 30 Jahre benötigen.
Wie Sinno sieht auch Nassif in der Veränderung der politischen Kultur eine Generationenfrage: "Eine jüngere Generation von Christen und Muslimen wird sich vielleicht mit einem Umbau des Gesamtsystems leichter tun als die gegenwärtigen Eliten."
Geschichte nicht gemeinsam
Für Nassif müssen die Reformen unten und zunächst im Bildungssystem beginnen, das von konfessionell geprägten Schulen dominiert wird: "Wenn wir ehrlich sind: Es ist doch keine Frage des Glaubens, wie man die Schulen organisiert. Wir haben viele griechisch-orthodoxe Schulen, die zu 90 Prozent von muslimischen Schülern besucht werden. Auch Universitäten müssen nicht konfessionell organisiert sein." Nassif kritisiert, dass die Religionsgruppen ihre eigenen Lehrpläne entwickelten, ohne dass die staatliche Schulaufsicht Einfluss nehmen konnte. Die Hisbollah etwa habe Schulen, die der Kontrolle der Regierung völlig entzogen seien. Die christlichen Schulen würden sich dagegen an die staatlichen Vorgaben halten. Nassif weiß allerdings, wie schwierig Reformen sind: Vor ein paar Jahren habe es eine landesweite Schulbuchreform gegeben. Alles lief reibungslos - bis die Geschichtsbücher zur Debatte standen. Die ehemaligen Gegner konnten sich nicht auf eine einheitlich Deutung des Bürgerkrieges einigen. Bis heute gibt es daher keine gemeinsamen Geschichtsbücher.
Nach den Schulen würde Nassif die Verwaltung umgestalten, wo selbst Abteilungsleiter in den kleinsten Rathäusern nach Religionsproporz besetzt werden. Dann sollte man bei Armee und Regierung weitermachen. Der letzte Reform-Schritt wären dann das Parlament und die konfessionelle Aufteilung der höchsten Staatsämter. Eine Änderung des Konfessionalismus lehnt dagegen die katholische Kirche - nicht zuletzt aus Machterhalt - kategorisch ab: "Wir haben jetzt das beste politische System der Welt. Alles andere wäre eine Form brutaler Demokratie", ereifert sich Pater Mouannes. "Der Libanon ist ein Treffpunkt der Menschen unterschiedlicher Herkunft. Dabei soll es auch bleiben. Wir sollten uns gemeinsam daran machen, das Land wiederaufzubauen und für Versöhnung einzutreten." Ob dieser Wunsch ohne politische Reformen in Erfüllung gehen kann, scheint zweifelhaft: Auch der Frühling der Unabhängigkeit heilt nicht auf einen Schlag alle Wunden.
Der Autor ist evangelischer Theologe und freier Journalist.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!