
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Möglichst viel Freiraum für den Patienten
Ein Krankenhausaufenthalt ist für die meisten Menschen eine unwillkommene Unterbrechung ihres gewohnten Lebensrhyth-muses, eine erzwungene Pause.
Der eigene Körper hat auf die eine oder andere Weise plötzlich seinen Dienst versagt und man ist nun angewiesen auf fremde Hilfe, auf Schwestern, Arzte und nicht zuletzt auf einen hochtechnisierten Krankenhausapparat. So mancher bekommt in dieser Situation den Eindruck, nur mehr ein Fall oder eine Nummer zu sein. Dem will man in den 34 katholischen Ordensspitälern, die es in Österreich gibt, bewußt entgegenwirken. Hier dürfen sich die Patienten neben der bestmöglichen medizinischen und pflegerischen Betreuung auch im schwierigen Umgang mit Schmerz, Leid und Ängsten Unterstützung erwarten.
Diese humane Einstellung, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt, sehen die Ordensspitäler als ihr besonderes Markenzeichen an. Neben den auch in den meisten öffentlichen Krankenhäusern vorhandenen spirituellen Angeboten wie Gottesdienst und Krankenhausseisorge, bemüht man sich in den Ordenspitälern auch, den einzelnen Kranken einen möglichst hohen persönlichen Spielraum zu erhalten: Die meisten Patienten verfügen über ein Telefon auf dem Zimmer, Angehörige können in besonderen Situationen im Spital übernachten, die Besuchszeiten sind in der Regel recht flexibel.
Doch am meisten trägt noch immer die freundliche Krankenschwester oder die Ärztin, die sich Zeit nimmt, bei, daß sich die Patienten wohl fühlen. „Bei uns zählt der Patient als Person, nicht nur. die Diagnose"' bringt es Stationsschwester Gabriele Astner, die im Krankenhaus der barmherzigen Brüder in Wien arbeitet, auf den Punkt. Das einfache „gut sein" koste auch kaum Zeit, ergänzt der Krankenhausvorstand und Prior der Barmherzigen Brüder Paulus Kohler, das wichtigste sei die innere Einstellung, ob man seinen Beruf als Berufung ansehe, oder einfach als Job. „Höflich und freundlich kann jeder sein, ein Lächeln , ein gutes Wort kostet nichts, aber wenn man das, was man macht, mit Liebe tut, spüren das die Patienten und fühlen sich wohl."
Das Spital der Barmherzigen Brüder in der Leopoldstadt ist das älteste' Krankenhaus Wiens. 1614 vom Barmherzigen Bruder und Chirurgen Ffater Gabriel Graf Ferrara als kleines Spital mit 12 Betten gegründet, ist es heute ein modernes Krankenhaus mit schwerpunktmäßiger Versorgung. Ende Oktober wurde mit finanzieller Unterstützung der Stadt Wien ein neugebauter Trakt der K Ii nik eröffnet.
Moderne Architektur und fröhliche Farben haben die langen weißen Gänge abgelöst. In den acht Abteilungen, darunter eine Herzstation, eine Nuklearmedizinische und eine Gynnäko-logische Abteilung, werden über 14.000 Menschen jährlich behandelt - nicht nur elitäre Privatpatienten, sondern auch ganz normale Krankenkassenpatienten. „Zu uns kommen Menschen aus allen Gesellschaftsschichten, arme, reiche, junge, alte", erklärt Prior Kohler. . „Wie unser Ordensgründer Johannes von Gott machen wir keinen Unterschied zwischen Menschen verschiedener Weltanschauung, Herkunft und Religion."
Bekehren will man im Krankenhaus niemanden, hält auch der Kami-lianerpater und Leiter der Arbeitsgemeinschaft Österreichischer Ordensspitäler Leonhard Gregotsch fest: „Wie jedes Spital sind wir ein Dienstleistungsbetrieb und wollen der Not der Menschen begegnen. Wir pflegen die Menschen nicht unter dem Gesichtspunkt der Bekehrung, sondern unter dem Aspekt der menschlichen Würde und der zu lindernden Not." Nicht missionarisch wolle man wirken, sondern durch die Arbeit Zeugnis ablegen für die Liebe Gottes zu den Menschen.
Unentgeltlich betreut
Obwohl mittlerweile viele der Krankenhausangestellten gar keine bekennenden Katholiken sind, sorgt sich die Theologin Ursula Hamachers, die ihre Diplomarbeit über die Spiritualität der katholischen Krankenhäuser geschrieben hat, nicht darüber, daß den Ordensspitälern das Christliche verlorengehen könnte: „Man sollte von den Mitarbeitern den Glauben nicht als Vorleistung erwarten, sondern alle, die im Krankenhaus zum Wohl der Menschen arbeiten wollen, zeichnen sich dadurch schön als Freunde Gottes aus."
An Johannes von Gott, der im 16. Jahrhundert in Granada ein Spital gründete, das er durch Betteln finanzierte, orientiert man sich bei den Barmherzigen Brüdern noch heute im Hinblick auf das besondere Engagement für die Armen und Bedürftigen. 60.000 Patienten werden jährlich unentgeltlich in der Armenambulanz betreut und den einen oder anderen nimmt man auch stationär auf. „Natürlich versuchen wir, wenn jemand keine Krankenversicherung hat, daß er wenn möglich auch selbst einen Beitrag leistet. Hat jemand aber nicht, ist seine Wohnadresse unter der Brücke was soll's ?", meint Prior Kohler.
Manchmal würden die Barmherzi gen Brüder gerne noch mehr tun, sich auch für Obdachlose, für Aidskranke, für alte Menschen und Behinderte einsetzen, doch da wird der Mangel an Ordensnachwuchs schmerzlich spürbar. Dieser ist neben den Finanzen das Hauptproblem der Ordenspitäler. Unter den 534 Mitarbeitern des Spitals der Barmherzigen Brüder in Wien, sind nur mehr fünf Brüder. Es sei halt nicht immer leicht, die Kontemplation, die sich viele beim Eintritt in einen Orden erhoffen, mit der Leitung eines Spitals in Einklang zu bringen, weiß auch Prior Kohler, „daß man da nicht persönlich ins Schleudern kommt".
Früher habe er sich das Ordensleben auch anders vorgestellt, aber heute könne er sich nichts Schöneres vorstellen, als auf diese Weise für die Menschen dazusein. Trotzdem blickt Kohler optimistisch in die Zukunft der Ordenspitäler: „Kommt Zeit, kommt Rat" - und vielleicht eines Tages auch wieder mehr Ordensnachwuchs. „Rein rechnerisch, statistisch müßte ich verzweifeln, aber der 1 Ier-gott ist ja auch noch da und der hat uns gern, sonst wären solche Dinge wie der Bau des neuen Traktes nie gelungen."
Neben dem Hergott hofft man in den Ordenspitälern allerdings auch auf den Gutwill von Gesellschaft und Staat, für die man ja schließlich auch eine beachtliche Leistung erbringt: 17 Prozent der Leistungen im Gesundheitswesen werden zum Beispiel in Wien von den Ordensspitälern erbracht. Dafür spürt man auch von Seiten der Gemeinde Wien einen „Wandel in der Einstellung und in der Unterstützung", die den Spitälern zuteil wird, meint Pater Gregotsch: „Man will auf uns nicht mehr ver-J ziehten oder uns aushungern, außerdem würde das auch von der Bevölkerung kaum goutiert werden".
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!








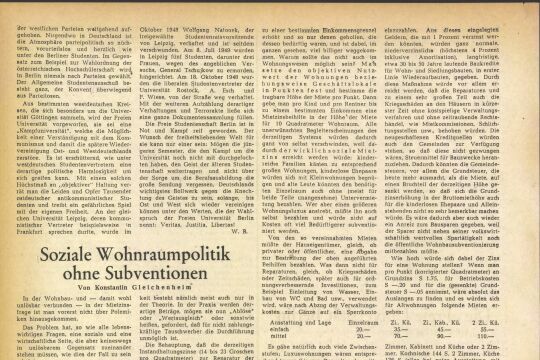


















































































.jpg)
