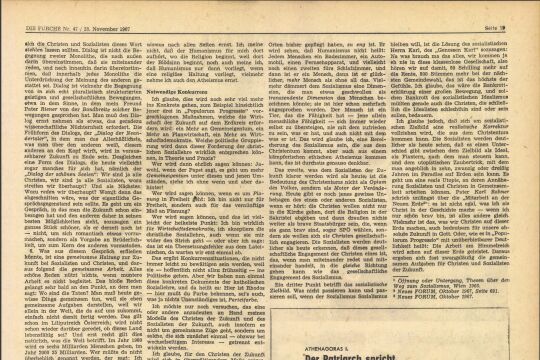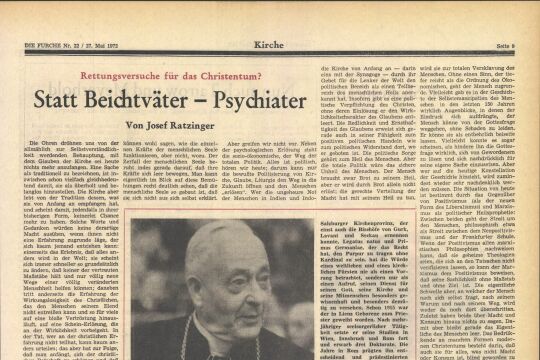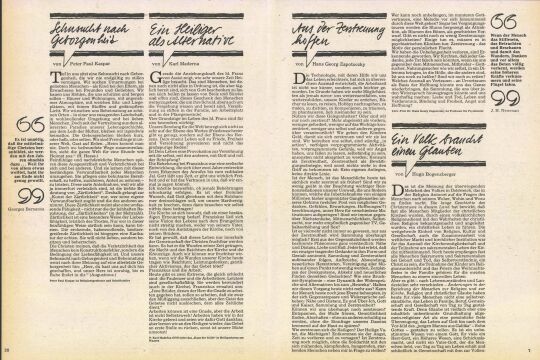Radikale Gegenwart: Über Theologie und eine verdunkelte Kirche
In seiner Abschiedsvorlesung machte der Grazer Pastoraltheologe und langjährige FURCHE-Kolumnist Rainer Bucher Anmerkungen zu den aktuellen Konstellationen der Theologie. Hier seine Rede im Wortlaut.
In seiner Abschiedsvorlesung machte der Grazer Pastoraltheologe und langjährige FURCHE-Kolumnist Rainer Bucher Anmerkungen zu den aktuellen Konstellationen der Theologie. Hier seine Rede im Wortlaut.
Als Christoph Schlingensief 2004 in Bayreuth den Parsifal in Szene setzte, war er nicht der erste, der Wagner radikal neu begriff. Schon andere vor ihm hatten Wagner seiner traditionalistischen Inszenierungsgeschichte entrissen und damit dem, was immer droht, wenn Jünger:innenmeinen, ein großes Erbe nur bewahren und verwalten zu dürfen: Kitsch, Konvention und Repression. Wir kennen das ja auch vom Christentum.

Liebe Leserin, lieber Leser,
diesen Text stellen wir Ihnen kostenlos zur Verfügung. Im FURCHE‐Navigator finden Sie tausende Artikel zu mehreren Jahrzehnten Zeitgeschichte. Neugierig? Am schnellsten kommen Sie hier zu Ihrem Abo – gratis oder gerne auch bezahlt.
Herzlichen Dank, Ihre Doris Helmberger‐Fleckl (Chefredakteurin)
diesen Text stellen wir Ihnen kostenlos zur Verfügung. Im FURCHE‐Navigator finden Sie tausende Artikel zu mehreren Jahrzehnten Zeitgeschichte. Neugierig? Am schnellsten kommen Sie hier zu Ihrem Abo – gratis oder gerne auch bezahlt.
Herzlichen Dank, Ihre Doris Helmberger‐Fleckl (Chefredakteurin)
Christoph Schlingensief freilich unterschied sich in einem von seinen Regietheater-Vorgängern: Er inszenierte in seinem Parsifal keine Oper zur Frage „Gibt es Erlösung für den Menschen und wenn ja, wovon und wie?“, sondern er hat die Frage „Gibt es Erlösung für den Menschen und wenn ja, wovon und wie?“ als Oper auf die Bühne gebracht. Das klingt ähnlich, ist aber ein Unterschied um fast alles.
Schlingensief ging es nicht um eine Oper, sondern um ein existentielles Problem: Was ist Erlösung, gibt es sie, wovon soll und will man überhaupt erlöst werden, womit darf man Frieden schließen und womit nicht und wie viel Gewalt enthält allein schon der Wunsch nach Erlösung in sich und entlässt er aus sich?
Schlingensief hat all diese Fragen mit existentieller Wucht auf die Bayreuther Bühne gebracht, ohne Rücksichten auf sich, auf die Konventionen der Form „Oper“ und ohne Rücksicht auch auf die Zuhörer:innen, denen er nicht erlaubte, genau das zu sein: distanzierte Zuhörer:innen. Damit war er natürlich wieder ganz nah bei Wagner.
Schlingensief hat jeden und jede im Zuschauerraum und auch mich damals schmerzhaft und unausweichlich vor die Frage gestellt: Wie hältst Du es mit Frieden, Tod und Erlösung? - ohne auch nur den Hauch einer Antwort zu geben.
In seiner Autobiographie schrieb Schlingensief später, er habe sich in Bayreuth den Krebs geholt. Er hat aber auch gesagt, jetzt könne er Richard Wagners Traum nachempfinden, "einen Ort zu finden, wo der eigene Wahn auch mal seinen Frieden findet."Das ist nicht unpathetisch und auch ein wenig verspielt. Vor allem aber markiert es die offene, unausweichliche, schmerzhaft-schöne Frage, um die es Schlingensief ging: Wie ist das mit Frieden, Tod und Erlösung?
Geht es der Theologie - mindestens - um Frieden, Tod und Erlösung? Oder um die akademische Verwaltung der Tradition? Es ist ihre Gewissensfrage.
Worum geht es der Theologie? Als offene, als unausweichliche, als schmerzhaft-schöne Frage? Geht es ihr - mindestens - um Frieden, Tod und Erlösung? Oder um die akademische Verwaltung der Tradition? Es ist die Gewissensfrage der Theologie.
Will man diese Frage nicht moralisierend behandeln, muss man sie mit Hans-Joachim Sander topologisch fassen: „Wo sind wir, die wir Theologie treiben, und in welchen Machtkonstellationen tun wir es?“ Es geht tatsächlich um den „Zusammenhang von Wissen, Raum und Macht“, wenn man sich jenem Problem nähern will, das sich mir am Ende meines professionellen akademischen Lebens als katholischer Theologe am drängendsten stellt: Geht es der Theologie um die akademische Form ihrer Themen oder um ihre Themen in akademischer Form? Nur letzteres hätte irgendeinen religiösen Sinn und existentielle Bedeutung.
Natürlich stellt sich diese Frage erst jenseits antiquarischer oder gar monumentalisch-triumphaler Traditionsverwaltung, und selbst noch jenseits kritischem, universitär-akademischem Habitus. Der erliegt zwar normalerweise nicht der Dummheit des Traditionalismus oder gar den Untaten der Repression, aber er macht doch recht schnell seinen Frieden mit der eigenen intellektuellen Selbstbehauptung und beruhigt sich zu früh in seinem Sieg gegen jene, die zu besiegen notwendig, aber nicht hinreichend ist.
Wo also treiben wir hier und heute Theologie? Einige Skizzen, unvollständig und rudimentär, aber sie bündeln meine Erfahrungen, Beobachtungen und Reflexionen der letzten Jahre, ja Jahrzehnte. Sie betreffen Gesellschaft, Universität und Kirche.
Gesellschaft
Mitten in einer europäischen Kriegskrise und in der Ungewissheit, wo wir uns in der Coronakrise und gar in der Klimakrise eigentlich genau befinden, verdichten und plausibilisieren sich zwei gesellschaftstheoretische Analysen. Eine findet sich etwa bei Eric Hobsbawn, Aleida Assmann und Hartmut Rosa, die andere bei Heinz Bude.
Eric Hobsbawn stellte schon 1995 fest, dass „die Vergangenheit … keine Rolle mehr spielt, weil die alten Karten und Pläne, die Menschen und Gesellschaften durch das Leben geleitet haben, nicht mehr der Landschaft entsprachen, durch die wir uns bewegten, und nicht mehr dem Meer, über das wir segelten.
Aleida Assmann schrieb schon 1997, dass wir in einer Epoche leben, „für die die Zukunft nicht mehr eine Dimension des Wünschens, Hoffens und Versprechens, sondern vornehmlich eine Dimension der Risikoberechnung und Kostenkalkulation geworden ist“, und für Hartmut Rosa lag bereits 2005 die „kulturelle Krisenerfahrung“ der Gegenwart „in dem gleichzeitigen Verlust einer referenzstiftenden Vergangenheit und einer sinnstiftenden Zukunft“.
Heinz Bude schließlich konstatierte als zentrale Erfahrung der Coronakrise die „Entdeckung der eigenen Verwundbarkeit“, „ein harter Schlag gegen den Narzissmus des Selbst“, denn „plötzlich scheinen wir alle solidaritätsbedürftig zu sein“, wo man doch so gern ein „starkes Selbst sein“ wolle, das sich seine Resilienz hart erarbeitet hat. Aber wir seien das eben nicht, ein starkes Selbst, sondern solidaritätsbedürftig, und wie diese Bedürftigkeit gestillt werden könne, ohne sich die Freiheit zu nehmen und die Luft zum Leben abzuschneiden, das sei ein zentrales Problem der Gegenwart.
Eine Welt, wo die alten Landkarten unbrauchbar geworden sind und wir nicht wissen, wohin die Reise führt, eine Lage, wo der starke Einzelne sich endgültig als Utopie erweist, die Verletzlichkeit des einzelnen, aber eben auch der Gesellschaften viel größer ist, als gedacht und die Balancen von Freiheit und Solidarität als lokal, regional und global ungelöstes Problem uns bedrängen: Was heißt es, an solch einem Ort und für ihn Theologie zu treiben?
Und das noch unter zwei erschwerenden Zusatzannahmen: Zum einen, dass all unsere gesellschaftstheoretischen Analysen der Wirklichkeit hinterherlaufen, weil die von uns in Gang gesetzten kulturellen und technologischen Entwicklungen hinter unserem Rücken eine unkontrollierbare Eigendynamik produzieren, die vor uns als Quelle unvorhergesehener, ja unvorhersehbarer Ereignisse wieder auftaucht.
Und zum anderen, dass es so etwas wie Kontext nicht wirklich gibt: Denn die „Bedingungen der Situation sind in der Situation enthalten.“ Wir analysieren unseren Ort also nicht von außen, wir stehen auf ihm, er durchdringt uns, ja, wir sind dieser Ort.
Das Waterloo der Theologie ist das Leben, nicht so sehr das Denken.
Wir stehen wirklich an der Schwelle zu etwas Unbekannten und etwas Gefährlichem und das bedrängt uns und wir können nur hoffen, dass wir über diese Bedrängnisse unsere Humanität und Freiheit nicht verlieren.
Müsste das für die christliche Theologie nicht radikale Solidarität und radikale Gegenwärtigkeit, also uneingeschränkte Experimentalität bedeuten, müsste es nicht bedeuten, Unvollständigkeit, Unperfektheit nicht nur hinzunehmen, sondern geradezu zu suchen? Damit nicht gilt, was Michael Schüssler ebenso treffend wie lapidar formuliert hat: „Das Waterloo der Theologie ist das Leben, nicht so sehr das Denken.“
Wartet im Herzen des Christlichen, und also auch der christlichen Theologie, nicht sowieso Selbstüberschreitung und Risiko, statt selbstgewisser Identität?
Fordert die offene, verletzliche gesellschaftliche Situation nicht noch viel radikaler eine Theologie, von der Dorothee Sölle sagte, dass sie zwar Wissenschaft brauche, „aber eigentlich näher an Praxis, Poesie und Kunst“sei?
Und warum haben wir sie nicht oder so wenig? Weil uns das kirchliche Lehramt mit Diskurskonstellationen von gestern bedrängt und die Universität uns in zahlenbasierten Wettbewerb und Selbstdarstellungsmarketing zwingt? Das ist so, aber es wären dennoch Ausreden.
Universität
Die Theologie ist Wissenschaft, sie wird als Wissenschaft betrieben und das ist gut so, denn es verspricht Zugang zu deren Archiven des Wissens, zu den neuesten Forschungsmethoden und es verspricht immer noch dieses unvergleichliche Abenteuer der Ideen, das wissenschaftliche Intellektualität sein kann.
Mir schien immer jener „nicht-absolutistische, depotenzierte Wissenschaftsbegriff“plausibel, den der Philosoph Hans-Michael Baumgartner in Anschluss an Kant entwickelt hat. Hier ist Wissenschaft schlicht das, was an Universitäten gemacht wird, wenn und insofern diese jene gesellschaftlichen Orte sind, an denen die methodenbewussteste und methodenreflektierteste Form von erkennntnisgeleitetem Wissenserwerb stattfindet. Mehr kann man nicht sagen, mehr braucht man auch dazu nicht sagen.
Dieser prozessorientierte Wissenschaftsbegriff stellt, wie eine neuere Arbeit zu Kants Streitschrift feststellt, auf allen Ebenen, inklusive derer, die den Wissenschaftsbegriff selber bestimmt, den Dissens auf Dauer. Wissenschaft ist damit „zutiefst politisch“und vor allem ist sie „institutionalisierter Dauerstreit“ – inklusive des Streits, wie dieser Streit und damit sie selbst organisiert sein soll, welchen Sinn er hat und was er bedeutet, ja sogar ob dem überhaupt so ist. Die Theologie muss sich diesem Streit im Rahmen der Universität stellen und sie wird Wissenschaft letztlich nur dadurch, dass sie sich diesem Streit stellt.
Der konkrete, strittige Wissenschaftsprozess ist auf Dauer immer stärker als jedwede normative Konzeptionalität, sei sie theologischen, sei sie philosophischen, sei sie gar obrigkeitlich-politischen Ursprungs. Eben das hält das Konzept des institutionalisierten Dauerstreits fest und dafür steht die Universität. Darin ist sie ein Glück und ein Segen.
Jede „angemaßte Kompetenz“ irgendeines Faches jedenfalls, irgendeiner Instanz, „allein zu sagen, was es mit dem Menschen auf sich hat“, ist damit ebenso „unwiederbringlich verloren“, wie die Forderung, Wissenschaft solle nur der „Wahrheit“ und nicht etwa auch der „Nützlichkeit“ verpflichtet sein. Freilich der Streit darüber, welche Nützlichkeit und wieviel Nützlichkeit und mit welchem Verhältnis zum Wahrheitsstreben muss permanent und in der Wissenschaft selbst geführt werden.
Die aktuelle Implementierung wettbewerbsorientierter, quantifizierender Strategien in das wissenschaftliche Feld, also der sich etablierende akademische Kapitalismus, ist daher an sich nicht das Problem. Seine Verdienste in der Ablösung der alten Ordinarienselbstherrlichkeit und in der Aktivierung von Dynamiken sind ja unübersehbar.
Problematisch ist, dass diese Einführung praktisch ohne konzeptionelle Reflexion innerhalb des wissenschaftlichen Feldes geschieht, sie sich rein auf Grund hoheitlichen staatlichen Lenkungshandelns ereignet und dabei die obrigkeitlichen Vorgaben vom Wissenschaftsbetrieb eher noch übererfüllt werden.
Oder anders gesagt: Es gibt keine Praktische Wissenschaft von den Wissenschaften, die ähnlich kritisch-konstruktiv die Universität begleitet, wie es die praktische Theologie für und in der Kirche tut. Manchmal ist es eben ein Vorteil und bedeutet es einen Vorsprung, wenn man schon früher in eine Bestandskrise geraten ist, eine gerechte Demütigung erfahren hat und eine Krisenwissenschaft etablierte.
Nun ist wissenschaftlich-diskursives Handeln methodisch kontrolliertes, also sich selbst beobachtendes Handeln, es ist intellektuelles, also sich selbst notwendig mit anderen Positionen und Perspektiven kontrastierendes Handeln, und es besitzt als unmittelbar entscheidungsentlastetes Handeln die Möglichkeit zu Experimentalität und perspektivischer Konzeption.
Theologie, gerade praktische Theologie, operiert in diesem Raum, und es ist weder konzeptionell noch individuell selbstverständlich, das zu dürfen und zu können. Dieser Raum war mein beruflicher Lebensraum in den letzten Jahrzehnten und es war ein reicher, lebendiger, immer auch noch angemessen freier Raum. Es war eines der Geschenke meines Lebens, in ihm arbeiten zu dürfen.
Wie sähe eine Theologie aus, die darauf besteht, dass es tatsächlich eine genuine Aufgabe der Wissenschaften ist, nützlich zu sein und beizutragen, dass eine gefährdete Menschheit eine gute und gerechte Zukunft hat?
Wie sähe eine Theologie aus, welche die Universität dazu treibt, noch viel stärker ein Ort des intellektuellen Streits zu werden? Eine Theologie, die nicht eifrig versucht, mitzukommen und doch auch anerkannt zu werden, eine Theologie, die sich natürlich der Kritik der anderen Wissenschaften stellt, aber auch jene kritisiert, die nun meinen, das letzte und einzige Wort im Feld der Wissenschaften zu haben?
Wie sähe eine Theologie aus, die darauf besteht, dass es tatsächlich eine genuine Aufgabe der Wissenschaften ist, nützlich zu sein, und beizutragen, dass eine gefährdete Menschheit eine gute und gerechte Zukunft hat, dass es aber auch ihre eigene Aufgabe ist, darüber zu streiten, intern wie mit der Zivilgesellschaft, welche Beiträge das konkret sind und worin sie bestehen?
Kirche
Hilft der Theologie dann dabei nicht, dass sie, weit mehr als die meisten anderen Wissenschaften, konstitutiv Teil eines spezifischen Sozialraums ist, aus dem sie stammt, für den sie zuallererst arbeitet und der ja immer noch einigermaßen stattlich, ressourcenreich und, gerade in Österreich, gesellschaftlich gut vernetzt und rechtlich abgesichert ist? Hilft ihr nicht, dass sie auch kirchliche Wissenschaft ist?
Leider weit weniger als möglich. Nicht dass in der Pastoralgemeinschaft Kirche nicht diskutiert, geglaubt, geliebt, gesorgt, gefeiert und Gott gelobt wird, nicht, dass in ihr nicht Menschen sich einsetzen für Barmherzigkeit und Gerechtigkeit und somit getan wird, was das Evangelium will und ist.
Nicht, dass in ihr nicht viel, sehr viel gespeichert wäre, von dem, was wir heute in Zeiten eines kulturell hegemonial gewordenen Kapitalismusbräuchten, gespeichert in ihren spirituellen und weisheitlichen Traditionen, in ihrer Volksfrömmigkeit, in ihren diakonischen und liturgischen Traditionen und Institutionen und, natürlich, auch in ihrer großen, alten und würdigen Theologie. All dies ist voller Schätze und ich hätte mein Leben als professioneller Theologe weder gewagt noch durchgehalten, hätte es nicht immer wieder die Erfahrung des intellektuellen wie lebensweltlichen Reichtums dieses thesaurus ecclesiae gegeben.
Ganz dunkel aber wird es, wenn man dem Blick auf die dark side oft the moon der Kirche nicht mehr ausweicht, ausweichen kann. Das passierte mir früh.
Aber da sind halt dann auch diese Verdunkelungen und Verdüsterungen. Sie lassen sich in zwei Kategorien einteilen. Da gibt es die ärgerlichen Bremsen, diese völlig unnötigen Blockaden, die verhindern, dass die kirchliche Tradition Dynamik entwickelt. Es sind dies allesamt Versuche, an katholischen Identitätsmarkern festzuhalten, die genau dazu nicht taugen: katholische Identität zu markieren. Das allein schon deshalb, weil sie es so demonstrativ wollen: Man merkt die Absicht und ist verstimmt: intellektuell wie spirituell.
Schlimmer noch: Über diese demonstrativen Identitätsmarker verrutschen die christlichen Relevanzhierarchien. Das gilt für eine Sexualmoral, die niemanden mehr hilft und an die daher niemand mehr glaubt und sich hält, das gilt für ein asymmetrisches Geschlechterverhältnis, das seine Legitimität nicht nur vor gesellschaftlichen, sondern auch vor christlichen Plausibilitäten längst verloren hat, das gilt für eine klerikale Herrschaftsordnung, die außerhalb klerikaler Kreise schlicht nicht mehr anerkannt wird und selbst in ihnen nur noch bei jenen, die sie als Identitätskorsett brauchen.
Ganz dunkel aber wird es, wenn man dem Blick auf die dark side oft the moon der Kirche nicht mehr ausweicht, ausweichen kann. Das passierte mir früh. Vom Würzburger „Modernisten“ Herman Schell, der bis übers Grab von Rom verfolgt wurde, über Friedrich Nietzsches „Es gab nur Einen Christen, und der starb am Kreuz“, zu Jahren in der Kirchengeschichte, die eben, schaut man nur näher hin, tatsächlich zumindest auch eine Krimimalgeschichte ist, über die Erkenntnis schließlich, dass die kirchliche Pastoralmacht so oft nicht autorisierte und befreite, sondern unterdrückte und beschädigte, bis zur jüngsten, der schrecklichsten Erkenntnis, dass geistliche und sexualisierte Gewalt verbreitet war und ist in der katholischen Kirche: Das kirchliche Dunkelfeld warf seine Schatten, wo immer ich auf meinem theologischen Weg auch war, und die Schatten wurden immer länger.
Damit kein Missverständnis bleibt: Ohne das Bewusstsein der permanenten Bedrängung durch diese Dunkelseite unserer Geschichte und Existenz hätte ich letztlich nicht Theologe bleiben können. Denn dann hätte ich ja die Augen verschlossen vor dem, was doch so offenkundig ist: dass wir in der gefallenen Natur leben, dass wir gefallene Natur sind, dass auch Kirche und Theologie Teil dieser gefallenen Natur sind.
Paulus nennt sich selbst Apostel, aber eben auch „verworfen“, Petrus wird Fels, aber eben auch Satan genannt. „Was ist es, das in uns lügt, hurt, stiehlt und mordet“, fragt Danton bei Büchner, was es genau ist, das wissen wir immer noch nicht wirklich, auch wenn die Angst ein erster Antwortanwärter sein dürfte. Dass der zivilisatorische Boden dünn, hauchdünn ist, auf dem wir stehen, individuell wie kollektiv, das ist eine empirisch belegte Tatsache. Die „Güte ist“ aktuell, wie es bei Brecht heißt, ja tatsächlich „wieder einmal schwächlich und die Bosheit“ nimmt „an Kräften wieder einmal zu.“
Ob die Kirche, ob die Theologie, ob der Glaube der Frage Dantons standhalten? Nicht erst der Missbrauchsskandal macht das zu einer wirklich offenen Frage. Die Empathielosigkeit gegenüber dem Leiden der Betroffenen ist ein beschämendes Dementi der eigenen Existenz und entspricht der Verleugnung Jesu durch Petrus. Denn sie schlug die Opfer ans Kreuz. Auch die Theologie hat lange nichts bemerkt oder bemerken wollen und mein Fach, die Pastoraltheologie muss sich dessen noch ein wenig mehr schämen als andere Disziplinen.
Diese Kirche mit ihren Schätzen, ihren Blockaden und ihren dark sides ist Thema, Ort und Perspektive meines Faches. Die Kernaufgabe der Pastoraltheologie ist die Selbstaufklärung der Kirche über sich an einem spezifischen Ort, zu einer spezifischen Zeit. Das zieht mein Fach, ein Krisenfach von Anbeginn, hinein in die Konfliktzonen der Gegenwart und diese Konflikte werden zunehmen, werden schärfer werden, werden härter werden. Denn die Entbettung des Religiösen aus seiner kulturellen Selbstverständlichkeit führt zu kulturkämpferischen Polarisierungseffekten mit enormen politischen Folgen – sie sind denn auch auf allen Ebenen zu beobachten.
All die progressiven wie konservativen Harmoniekonzepte, welche die katholische Kirche so lange, vor-, aber auch nachkonziliar, geprägt haben, sie fallen gegenwärtig in sich zusammen wie ein Kartenhaus. Besitzt die Kirche die geistlichen, intellektuellen, strukturellen und institutionellen Ressourcen, diese radikal prekäre Gegenwart zu bestehen?
Viele strukturelle Ressourcen dafür fehlen uns, weil die katholische Kirche gemeint hat, entsprechende Regelungsmechanismen, die der moderne Staat und seine Zivilgesellschaften auf Grund dramatischer eigener Abstürze entwickelt haben, nicht zu benötigen. Das rächt sich, wie noch jede Rechthaberei. Wir gehen mit einer weitgehend dysfunktionalen Sozialgestalt von Kirche in die nach-konstantinische Epoche religiöser Selbstbestimmung.
Und dass die geistlichen und spirituellen Ressourcen der Jesus-Botschaft die dark sides nicht verhindert haben, das ist fast noch erschütternder. Denn was sagt das über ihre Geltung in der real existierenden Kirche?
Der Niedergang der konstantinischen, sanktionsbewährten Formation der Kirche ist nicht aufzuhalten und man kann ihn nur begrüßen. Er ist die Voraussetzung für die Zukunft von Kirche und Glauben und Präsenz des Evangeliums. Aber haben wir eine Vorstellung vom danach? Und wie wir zu ihm kommen? Kann der Glaube der einzelnen die Kirche retten? Oder ihre radikale institutionelle Reform? Oder wenn nur beides zusammen: Wie käme es zusammen?
So viele argumentative Oppositionen jedenfalls, die heute im kirchlichen Raum immer noch herumschwirren, stimmen ob ihrer Falschheit nur traurig: Evangelisierung gegen Kirchenreform, Frömmigkeit gegen Autonomie, Glaubenstreue gegen Geschlechtergerechtigkeit.
Worin besteht die Würde, die Faszination, diese Fremdheit, Einzigartigkeit und Schönheit der Botschaft Jesu – für mich?
Lassen Sie mich hier an eine beeindruckende Frau erinnern: an Frau Dr. Dr. Ingeborg Janssen. Mehrere Semester besuchte sie als ältere Dame meine Vorlesungen. Sie hatte 1953 in Philosophie promoviert, 1961 wurde sie als erste Frau an unserer Fakultät in Theologie promoviert. Worüber? Über das Diakonat der Frau und mit dem Ergebnis, dass nichts gegen die Weihe von Frauen zu Diakoninnen spricht. 1961, vor über 60 Jahren war das - und nichts, nichts hat sich seither geändert. Wie lange soll das eigentlich noch so weitergehen?
Die Zeiten sind wahrhaft nicht dazu angetan, dass Theologie brav wird. Denn dann wird es weitergehen wie bisher.
Theologie
Die Theologie steht jedenfalls nicht unschuldig beobachtenden am Wegesrand. Auch sie kennt die Versuchungen der Macht und hat eine Geschichte mit diesen Versuchungen. Schon seit längerem erlebt sie aber die Erfahrung der gerechten Erniedrigung und spätestens in meiner Genration hat sie sich dieser Erfahrung auch gestellt.
Dies ist eine große Chance. Nicht nur, dass darin die Möglichkeit liegt, wieder zur Avantgarde der Kirche zu werden. Wichtiger noch: Die akademische Theologie kam so weg von aller früherer Erhabenheit und Selbstherrlichkeit. Sie wurde hineingezwungen in den Habitus demütigen Selbstbewusstseins, der entdecken hilft, was unter den Gesteinsschichten des akademischen Stolzes, der gelehrten Rechthaberei und der feinzisilierten Spitzfindigkeit so oft verschüttet wurde: die Würde, die Faszination, die Fremdheit und die Schönheit der Botschaft Jesu.
Vielleicht bräuchte es ja in Zukunft eine Theologie, die sich nicht so sehr an den klassischen Fachtraditionen, nicht an den klassischen Fragestellungen und Traktaten orientiert, sondern an den tatsächlich revolutionär neuen Konstellationen, in denen sie heute betrieben wird, vielleicht bräuchte es ganz neue Settings, bräuchte es andere Orte, in denen und an denen akademische Theologie getrieben wird, damit sie - als akademische – deutlich mehr nach „Volk und Straße“ und damit Gegenwart riecht, wie Papst Franziskus gefordert hat und der „Dienst am Außen korreliert“ mit der „Hinwendung zum eigenen Innen,“ wie Maria Elisabeth Aigner es gefordert hat.
Und ganz sicher bräuchte es eine Theologie, welche Diversity nicht als Bedrohung, sondern als Notwendigkeit begreift, weil nur mit ihr und in ihr die Würde, die Faszination, die Fremdheit und die Schönheit der Botschaft Jesu zur Geltung gebracht werden kann.
Womit ich der entscheidenden Frage meiner Jahrzehnte als Theologe und meiner theologischen Existenz nicht länger ausweichen kann und will: Worin besteht die Würde, die Faszination, diese Fremdheit, Einzigartigkeit und Schönheit der Botschaft Jesu – für mich?
Ich fasse es mit einem Autor, der das Christentum von außen betrachtet, ihm wahrlich nicht verpflichtet und dessen intellektuelles Zeugnis daher höchst glaubhaft ist: Slavoj Žižek. Ihn faszinieren drei Elemente an Jesus und ich teile diese Faszination: die von Jesus postulierte Möglichkeit des radikalen Neuanfangs, Jesu Fähigkeit, die Logik der Rache zu durchbrechen, und schließlich die im Christentum festgehaltene Einsicht in die unübersteigbare Rätselhaftigkeit des Menschen, die durch das Sich-Einreihen Gottes in die Menschheit symbolisch festgehalten sei.
Zusammen mit der im Christentum immer eingeräumten Möglichkeit, Gott auch noch in seinem Entzogensein nicht zu verlieren, sind das auch für mich die großen und schönen und geradezu unglaublichen Versprechen des christlichen Glaubens:
- die Notwendigkeit, aber auch Möglichkeit, des radikalen Neuanfangs,
- das Durchbrechen der Logik der Rache und des Ressentiments,
- und der Abstieg Gottes in seine Schöpfung bis hinab in deren dark sides, in deren Totenreiche. Denn das bedeutet: Nicht erst im Sieg über das Leiden wartet Gott auf uns, sondern im Grab unserer Ängste und Verzweiflungen.
Wo man daran glaubt, entdeckt man eine andere Welt.
- In ihr stehen die Armen vor den Reichen, die Ohnmächtigen vor den Mächtigen, die Kleinen vor den Großen.
- In ihr geht die Person vor der Institution,
- In ihr gibt es ein Recht auf Schwäche, auf Andersartigkeit, auf Verrücktheit, auf Eigenbrötlertum.
- In ihr herrscht die Anti-Ökonomie der Verschwendung (Bataille) eher als die Ökonomie der Verzweckung.
- In ihr herrscht eher die Subversion der Wunder als die Logik der ökonomischen oder gar religiösen Verwaltung der Welt.
- In ihr sind die Horizonte offen und wird die Freiheit geliebt.
Und in ihr ist der Blick Gottes und seiner Gläubigen liebevoll gerichtet auf jene, die der Gnade, der Gerechtigkeit und der Sorge am meisten bedürfen.
Damit bin ich an einem Punkt, wo jede professionelle Theologie an ihr mehr oder weniger hilfloses Ende kommt – und also auch diese Vorlesung.
Dass ich ein wissenschaftliches Fach vertreten durfte, das bis an diesen Punkt führt, dafür bin ich zutiefst dankbar.
Der Autor ist Professor für Pastoraltheologie an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Graz. Von 2009 bis 2019 war er Kolumnist der FURCHE.

Hat Ihnen dieser Artikel gefallen?
Mit einem Digital-Abo sichern Sie sich den Zugriff auf über 175.000 Artikel aus 40 Jahren Zeitgeschichte – und unterstützen gleichzeitig die FURCHE. Vielen Dank!
Mit einem Digital-Abo sichern Sie sich den Zugriff auf über 175.000 Artikel aus 40 Jahren Zeitgeschichte – und unterstützen gleichzeitig die FURCHE. Vielen Dank!