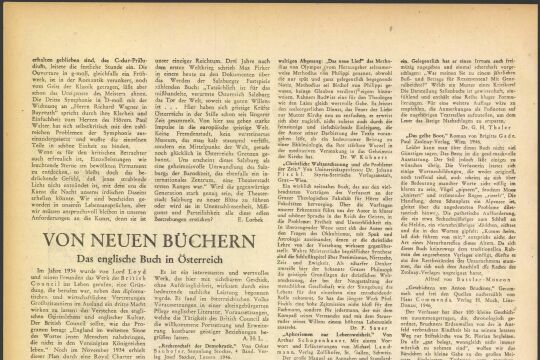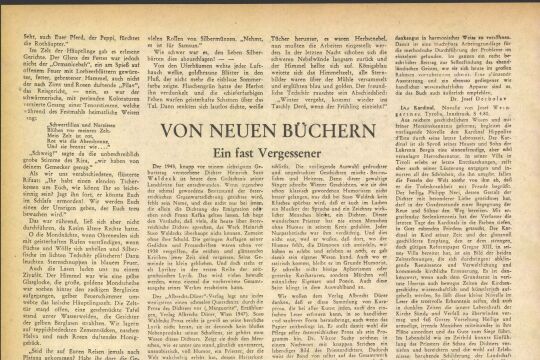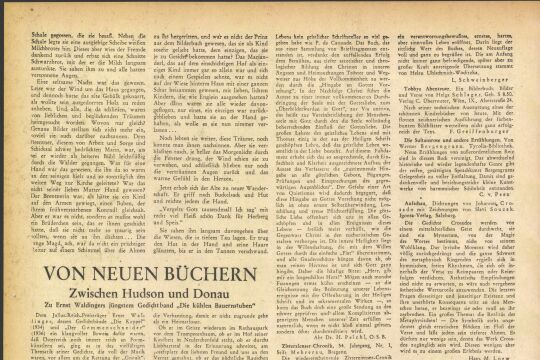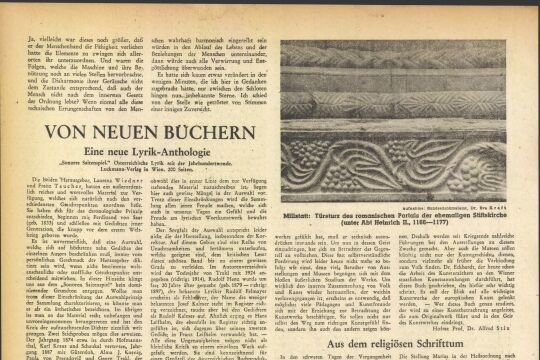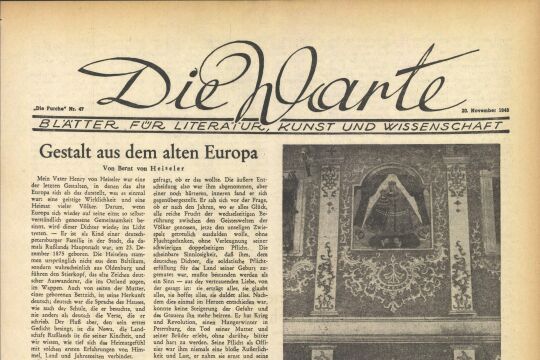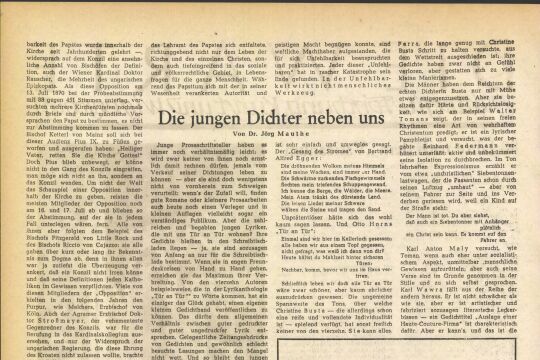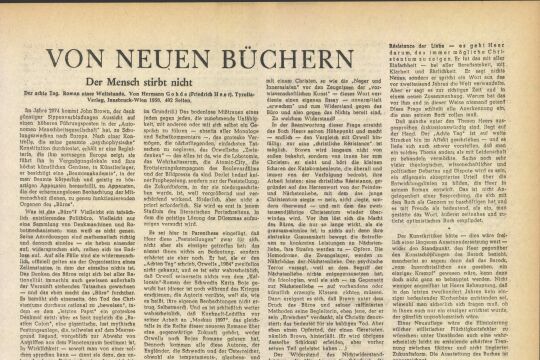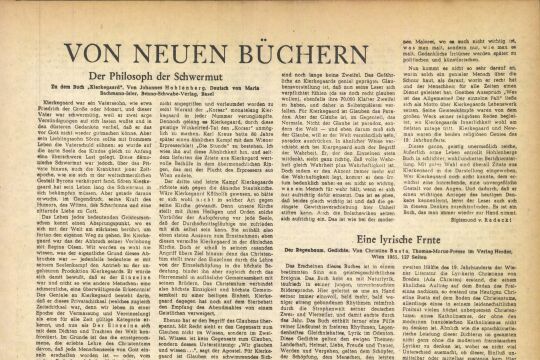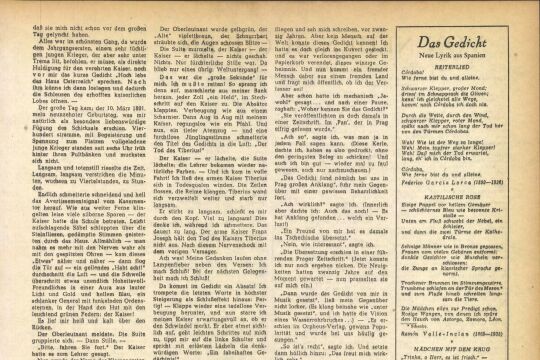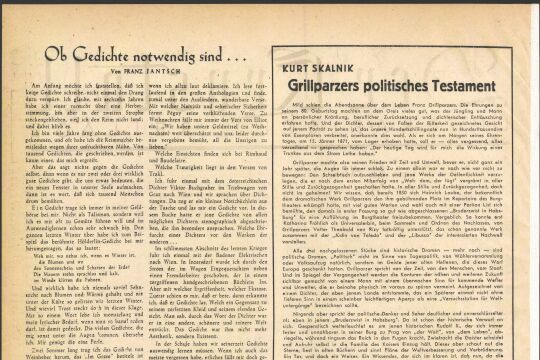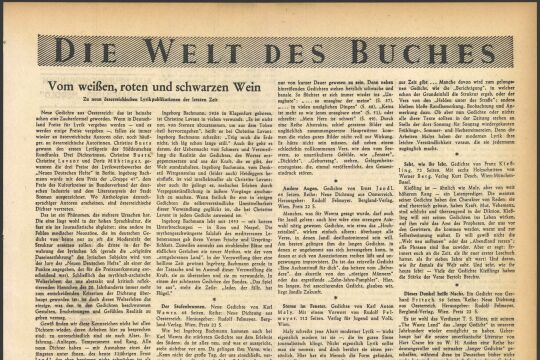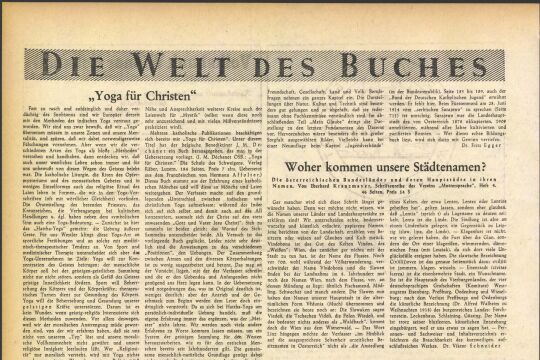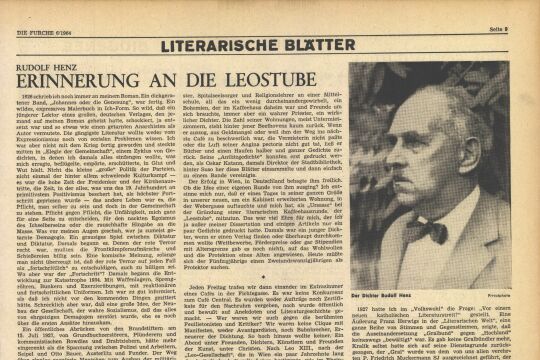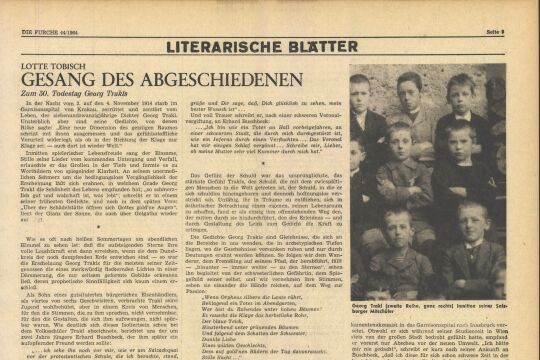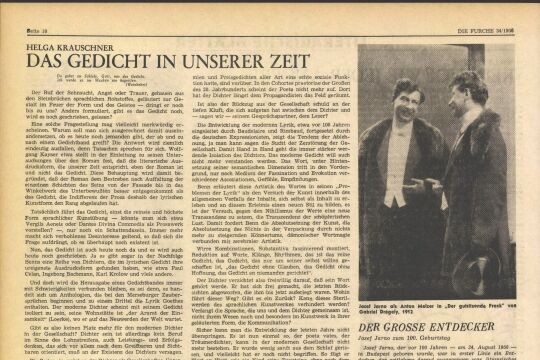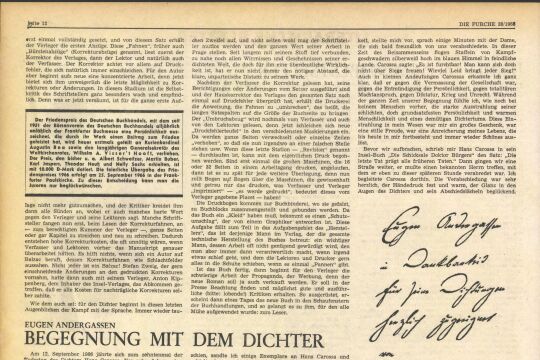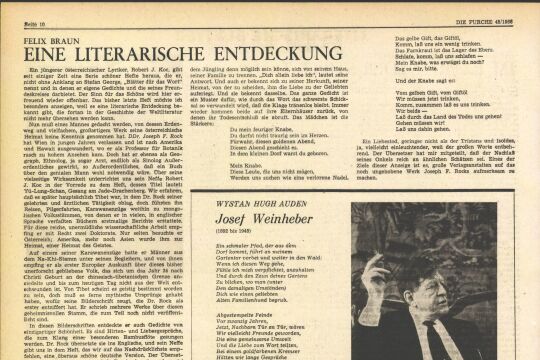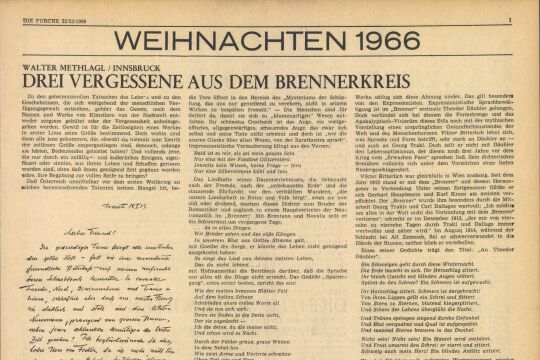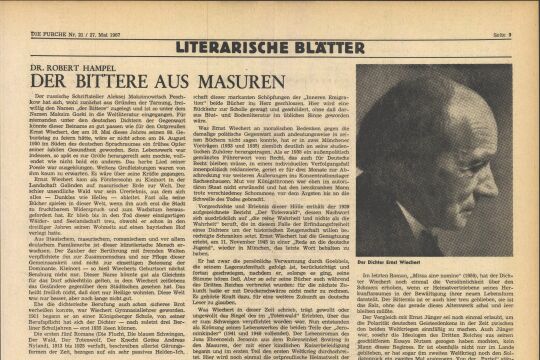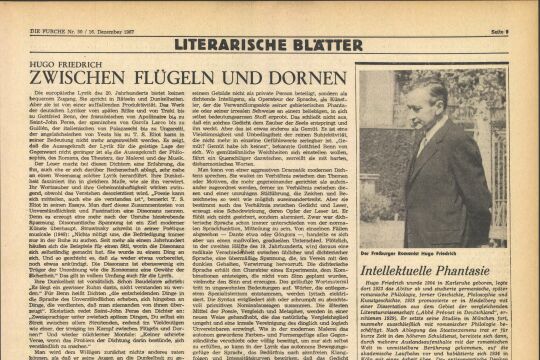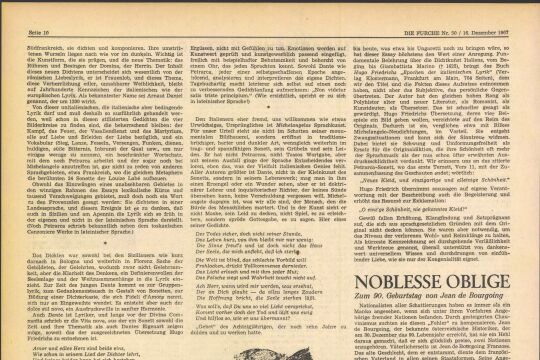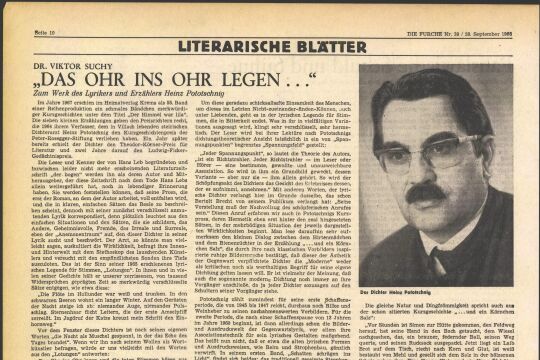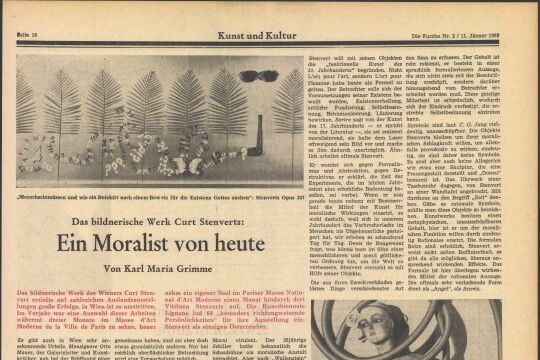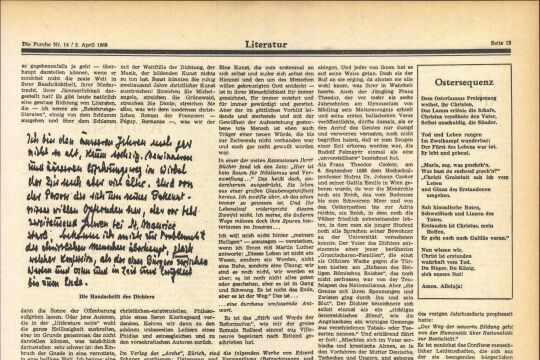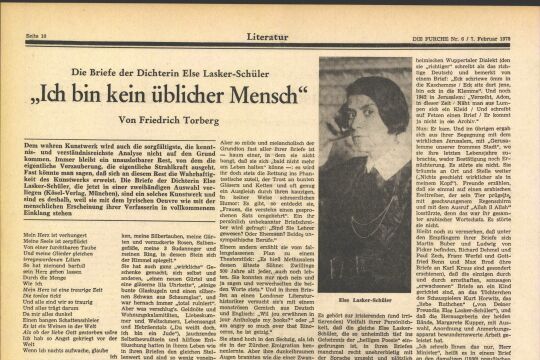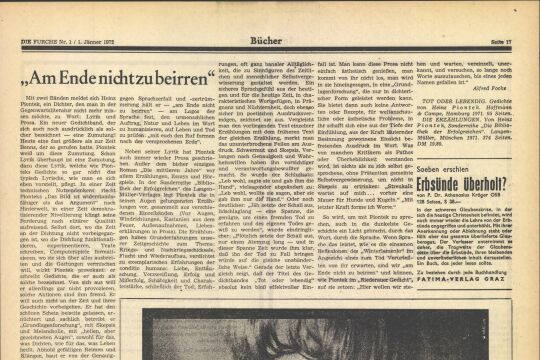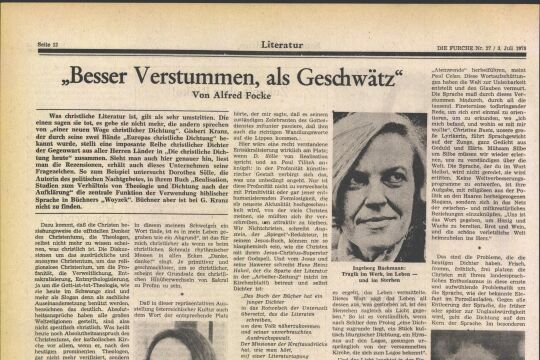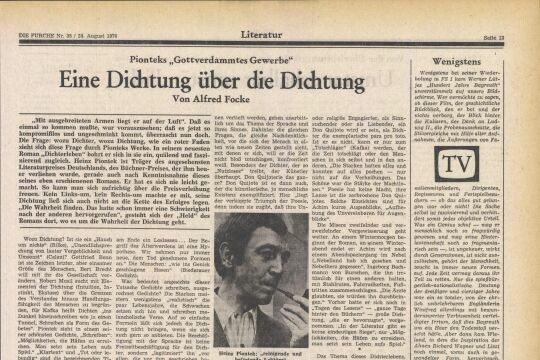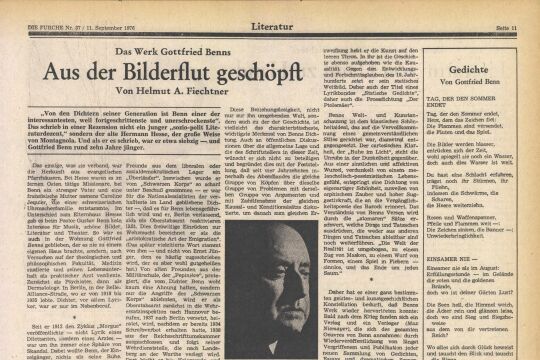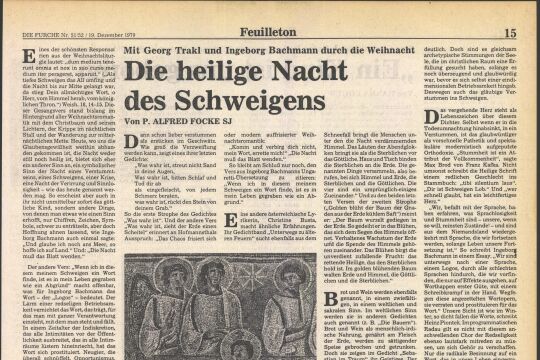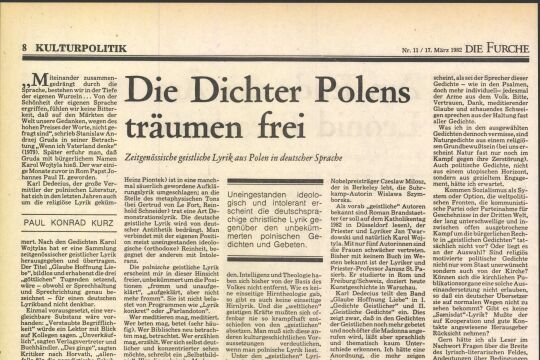Das Religiöse im Werk von Reiner Kunze. Zum 70. Geburtstag des Lyrikers am 16. August.
Welche Frage der Enkel bereitet Ihnen noch immer Kopfzerbrechen?" wurde der Lyriker Reiner Kunze einmal gefragt. "Die Frage nach Gott", war die Antwort. Nicht von vielen deutschen Gegenwartsschriftstellern bekäme man diese Antwort, und nur wenige schreiben Gedichte, die - zumindest auf den ersten Blick - so verständlich scheinen wie die knappen Verse Kunzes. Darum führen ihn gelegentlich sogar Kirchenfunktionäre im Mund. Doch hier ist Vorsicht geboten. Denn Kunze hat in einem Interview unmissverständlich erklärt: "Ich achte den Glauben anderer, mir selbst aber ist Gotteserfahrung bis heute nicht zuteil geworden."
Bilder, nicht "Botschaften"
Reiner Kunze, der Büchner- und Trakl-Preisträger von 1977, schreibt auf eigene hoffnung, so der Titel eines seiner Gedichtbände. Seine Perspektiven sind weder von einer Weltanschauung noch aus einer Religion abgeleitet; am Anfang eines Gedichtes steht nicht ein bestimmter Inhalt und schon gar keine "Botschaft", sondern ein Bild. Lapidar verknappte und epigrammatisch zugespitzte Bilder (ein Einfluss der späten Gedichte Bertolt Brechts) haben seinen Gedichten in der DDR eine unheimliche Sprengkraft verliehen und ihm, der nach schweren politischen Angriffen die Universität verlassen und als Hilfsschlosser im Schwermaschinenbau gearbeitet hatte, Schikanen und jahrelange Bespitzelung eingebracht. Unter dem Titel Deckname Lyrik hat er später Auszüge aus den über ihn angelegten Stasi-Akten - 12 Bände mit insgesamt 3.491 Blatt - veröffentlicht: eine atemberaubende Einführung in die Welt des Totalitarismus.
In dieser Welt hat er, der in seiner Jugend selbst propagandistische Verse geschmiedet hatte, sich eine unbestechlich-individuelle Perspektive erschrieben, in der eines jeden einziges leben (Titel eines weiteren Gedichtbandes) zählt. Mit dem Gedicht tastet er sich voran wie mit einem Blindenstock - ein Bild, das Kunze in seinem bislang letzten Gedichtband ein tag auf dieser erde verwendet: mit ihm berührt er die dinge, / um sie zu erkennen. Gerade auch in der Religion misstraut Kunze den kollektiven Formeln und Zeichen: Gott wohnt nicht bei den glocken, / und höher reichen wir nicht, so endet ein Gedicht, das dem von Kunze übersetzten tschechischen Dichter Jan Skácel gewidmet ist. Eines seiner schönsten Gedichte mit einer religiösen Bildwelt setzt ein Sandsteinkreuz auf dem Kalvarienberg bei Retz mit der Form eines Weinstocks parallel, um daraus eine herbe Kritik an der "Glaubensverwertung" einer kirchlichen Deutungs-Maschinerie zu formulieren: Und blut und wasser wird zur beere, aus der sie / jahr für jahr / den süßen einträglichen wein keltern // Wie aus dem stein den glauben.
Poesie nicht missbrauchen
"Vom Glauben nicht ergriffen, bin ich, wissend, wovon gesungen wird, ergriffen von den Messen Mozarts!" schrieb Kunze im Essayband Das weiße Gedicht. Und an Mozart beobachtet er etwas, was vielleicht auch für ihn selbst gilt: "Zweifelsohne spricht alles, was wir über Mozart wissen, für die Annahme, daß die Religion ihn nicht mehr interessierte als andere Selbstverständlichkeiten des Lebens auch; womit jedoch gesagt ist: Sie war ihm eine Selbstverständlichkeit." In manchen Gedichten Kunzes schimmert diese Selbstverständlichkeit durch, wenn etwa In den Highlands mit dem Bild beginnt: Einmal, noch vor erschaffung des menschen, / versuchte sich gott als kupferschmied // So entstand / der herbst in den Highlands und am Ende dem Leser nahe legt: Du kannst die geduld wiederfinden / die gott hier verlor. Ebenso selbstverständlich wie konventioneller Deutung entzogen ist die Rede von Gott im Gedicht Zuflucht noch hinter der Zuflucht aus dem frühen Band zimmerlautstärke. Es endet mit den Zeilen: Was machst du, fragt gott // Herr, sag ich, es / regnet, was / soll man tun // Und seine antwort wächst / grün durch alle fenster. Der Skeptiker Kunze weiß um das Nichts, das durch die risse des glaubens schimmert und (er)findet bisweilen Bilder, die darüber hinausweisen. Sie auszupressen, um daraus ein Bekenntnis zu destillieren, wäre ein grober Missbrauch seiner Poesie.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!