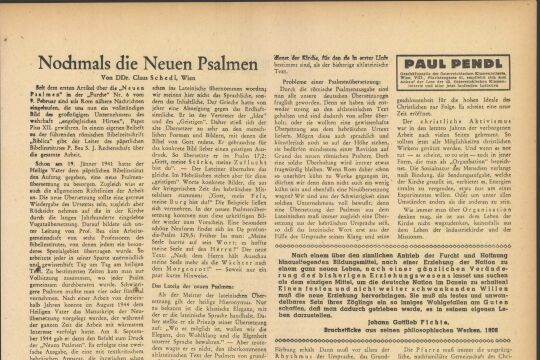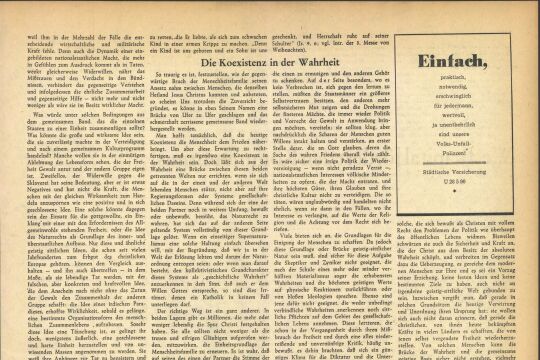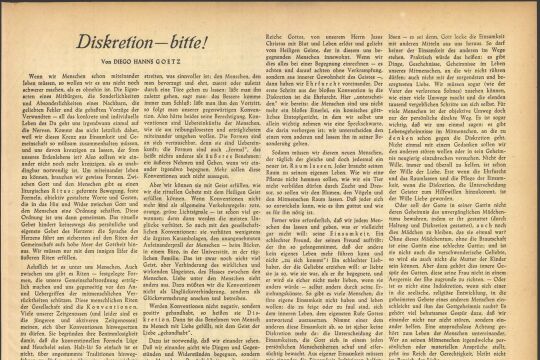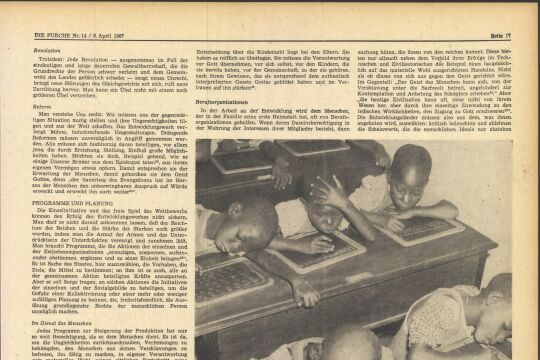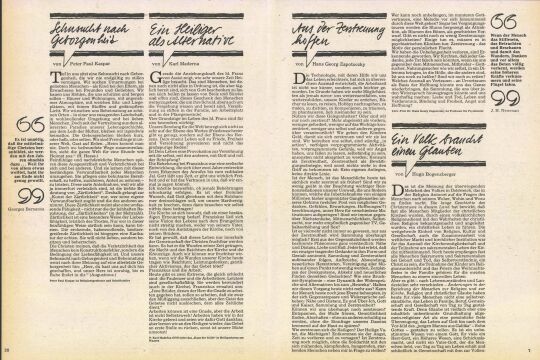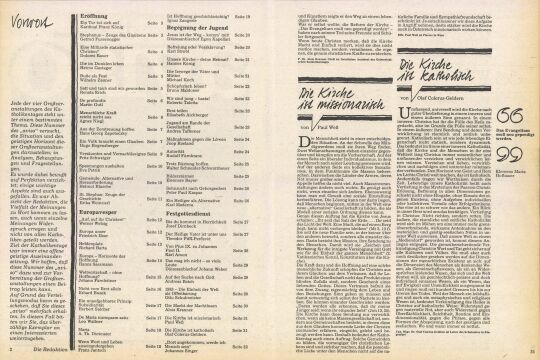Vor einem Sozialwort der Kirchen braucht es die Kirchen als Sozialwort Gottes. Eine innerkirchliche Stellungnahme zum Projekt der 14 christlichen Kirchen in Österreich.
Gerade die Kirchen müssen von ihrem Fundament her den sozialen Grundwasserspiegel in unserer Gesellschaft immer wieder mit frischem Wasser anheben." So hat Bischof Herwig Sturm vor einer Woche in der furche-Diskussion den eigentlichen Beitrag der 14 christlichen Kirchen in Österreich zu Verbesserung der sozialen Situation beschrieben. In den folgenden Überlegungen geht es um dieses Fundament der Kirchen, um den Glauben und um dessen Bedeutung für das Zusammenleben der Menschen. Denn eine soziale Ordnung lässt sich nicht herstellen oder garantieren, auch nicht, indem man den Sozialstaat in der Verfassung verankert (vgl. furche 13/2002, Seite 5). Sie steht und fällt damit, ob in den Menschen die entsprechende Gesinnung vorhanden ist oder nicht. Wer also zu Recht den Neoliberalismus für einen asozialen Sozialdarwinismus hält und ihm ein humanes System entgegensetzen will, muss die tieferen Voraussetzungen einer Gesellschaft zu ergründen suchen:
Solidarität heißt nicht sozial
Nur die Menschen, die einen Staat bilden oder Wirtschaft treiben, können sozial sein. Von einem Sozialstaat oder einer Sozialen Marktwirtschaft kann man nur in einem übertragenen, abgeleiteten Sinn sprechen. Es gibt sie nur in dem Maß, in dem die beteiligten Menschen sozial handeln. "Sozial" meint hier nicht einfach "gesellschaftlich", sondern gemeinnützig, menschlich, wohltätig, hilfsbereit. Dafür wird heute oft das Wort "solidarisch" gebraucht. Dieser Begriff ist ebenfalls mehrdeutig. Es gibt auch eine "Solidarität aus Egoismus" (vgl. furche 10/2002, Seite 1), also zum je eigenen Vorteil, auf Gegenseitigkeit. Auch sie stellt schon einige moralische Ansprüche wie Vertragstreue und Pflichterfüllung, genügt aber keineswegs für eine soziale Ordnung. Sie denkt nicht an jene, die nicht dazugehören, die keinen Gewinn bringen, sondern lebt oft auf deren Kosten und schließt die Fremden aus. Von einer "sozialen Solidarität" kann man erst sprechen, wo es um den anderen Menschen als solchen geht, und zwar prinzipiell um jeden, also bei einer Solidarität aus der Liebe des Wohlwollens, das nicht mit dem Gefühl der Sympathie verwechselt werden darf.
Sozial kann eine Gesellschaft oder eine Wirtschaft nur unter Gleichgesinnten sein. Eine Kette ist immer nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Wenn eines auslässt, dann reißt sie. Auch die Solidarität braucht Gegenseitigkeit und damit eine Übereinstimmung von Struktur und Gesinnung der einzelnen Glieder. Wirklich "funktionieren" kann sie nur unter Gleichgesinnten, andernfalls muss sie durch Strafandrohungen in den Gesetzen, durch Polizei und Justiz notdürftig gegen Missbrauch geschützt werden (was nur gelingt, solange nicht eine Mehrheit die Solidarität der anderen ausnützt). Das gilt bereits von der Solidarität auf Gegenseitigkeit: Wenn die Arbeiternehmer in einem Land hohe Löhne und Sozialleistungen fordern, aber die Waren aus Billiglohnländern kaufen, dürfen sie sich nicht darüber beklagen, dass ihre Arbeitgeber die Produktion in solche Länder verlagern und sie ihren Job verlieren. Wenn Arme nur deshalb einen sozialen Ausgleich verlangen, um reich zu werden und dann ebenfalls auf Kosten anderer zu leben, dann werden höchstens die Personen ausgetauscht (wie im Kommunismus), aber das System ist gleich schlecht geblieben.
Neben den Auswirkungen der neoliberalen Weltwirtschaft sind Korruption, Bürgerkriege, Erpressung und Ausbeutung durch interne Machthaber in den Entwicklungsländern wichtige Ursachen des dortigen Elends. Wenn Politiker und Unternehmer sozial handeln wollen, können sie es nur, soweit die Menschen in ihrem Einflussbereich mittun. Auch die Solidarität aus Liebe wird schon bei einseitigen Hilfsmaßnahmen auf eine sinngemäße Verwendung der Spenden achten müssen. In ihren tieferen Formen - dazu gehört das Teilen - ist sie nur im gegenseitigen Vertrauen (was nicht heißt: auf Gegenleistung) möglich. Die Nächstenliebe verlangt nicht, sich anderen auszuliefern. Sie nimmt die Nächsten so wichtig wie sich selbst.
Die nötige soziale Gesinnung der Einzelnen ist untrennbar mit der religiösen Frage nach einem sinngebenden Grund des vorgegebenen mitmenschlichen Daseins verbunden. Wenn ein Mensch prinzipiell davon ausgeht, dass sein eigenes Leben und das der anderen auf einem absurden Zufall beruht, dann wird er sich entweder dem Leben und der Liebe verweigern (durch Flucht in die Sucht usw.) oder mit Gewalt versuchen, seinem Leben und seinen Beziehungen selbst Sinn zu geben, also wie Gott zu sein. Er will dann den Wert des Lebens der anderen selbst bestimmen, Herr über Gut und Böse sein, ist nur sich selbst der Nächste. Es gibt für ihn keine vorgegebenen, für alle gültigen Pflichten. Auf dieser Basis kommt nicht einmal die Solidarität auf Gegenseitigkeit zustande, weil die Gültigkeit von Verträgen nicht selbst wieder Gegenstand eines Vertrags sein kann. Noch weniger wird es eine "soziale Solidarität" aus der Liebe des Wohlwollens geben, die Opfer kosten und unter Umständen sogar die Hingabe des Lebens erfordern kann (etwa, wenn es darum geht, wie Jägerstätter eher den Tod hinzunehmen, als am Unrecht mitzuwirken).
Eine soziale Ordnung erfordert bei den Beteiligten einen Vorschuss an Grundvertrauen (leise Hoffnung) oder ein festes Vertrauen (Glauben). Nur wenn Menschen die Angst um ihr Dasein aushalten, ohne wie Gott sein zu wollen, weil sie wenigstens leise hoffen, dass ihr Leben von seinem Grund her auf Sinn angelegt ist, sind sie zu einem partnerschaftlichen, verbindlichen Miteinander fähig. Das gilt schon für die Solidarität auf Gegenseitigkeit in einem bestimmten Personenkreis, in einer Nation oder einer religiösen Gruppierung. Hier kann diese Hoffnung allerdings auch auf einem Menschen (Führer), auf der eigenen Gruppenidentität (Volk oder Rasse) oder auf dem Glauben an einen Gott beruhen, der nur oder bevorzugt die Angehörigen der eigenen Religion liebt.
Es braucht Gleichgesinnte
Wenn es sich hingegen um eine soziale Solidarität handeln soll, die prinzipiell alle Menschen einbezieht, dann braucht es mindestens einen Vorschuss an Vertrauen, dass das Leben und die Liebe aus einem Ursprung stammen, der allen Menschen die gleiche Würde und ihrem Miteinander die Chance einer gelingenden Gemeinschaft gibt. Das ist auch ungläubigen "Menschen guten Willens" möglich, manchmal besser als selbstsicheren Religiösen (vgl. furche 5/2002, Seite 8). Je fester Menschen miteinander auf einen guten Grund ihres gemeinsamen Lebens vertrauen, desto tiefer werden die Beziehungen sein, die zwischen ihnen entstehen.
Christen, die an einen Gott glauben, der alle Menschen liebt und zur Gemeinschaft beruft, können ein Beispiel von sozialer Solidarität geben. Die Religionen sind nicht alle gleich. Nur das Christentum bekennt sich zu einer über das Mitleid hinausgehenden personalen Nächstenliebe zu prinzipiell allen Menschen, nicht nur zu den Angehörigen des eigenen Volkes (samt den Fremden im eigenen Land) oder der eigenen Religion, sondern auch zu den Ausländern und den Ungläubigen, sogar zu den Feinden. Jesus hat Freiwillige gesucht, mit denen er seine Botschaft von Gott als Vater aller verwirklichen wollte. Daher konnten seine Jünger und Jüngerinnen nach seinem Tod die Grenzen Israels überschreiten und ein erneuertes Volk Gottes aus Menschen aller Völker bilden. Auch wenn diese Gemeinschaft für alle offen ist, die sich ihr anschließen wollen, und über ihren Bereich hinaus viel Gutes tut (auch für Angehörige anderer Religionen, wie in den Hilfswerken von Mutter Teresa und Ruth Pfau sowie in vielen anderen), kann sie sich nur unter Gleichgesinnten voll entfalten, in der gegenseitigen Liebe der Christen, die deren Kennzeichen sein soll: Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid: wenn ihr einander liebt (Joh 13,35).
Entsprechend erneuerte Kirchen sind selbst ein lebendiges Sozialwort Gottes, das erst kirchliche Sozialworte glaubwürdig macht. Die Bergpredigt richtet sich an die Jünger und Jüngerinnen Jesu, sie gibt ihnen ein Leitbild, damit sie in ihren Gemeinden "Salz der Erde, Licht der Welt, Stadt auf dem Berg" sein können (Mt 5,13-16). Sie ist zunächst nicht eine soziale Botschaft an die Welt, sondern ein Programm für die Christen. Wenn diese sich daran halten, sind sie selbst ein Sozialwort, das Gott durch sie spricht. Dieses wird durch eine Praxis glaubwürdig bezeugt, die sich nach den Idealen der ersten Christen ausrichtet: Die Gemeinde der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Es gab auch keinen unter ihnen, der Not litt (Apg 4,32a.34a).
Solche Gemeinden werden oftmals im Kontrast zu ihrer Umgebung stehen, aber sie werden durch ihr Beispiel motivieren, und man wird sie in sozialen Fragen ernst nehmen (ihnen nicht nur die Versorgung der Opfer des Systems überlassen). Ihre wieder geeinten Kirchen wissen um die nötige Übereinstimmung von Gesinnung und Struktur sowie um den Zusammenhang von Glaube und Liebe, dass also zu ihrer Caritasarbeit und Entwicklungshilfe auch das Zeugnis des Glaubens treten muss, um die leise Hoffnung der Menschen auf einen Sinn des vorgegebenen Daseins zu wecken oder ihr Grund-Vertrauen auf Gott zu stärken und sie so zu einer sozialen Solidarität aus Liebe zu ermutigen. Wenn Fremde dadurch fähig werden, geschwisterlich miteinander zu teilen, ist das ein Wunder, wie bei der Brotvermehrung.
Der Autor ist Dozent für Pastoraltheologie in Innsbruck.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!