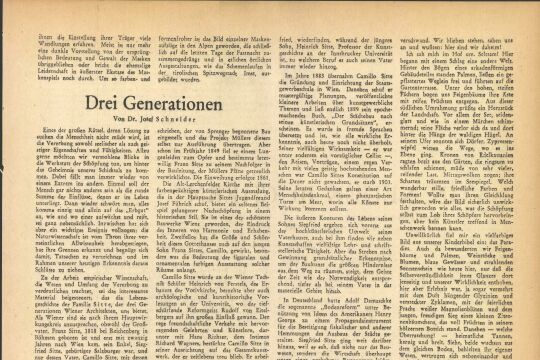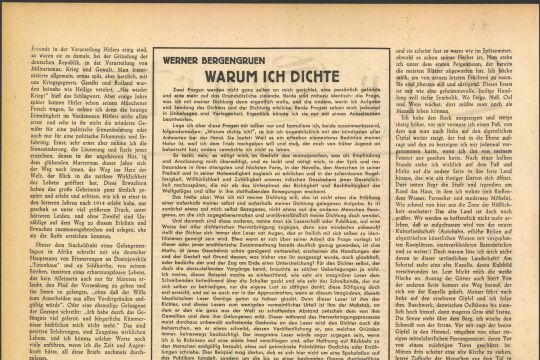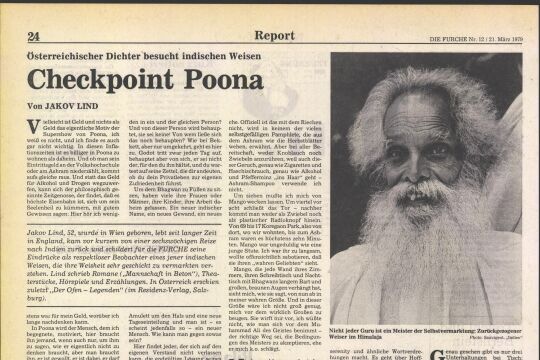Wer einen Garten betreut, geht mit Vergänglichkeit und Ewigkeit gelassener um als andere, vielleicht weil mit den Jahren die Erkenntnis reift, dass es niemals um etwas anderes geht als um einen ewigen Kreislauf.
Ein Gärtner, das versuchte der tschechische Schriftsteller Karel ÇCapek (1890–1938) in seinem wunderbaren Buch „Das Jahr des Gärtners“ eindringlich allen Nicht-Gärtnern zu erklären, sei keineswegs, wie landläufig angenommen, ein Wesen, das nur Blumen züchte. Nein, der Gärtner sei vielmehr damit befasst, „sein Denkmal in einem Düngerhaufen“ zu errichten.
Denn am Anfang jedes Gartens stehen nicht die Blumen, sondern das Bemühen um den Humus und um die Fruchtbarmachung der Erde. Nur wenn der Boden die rechte Beschaffenheit erreicht, kann unter den Händen des Gärtners alles andere entstehen, und es ist gut möglich, dass auf dem besten Humus später ohnehin alles fast wie von selbst wächst.
Aber stelle erst einmal einer einen solchen Humus her. Wer nicht mit fruchtbarer, lockerer Scholle gesegnet ist, der hat die Plage mit Kompost und Sand und Umstechen, und das geduldig immer und immer wieder. Jahre kann es dauern, bis sich Erfolg einstellt. Nur die Zähsten kommen da durch.
Viel Mühe und Anstrengung stehen also am Beginn, und ÇCapeks Gärtner weiß das nur zu gut: „Käme er in den Garten des Paradieses, würde er berauscht den Atem einziehen und flüstern:, Herrgott, ist das ein Humus!‘ Ich glaube, er dächte nicht daran, vom Baume der Erkenntnis zu naschen; er würde eher zusehen, wie er unserm Herrgott einen Schubkarren voll paradiesischer Erde entführen könnte.
Graben und nachdenken
Oder er würde bemerken, dass rund um den Baum der Erkenntnis der Boden nicht aufgelockert ist, und wahrscheinlich eifrig zu graben beginnen, ohne zu ahnen, was über seinem Kopfe baumelt,, Adam, wo bist du?‘, würde der Herrgott rufen., Ja, ich komme gleich‘, würde der Gärtner antworten, oder:, Ich kann jetzt nicht‘, und er würde weiter herumarbeiten.“
Der ideale Ort für uns Erdenbewohner – er ist in der Menschheitsgeschichte nicht umsonst fast ausnahmslos als prächtiger Garten beschrieben, als einer, in dem dieser Humus schon wohl bereitet und in dem bereits die Zeit der Blumen angebrochen ist: als mesopotamischer Paradeisos, als die Gärten von Elysium und Arkadien, als die geheimnisvollen Gärten der Hesperiden, als besagter Garten Eden in der Bibel.
Herumbuddeln, nachdenken, glücklich sein. Darum geht’s hier.
Die Demut des Sterblichen
Die Frucht der Erkenntnis, mag sie irgendwo baumeln. Sollen andere ihr nachjagen. Viel wichtiger als ihr augenblicklicher Genuss ist dem Gärtner das Substrat, aus dem der dazugehörige Baum verlässlich sprießt, und jeder von uns, der je einen Garten kultivierte, der mit Hingabe seine Komposthaufen betreute und nach dem Zupfen der Unkräuter in Zufriedenheit erschöpft irgendwo hingesunken dem Wachsen des Salates zuhörte, der weiß, wovon hier die Rede ist: von der höchstmöglichen Annäherung an den Zustand des Glücks in seiner dauerhaften, immer wiederkehrenden, durchaus mit der Demut des Sterblichen dankbar entgegengenommenen Form. Es ist ein Zustand, der nur aus einem selbst kommen kann. Der Garten ist der ideale Ort, ihn zu erreichen.
Der aufbereitete Boden als Voraussetzung und als Beginn des Werdens und Wachsens – natürlich ist das eine Metapher, auf der sich grandios herumreiten lässt, bis hin zu den derzeit so gerne diskutierten und in der jüngeren Vergangenheit gegebenenfalls nicht aufmerksam genug gepflegten Ausbildungsmustern für junge Menschen. Wie dumm kann eine Gesellschaft sein, wenn sie gerade diesem Gärtchen nicht die größtmögliche Aufmerksamkeit und Hingabe widmet, die sich überhaupt denken lässt?
Der Garten als Lehrmeister für die Dinge des Lebens, des Werdens und Entstehens, aber natürlich auch des Vergehens und Wiederauferstehens ist ebenfalls ein Bild, das ganz und gar nicht weit hergeholt scheint und in Kunst-, Literatur-, Philosophiegeschichte einen fixen Platz hat. Der Garten war von Beginn an ein Gleichnis, und daher empfiehlt es sich gerade dieser Tage, die Schriften beispielsweise zweier ganz bestimmter alter Gärtner unterschiedlicher Epochen hervorzukramen und von deren gedanklichem Humus ein paar Schaufeln für die Beimpfung des eigenen abzuzwacken.
Der eine wäre der griechische Philosoph Epikur (um 341–270 v. Chr.), der andere sein viel späterer französischer Kollege Michel de Montaigne (1533–1592). Zwei große alte Gärtner in der Tat. Und ohne dass derweilen schon die Rede davon wäre, erleben die Lehren der beiden eben in Abwandlungen und Variationen landauf, landab eine heimliche Renaissance. Denn beide stehen exemplarisch für all jene, die sich in bewegten Zeiten aus der „offiziellen“ politischen und öffentlichen Welt ganz bewusst in die privaten Sphären ihrer Gärten zurückzogen. Nicht, um der Welt insgesamt gleich ganz den Rücken zu kehren und in eine Scheinwirklichkeit abzutauchen, sondern um die eigenen Prinzipien unverfälscht und wohlreflektiert perfektionieren und zur Anwendung bringen zu können, und – was Glück für uns Nachfolgegärtner – um sie präzise ausformuliert niederzuschreiben.
Epikur gründete in einem kleinen Garten Athens seine Gartenschule und damit auch gleich einen neuen Zweig der Philosophie. Montaigne gründete auf seinem Landgut und in dem Turm, in den er sich von seinen offiziellen Ämtern zurückzog, eine neue Literaturform, die des Essays. „Die schönste Frucht der Selbstgenügsamkeit ist Freiheit“, sagte der eine. „Das Meisterstück eines Menschen, auf das er besonders stolz sein kann, ist, sinnvoll zu leben; alles übrige, wie regieren, Schätze sammeln, Bauten errichten, sind Nebensachen“, sagte der andere.
Der Garten in Zeiten der Krise
In den Zeiten der sogenannten „Krise“, in denen auf rein gar nichts mehr Verlass zu sein scheint - weder auf Schätze noch auf Politik, noch auf Wirtschaft, noch auf Religion und schon gar nicht auf altmodische Befindlichkeiten wie Nächstenliebe – stellen selbst ganz junge Menschen die großartigen Wichtigkeiten dieser nicht unbedingt sympathischen „offiziellen“ Welt infrage.
Was noch vor wenigen Jahren als völlig unmodisch, ja nachgerade als schrullig galt, nämlich das vergnügte Kultivieren von Gemüse und Blümelein in gemieteten, gekauften, gepachteten Gärten, ist zu einer weit verbreiteten, durchaus mit Leidenschaft betriebenen Freizeitbeschäftigung vieler geworden. Gut so, denn neben dem psychohygienischen Nutzen gibt es als Bonus auch den ökologischen. Doch das ist wieder ein anderes Thema.
Epikur sagt: „Mit tierischer Geschäftigkeit häuft man einen Berg von Reichtum an, das Leben aber bleibt dabei arm.“ Dabei geht es doch nur um Folgendes: „Es ist besser, gelassen auf Stroh zu liegen, als auf goldenem Stuhl an üppiger Tafel seine Ruhe zu verlieren.“ Und Montaigne stimmt 1800 Jahre später zu: „Ich will wohl, dass man tätig sei, dass man die Pflichten des Lebens so weit ausdehne, wie man kann; und dass der Tod mich dabei antreffe, dass ich meinen Kohl pflanze – aber gleichgültig über seinen Zuspruch und noch mehr darüber, dass mein Garten nicht völlig in Ordnung ist.“
* Die Autorin ist freie Journalistin und Kolumnistin der Zeitung „Der Standard“
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!