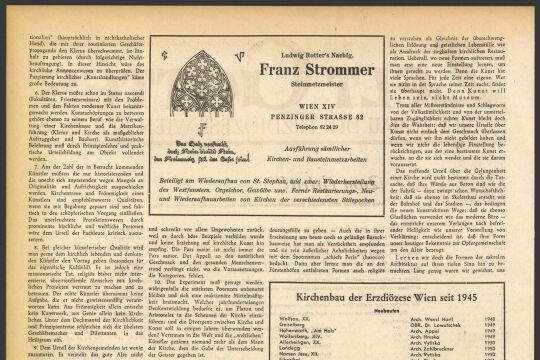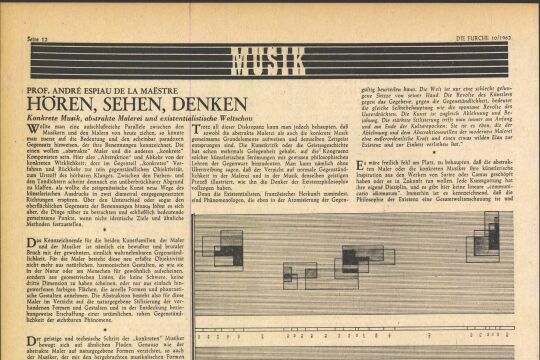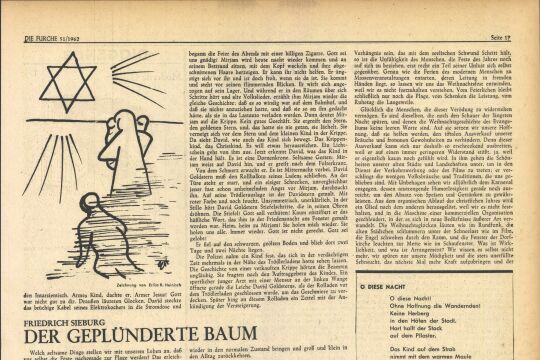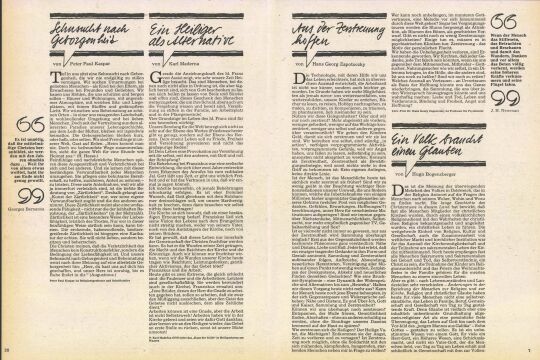Das Leben sollte nicht nur gelebt, sondern geformt, gestaltet, zu einem "Kunstwerk" gemacht werden. Liturgie als - notwendiger - Teil des Lebens. Kunst und Religion sind seit den Anfängen der Menschheit verbunden. Das gilt gleichermaßen für die Gegenwart, auch wenn sich beide Teile dieser Verbindung nicht immer leicht miteinander tun: Die evangelische Theologin Susanne Heine über die Trias Glaubenslehre-Caritas-Liturgie (unten), Hartwig Bischof zur Geschichte des Kirchenraums (Seite 22) und Gustav Schörghofer über ein provokantes Experiment mit Objekten für die Liturgie (Seite 24); Sakralraumgestalter Leo Zogmayer im Gespräch über den "schweigenden Raum" (Seite 23). Redaktion: Otto Friedrich
Man kann die Welt nach verschiedenen Gesichtspunkten einteilen. Jede Zeit hat dabei ihre Vorlieben. Gut und böse ist eine beliebte Methode, sich selbst von anderen zu unterscheiden, schön und hässlich oder gescheit und dumm, freilich in sehr viel differenzierterer Ausdrucksweise, gehört zum Vokabular der Kulturkritiker, aber ebenso zu jeder trivialen Unterhaltung. Am beliebtesten ist aber derzeit, wirtschaftlich zu denken und nach dem Nutzen einzuteilen: Nützlich und nutzlos - das ist die Frage.
Balance der Tätigkeiten
Das schafft Probleme, denn Kunst ist nutzlos, es sei denn, sie dient als Geldanlage auf dem Kunstmarkt. Trotzdem sind die Konzertsäle voll und das Land wird alljährlich von Festspielen überzogen. Was bewegt Menschen, sich solchen Nutzlosigkeiten hinzugeben? Offenbar haben sie etwas davon, eine andere Art von Nutzen, ohne den das Leben grau und öde wäre. Um das zu verstehen, kann es hilfreich sein, in der Denkgeschichte der Menschheit nachzusehen. Denn schon Aristoteles wusste darüber etwas zu sagen, was seither nicht überholt werden konnte.
Auf dreifache Weise ist der Mensch tätig, meinte er:
* tätig im Denken, um Zusammenhänge zu erkennen,
* im verantwortlichen Handeln für die Nächsten und die Gesellschaft
* und in der Gestaltung von Kunst und Lebenskunst.
Theorie, Praxis und Poiesis, nennt er die Trias menschlichen Tuns, das uns von allen anderen Lebewesen unterscheidet. Die Balance in diesem Dreigestirn ist ein Idealzustand, Störungen durchziehen die Geschichte. Nur die Praxis hat einen unmittelbar erkennbaren Nutzen; deshalb steht sie heute im Vordergrund. Schulen und Universitäten sollen auf die Praxis ausgerichtet sein, die Forschung hat praxisnah zu erfolgen, wohingegen Theorie einen schlechten Ruf genießt. Das Denken auf die Reihe zu bringen, wird oft als nutzlose Zeitverschwendung gesehen; und so beliebt Feste auch sind, gibt die Wirtschaft doch zu überlegen, welchen Nutzen an vermehrtem Profit jeder eingesparte Feiertag haben würde.
Lehre - Caritas - Liturgie
Die Geschichte der Religionen lässt sich als ein fortwährendes Ringen um Gleichgewicht und den Zusammenhang von Theorie, Praxis und Poiesis verstehen. So hat auch das Christentum eine Theorie ausgebildet, die Glaubenslehre genannt wird und die sich tatsächlich oft in theologische Haarspaltereien verstieg. Die Praxis heißt, vereinfacht gesagt, Caritas, und es ist kein Wunder, dass diese Tätigkeit heute die größte Anerkennung findet. Die Feier hingegen, die Liturgie, musste in manchen Kirchen zur Pflicht erklärt werden, weil sie häufig mit der Attraktivität anderer Festlichkeiten nicht konkurrieren kann.
Liturgie - eine Kunst
Es wäre zu einfach, dafür vorschnell einen allgemeinen Glaubensschwund verantwortlich zu machen. Denn nicht erst heute zeigt sich, dass Lehre und Praxis auseinander klaffen können, und die Praxisrelevanz des Festes, der Poiesis, nicht immer verständlich ist. Das biblische Gleichnis vom barmherzigen Samaritaner, jene Geschichte vom Mann, der unter die Räuber gefallen ist, gibt ein gutes Beispiel: Die Liturgiker - Priester und Levit - gehen vorbei, sie blenden den Zusammenhang zwischen der Poiesis, dem Gottesdienst, und der Praxis aus. Der Samaritaner hingegen tut praktisch, was notwendig ist, und was er tut, erweist sich als verantwortlich und unmittelbar sinnvoll.
Aber auch der umgekehrte Weg ist vorstellbar, nämlich sich an diese Praxis mit einer Poiesis, mit einem eigenen Fest zu erinnern. Was wäre dazu nötig? Das "Fest des barmherzigen Samaritaners" müsste gestiftet werden, und dazu braucht ein regelmäßiges Datum und eine Festerzählung (wie sie das Evangelium schon bietet), die gelesen oder szenisch dargestellt wird. Schließlich sind Symbolhandlungen unerlässlich, etwa das Verbinden von Wunden wie am Gründonnerstag die Fußwaschung. Der Gestaltungsfreude sind keine Grenzen gesetzt, und nach Jahren oder Jahrhunderten würde das Fest mit Liedern und Musik gerahmt sein und einen ausgefeilten Ablauf haben.
Erinnerung & Aufforderung
Für die Feiernden hätte eine solches Fest eine zweifache Bedeutung: die erinnernde Vergegenwärtigung eines wichtigen Ereignisses und die Aufforderung, immer neu in die Praxis umzusetzen, was der Samaritaner getan hat. Zwischen Vergangenheit und Zukunft öffnet das Fest einen Raum, in dem die Zeit stillsteht. In diesem Raum verschränken sich gestern und morgen, kann die Distanz gewonnen werden vom Alltag, kann überprüft werden, was die Erinnerung noch bedeutet, und ob ihr die Praxis vor und nach dem Fest gerecht wird.
Wo der Rückblick in erstarrte Formeln gegossen wurde und der Aufforderungscharakter des Festes nicht mehr spürbar wird, verfällt das Fest tatsächlich zum nutzlosen Ritual. Für den Gottesdienst als Fest bedeutet das: Werden in der Liturgie durch enge Vorschriften Sensitivität und Bedeutsamkeit nicht mehr erlebbar, werden kreative Adaptionen der Feiernden ausgeschlossen, ist das der beste Weg in eine unverstandene Pflichtübung oder ein Anlass zum Fernbleiben.
Die notwendige Schwelle
Die Liturgie lässt sich als der religiöse Sonderfall einer viel breiteren Erfahrung sehen. Überall, wo Gestaltung am Werk ist, wird Bedeutung sinnenfällig. Eine Bewegung von innen nach außen findet statt, was Menschen wichtig ist, wird sichtbar, hörbar, kann ertastet werden, vermittelt sich duftend oder leuchtend, gestaltet Material in Farben und Formen. Entscheidend ist die Schwelle, die zum Raum der Gestaltung überschritten wird und die einer eigenen Gestaltung bedarf: Man nimmt sich Zeit, kleidet sich festlich, verändert die innere Haltung und bedient sich nicht unbedingt alltäglicher Ausdruckformen. Es wird gesungen, geschwiegen, applaudiert.
Ein altes Bild aus den 50er Jahren zeigt ein Paar in Abendkleid und dunklem Anzug vor dem Fernseher bei der Übertragung eines Opernballetts. Das Außergewöhnliche des Fernsehens hatte seine Zeit und diese Zeit ist abgelaufen.
Das Leben - ein totales Fest
Heute wird auch für den Opernbesuch keine Krawatte mehr verlangt. Aber es bringt nichts, den strengeren Sitten von anno dazumal nachzutrauern, denn die Gefahr hat heute ein anderes Gesicht. Die Einebnung der Schwelle zwischen Alltag und Fest schadet beiden Seiten: "Nichts, das den Alltag sinnstiftend übersteigt, ist nämlich übriggeblieben, um im Modus zyklischer Erinnerung in ihn einzugreifen und ihm die grundlegende Richtung zu weisen", schreibt der Philosoph Rüdiger Bubner. In der Folge gibt es in unserer Welt einen Hang zur Ästhetisierung der gesamten Lebenswelt, zum totalen Fest.
Damit ist auf andere Weise formuliert, was der Soziologe Gerhard Schulze als "Erlebnisgesellschaft" beschrieben hat. Wenn das Ungewöhnliche allgegenwärtig wird, verdrängt es die ethische Dimension, die zur Praxis gehört. Dann kann auch erhebend und hinreißend sein, was unmenschlich ist, ja der Krieg als "totales Fest" erfahren werden, weil er die Suspension des Alltags und des Festes zugleich durch den großen Ausnahmezustand darstellt, warnt Manès Sperber.
Leben als Kunstwerk
So kann die "Nutzlosigkeit" der Kunst in Sinnlosigkeit umschlagen, und es mag verständlich sein, dass nach zwei Weltkriegen verstärkt auf die nützliche Praxis gesehen wird. Wenn damit aber die überlegte Gestaltungskraft, die etwas mit Nachdenken, mit Theorie zu tun hat, verloren geht oder unverständlich wird, fehlt uns schließlich mehr als hergebrachte liturgische Formen oder soziale Rituale.
Das Leben selbst ist zuletzt das Material der Poiesis: Es sollte nicht nur gelebt, sondern geformt, gestaltet, zu einem "Kunstwerk" gemacht werden. Und das gelingt nur, wenn das Innehalten vor dem Kunstwerk, wenn Liturgie im weitesten Sinn geübt und im wiederholten Wechsel zur Lebenspraxis erfahren wird.
Die Autorin ist Professorin für evang. Prakt. Theologie in Wien.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!