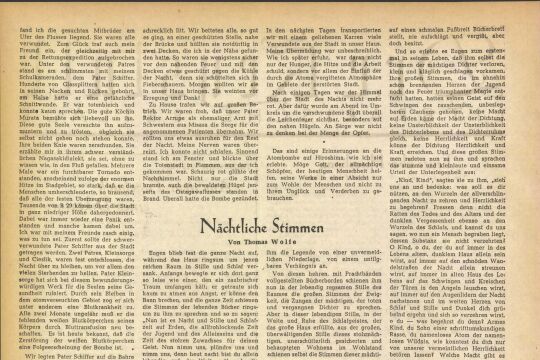Das legendäre Hobellied aus Ferdinand Raimunds "Der Verschwender“ bietet Armen eine entlastende Hoffnung: "Das Schicksal setzt den Hobel an und hobelt alle gleich.“ Ein Zaubermärchen eben. Im Alltag nivelliert das Fatum mitnichten. Das englische "fortune“ steht nicht umsonst für eine breite Bedeutungs-Klaviatur, auf welcher zum Kontrast der hochtönenden Klänge "Reichtum“, "Vermögen“ und "Glück“ meist zugleich die Bassakkorde "Schicksal“, "Zufall“ und "Fanal“ erklingen. Eine schmerzvolle Erkenntnis, nicht nur für jene, die an den "Klagemauern“ der Wall Street ihren Sinn- und Kapitalverlust abarbeiten.
Reichtum und Sozialpflichtigkeit
Reichtum muss nicht zwingend dem Leben dienen, auch wenn Reiche aus vielen Beweggründen mildtätig wirken. Übermäßiger Reichtum schreit von selbst noch nicht nach seiner Sozialpflichtigkeit. Ganz im Gegenteil. Ein beredtes Zeugnis darüber, wie es semantisch zu bewältigen ist, nackten Egoismus in herzensanrührender Schlichtheit als ausschließlich soziale Pflichterfüllung zu camouflieren, gab einst eine der halbgöttlichen Lichtgestalten des Kapitalismus, der legendäre Ölmagnat John Davison Rockefeller: "Ich glaube, die Macht, Geld zu verdienen, ist eine Gabe Gottes … die weiterentwickelt und nach unseren besten Möglichkeiten zum Wohl der Menschheit gebraucht werden soll. Ausgestattet mit der Gabe, die ich nun mal habe, glaube ich, dass es meine Pflicht ist, Geld zu verdienen und immer noch mehr Geld, und dieses Geld, das ich verdiene, zum Besten meiner Mitmenschen zu gebrauchen, entsprechend den Vorschriften, die mir mein Gewissen auferlegt.“ Vorbildlich exemplifiziert hier ein "ökonomischer Heiliger“ die Dienerschaft des Mammons.
Zur Aufrechterhaltung eines illusorischen Geldglaubens muss wohl der Möglichkeitsrahmen mit der Verheißung aufgespannt bleiben, dass unendlicher Reichtum jedermann zugänglich sei. Der amerikanische Traum vom armen Tellerwäscher zum erfolgreichen Selfmade-Millionär verleitet mitunter zum Zirkelschluss protestantischer Ethik, Gott schenke seinen Auserwählten Erfolg und daran erkenne man ihr Auserwähltsein.
Bereits in der Alten Kirche wird kritisch hinterfragt, ob die schneidende Antinomie von Gott und Mammon berechtigt sei, wo doch der Reichtum durchaus auch als Gabe Gottes gesehen werden kann. Man beruft sich dabei auf den Erfahrungsschatz des Alten Testaments, wo Reichsein auch als Gnade Gottes galt (Hag 2,8) und am Geld nichts Schädliches zu haften schien. Trägt Reichtum bloß unverbindlichen Geschenkcharakter, kann es durchaus sein, dass der Mensch sein Herz lieber ans Geld hängt, so es nicht gerade spirituelle Ausflüge zu Gott unternimmt.
Reichtumsglaube
Unter Einfluss der stoischen und mittelplatonischen Philosophie mit ihren Leitmotiven der Apatheia und Ataraxia, fand eine Unbefangenheit gegenüber Geld und Reichtum Einzug in religiöse und philosophische Überlegungen. Sie manifestierten sich in der wohl folgenreichsten Beurteilung von Reichtum in der Alten Kirche als Homilie vom reichen Jüngling "Quis dives salvetur“ (Welcher Reiche gerettet werden wird)“. Kirchenvater Clemens von Alexandrien verfasste das Traktat im dritten Jahrhundert als Auslegung von Markus 10,17-31.
Unter den wohlhabenden Menschen der prosperierenden Metropole Alexandria schien angesichts der Aussagen des Evangeliums die Angst zu grassieren, aufgrund ihres Reichtums vom eschatologischen Heil ausgeschlossen zu sein. Clemens, später auch augenzwinkernd "Beichtvater der Bourgeoisie“ genannt, wollte christgläubige Reiche zum Heil führen. Er entschärfte die Aufforderung der Perikope "und gib’s den Armen“ durch allerlei biblische Belege und Relativierungen.
Geld zu haben, ist für Clemens nicht mehr und nicht weniger gut als keines zu haben. Für ihn ist Reichtum ein eindeutig vormoralischer Begriff; ein Werkzeug, mit dem man geschickt, aber auch ungeschickt umgehen kann. Die fatale "Exklusivität“ des Reichtums als asymmetrisch verteiltes Herrschaftsmittel wirft in ihrer Ungleichheit wenig Licht und viel Schatten, denn während der Tod allen Menschen offen steht, so ist Reichtum nur einer sich im Geldglanz sonnenden Schicht vorbehalten.
Auch Goethe lässt in Faust 1 seine Margarete über die ungebrochene Inklination der Menschen zum Reichtum jammern: "Am Golde hängt, zum Golde drängt doch alles. Ach wir Armen!“ Mit Spürbarwerden der Finanzwirtschaftskrise wurde Gold heftig umschwärmt. Sein trügerischer Glanz enttäuschte mitunter. Das Paradoxon des Goldes lautet: Wenn man es am nötigsten braucht, ist es am wenigsten wert.
Hier die Probe aufs Exempel: Wien, im Hungerwinter 1945/46. Meine Großeltern kratzen die wenigen Dukaten und Goldschmuckstücke zusammen, die sie besitzen. Nur von den Eheringen wollen sie sich niemals trennen, so groß der Hunger auch sein mag. Mit dem Fahrrad klappert mein Großvater, wie Tausende andere frierende und hungrige Menschen, die nördlich von Wien gelegenen Bauernhöfe ab, in der Hoffnung, Gold gegen Nahrungsmittel eintauschen zu können. Denn auf dem Lande, so sagen alle, da haben sie wenigstens noch zu essen. Viele Türen bleiben verschlossen. Nur wenige sind überhaupt bereit, von ihren Vorräten etwas abzugeben, was nur allzu verständlich ist angesichts der großen Not und der vielen, die ihren vermeintlichen Reichtum gegen Essbares tauschen wollen. "Von deinem Gold werd’ ich nicht satt!“, heißt es vielerorts.
Brot und Speck statt Gold
Nach zähen Verhandlungen mit einem Rübenbauern im niederösterreichischen Aderklaa gibt es dann immerhin ein Glas Schmalz, ein Stück Speck und ein Glas Marmelade für eine mit Rubinen besetzte Goldbrosche, die gut und gerne einmal drei Monatsgehälter eines Verwaltungsbeamten gekostet hat. Der Wert des Goldes ist in diesem Moment auf ein Minimum, auf die bloße Erhaltung fundamentalster Lebensbedürfnisse gesunken. Die teure Brosche oder der Golddukaten sichern in dieser prekären Lage gerade einmal das nackte Überleben. Selbst für Reiche zählt in diesen Tagen bloß die Währung Brot und Speck. Hier zeigt sich mit aller Vehemenz die Relativität und Kontextgebundenheit der Definition von Reichtum.
Reich in Notzeiten ist, wer auf Freunde und soziale Netzwerke zählen oder einen Garten zum Anbau von Lebensmittel nutzen kann. Das mag banal und moralisierend klingen und umhüllt vielleicht nur, was im Innersten erträumt und nicht gerne bekannt wird. Denn Hand aufs Herz: Wer will nicht reich sein, wer stimmt nicht gerne ein, in Milchmann Tevyes Liedzeile "Wenn ich einmal reich wär …“ aus dem Musical Anatevka. Nicht selten verachten reich Gewordene ihre früheren ärmlichen Verhältnisse. Ein englisches Diktum führt dies vor Augen: "The working class can kiss my ass, I got the foreman’s job at last.“ Bitterer Sarkasmus will den einst gefühlten Schmerz in den Spinden der Erinnerung für immer einsperren. Was, wenn wir sind, wie wir sind - und darüber nur die Schminke soziokultureller Konformität?
* Der Autor ist promovierter Theologe, Public Affairs- und Medienberater und spezialisiert auf Microfinance
Was heißt hier reich?
"Geld regiert die Welt“, heißt es. Doch was bedeutet tatsächlich Reichtum - oder Armut? Und wie haben sich unsere Vorstellungen von Luxus im Laufe der letzten Jahrzehnte verändert? Über den langwierigen Kampf gegen den Schuldenberg, die Glücksspiel-Falle und über neue Visionen von einem guten Leben auf einem Planeten mit begrenzten Ressourcen.
Redaktion Sylvia Einöder, Oliver Tanzer
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!