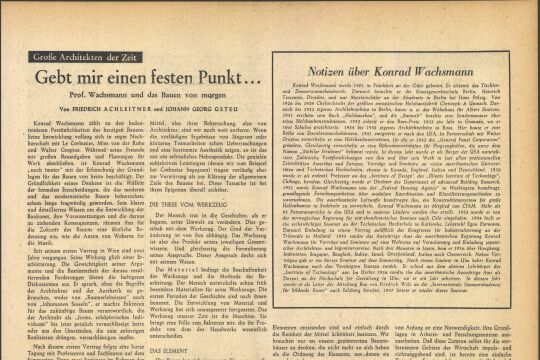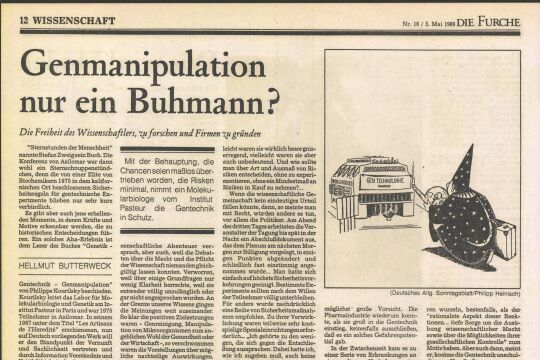Zwischen den Stühlen
Der Befund, wonach Gesellschaften Probleme und die Unis Disziplinen haben, gilt mehr denn je. Interdisziplinäre Arbeit kann Abhilfe schaffen.
Der Befund, wonach Gesellschaften Probleme und die Unis Disziplinen haben, gilt mehr denn je. Interdisziplinäre Arbeit kann Abhilfe schaffen.
Wer interdisziplinär forscht, kann etwas erleben. Warum das? Wenn wissenschafter fächerübergreifend arbeiten, tun sie das meist in Projektteams. In solchen Teams finden sich Forscher und Forscherinnen aus den verschiedensten Disziplinen zusammen. Aber das ist leichter gesagt als getan.
Vor einiger Zeit fand ein Workshop eines fächerübergreifenden Forschungsprojekts statt, das sich mit der Umweltgeschichte der Donau in Wien befasste. In der Einstiegsrunde wurden alle darum gebeten, kurz darzulegen, was denn für sie "die Donau" ist - aus ihrer fachlichen Perspektive heraus. Worauf ein Historiker meinte: "Die Donau ist all das, was Komponisten, Landschaftsmaler und andere in den vergangenen Jahrhunderten zur Donau gemacht haben, quasi 'die schöne blaue Donau'." Für den Fluss-Morphologen dagegen hatte die Donau zunächst einmal eine ganz konkrete Gestalt und einen bestimmten Verlauf, was auf geologische und andere natürliche Einflüsse zurückgeführt werden kann. Die Donau als gesellschaftliche, kulturelle Konstruktion oder als natürliches Faktum? Oder beides? Wie auch immer: Wenn Forschende in interdisziplinären Teams auf ihren Forschungsgegenstand schauen und über ihn sprechen, tun sie das nicht in derselben Art und Weise.
Pluralität der Perspektiven
Der Umwelthistoriker Martin Schmid hat ebenfalls in diesem Projekt mitgearbeitet. Jahre zuvor hat er gemeinsam mit Kollegen aus anderen Disziplinen die Wissenschaften selbst erforscht. Die Forschergruppe unter Leitung des Philosophen Markus Arnold interessierte sich dabei für verschiedene Fachdisziplinen als je eigene Wissenschaftskultur. Dahingehend wurden auch Vorlesungen an der Universität Wien besucht. Schmid erinnert sich: "Als Historiker beobachtete ich eine Einführungsvorlesung zur Experimentalphysik. Ein hinter mir sitzender Physik-Student versuchte meiner Mitschrift zu entnehmen, was er selbst nicht mehr rechtzeitig von der mittlerweile gelöschten Tafel abschreiben konnte. Er war verblüfft. Statt Gleichungen fand er Satzfragmente unter Anführungszeichen, aber keine Formeln. Er besprach das mit seinen Sitznachbarn, beide kicherten. Sie mussten mich für einen unbegabten Physikstudenten halten."
Der Uni- und Wissenschaftsbetrieb ist vorwiegend disziplinär organisiert. Man studiert ein bestimmtes Fach, beispielsweise Geschichte oder Physik, schreibt dort seine Masterarbeit und Dissertation. Wenn man eine Forscherkarriere eingeschlagen hat, veröffentlicht man seine Ergebnisse in den Publikationsorganen jener wissenschaftlichen "Community", der man sich zugehörig fühlt und in der man auch verstanden wird. Im Zuge ihrer jeweiligen Sozialisation lernen Forschende, wie man Wissenschaft "richtig" denkt und betreibt. Nur: Was für die eine Disziplin richtig ist, mag für eine andere falsch sein. Wie auf "Wirklichkeit" und "Wahrheit" geschaut wird, welche Theorien, Konzepte und Begriffe adäquat sind, um eine komplexe Realität zu ordnen, wie etwas methodisch bearbeitet wird, in welchen Formen letztlich wissenschaftliches Wissen generiert wird und wie die Ergebnisse zu Papier gebracht werden, ob in Form von Zahlen, Formeln, Modellen oder Erzählungen -darüber ließe sich endlos zwischen den Disziplinen streiten. Auch darüber, ob Forschungsergebnisse, damit sie als wissenschaftlicher Erkenntnisgewinn gelten, valide und wiederholbar sein müssen oder "nur" plausibel und nachvollziehbar.
Die kulturellen Unterschiede in der Wissenschaftswelt befinden sich meist in einem Zustand friedlicher Koexistenz, weil der Forschungsalltag ohnehin vorwiegend auf ein bestimmtes Fach ausgerichtet ist. Man lässt sich wechselseitig in Ruhe. Herausfordernd wird es dann, wenn fächerübergreifend geforscht werden will. Auch die gelernte Medizinerin Katharina Heimerl kennt als Leiterin des Instituts für Palliative Care und OrganisationsEthik der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt (Wien und Graz) diese Herausforderung. Ihre Mitarbeiter decken eine große Palette wissenschaftlicher Kulturen ab, denn sie kommen aus unterschiedlichen Geistes-, Sozial- und Naturwissenschaften. "Sich auf ein gemeinsames Forschungsvorhaben zu einigen, ist ein unglaubliches Abenteuer. Das Missverständnis ist von vornherein einfach mitgebucht - es sitzt als ein eigenes Teammitglied mit am Tisch." Heimerl ergänzt: "Ich wundere mich jedes Mal, dass es gelingt, uns über eine methodische Herangehensweise überhaupt einigen zu können."
Wie kann eine solche Einigung gelingen? Interdisziplinäres Arbeiten braucht eine Kommunikationskultur zwischen den Forschenden, die sich nicht nur an der klassischen wissenschaftlichen Diskussion orientiert. Dessen Ende und Ergebnis ist oft eine eindeutige "Wahrheit", nachdem sich halt die "besseren" Argumente oder der Status der Sprechenden durchgesetzt haben. Interdisziplinäre Teams benötigen zunächst einen interkulturellen Dialog, um das jeweilige Gegenüber, aber auch sich selbst besser zu verstehen. Wie tickt ein Historiker, wie eine Medizinerin? Die Hoffnung dabei ist, dass anerkannt wird, dass die eigene wissenschaftliche Perspektive zwar eine legitime, aber eben nur eine und nicht die einzige sinnvolle Beobachterposition ist.
Suche nach Schnittstellen
Ein Fluss-Morphologe und eine Historikerin werden sich wohl nie einigen können, was die Donau denn nun "wirklich" ist. Sie werden sich wohl ebenso nicht darüber einigen können, ob nun "die Natur" oder "die Gesellschaft" die jeweils treibende Kraft ist. Aber vielleicht können sie sinnvolle Schnittstellen identifizieren sowie gemeinsam Fragestellungen, Begrifflichkeiten und einen bestimmten Methoden-Mix entwickeln, wie Martin Schmid erläutert: "Traditionen eines Fachs, die Frage nach der Relevanz des eigenen Tuns zu beantworten, zählen ja wenig bis nichts in anderen Disziplinen. Daher müssen interdisziplinäre Teams bewusst und gemeinsam entscheiden, wie sie arbeiten und auch warum ihre Arbeit wichtig ist." Aber solche Verständigungsprozesse zwischen den Wissenschaftskulturen sind aufwendig und brauchen ihre Zeit.
Aber warum ist interdisziplinäres Forschen wichtig? Wozu der Zeitaufwand? Historiker Schmid wird nicht müde zu betonen, dass diese Art der Forschung kein Selbstzweck sein darf. Sie bedarf stets einer Begründung: "Umweltgeschichte, wie ich sie faszinierend finde, kann eigentlich nur von Historikern und Naturwissenschaftlern gemeinsam gemacht werden. In meiner Ausbildung habe ich nichts von der Natur gelernt. Als Historiker brauche ich die Naturwissenschaft, um ein Objekt wie die Donau so weit zu verstehen, dass ich darüber arbeiten kann." Eine solche Zusammenarbeit zwischen Geistes-, Sozial- und Naturwissenschaften brauche übrigens der ganze Bereich der Umwelt- und Nachhaltigkeitswissenschaften.
Viele aktuelle Probleme werfen heute Fragen auf, auf die einzelne Disziplinen allein keine Antwort haben. "Die Welt hat ihre Probleme, die Universitäten aber haben ihre Departments", so brachte es einmal der amerikanische Sozialforscher Garry Brewer auf den Punkt. Das ist der große Auftrag an fächerübergreifende Ansätze: Denn Wissenschaft, die sich an der Lösung dieser Probleme orientiert, ist heute notwendigerweise interdisziplinär.
Der Autor ist Historiker am Inst. für Wissenschaftskommunikation und Hochschulforschung der IFF der Uni Klagenfurt
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!