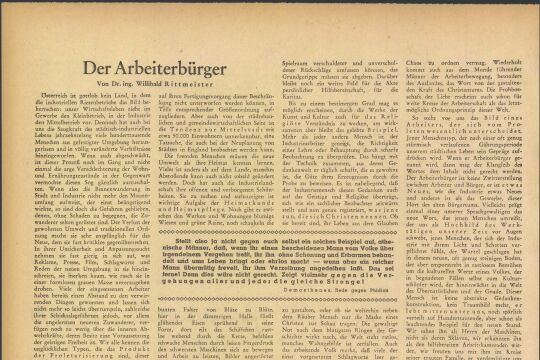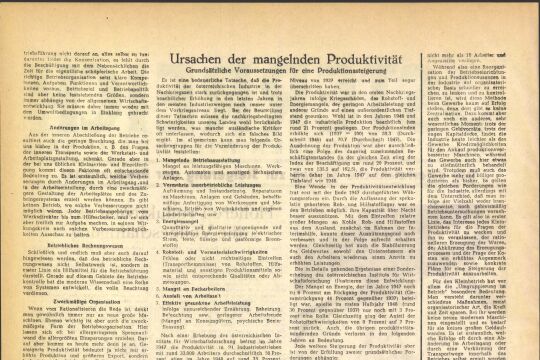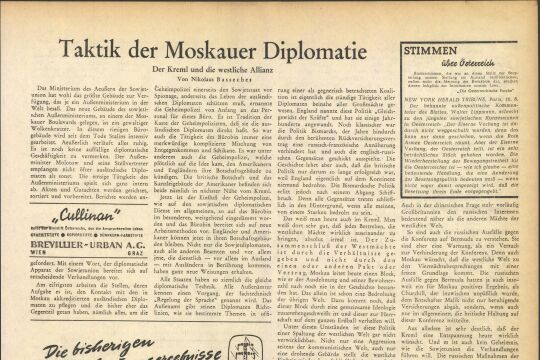Eine Politik neoliberaler Prägung hat der Wirtschaft jene Instrumente in die Hand gegeben, die nun zu einer Gefahr für das gesamte System geworden sind. Analyse eines Soziologen.
Mit dem überzeugenden Argument, ein Staat müsse schlank sein, wurde lange vor der Finanz- und Wirtschaftskrise Schritt für Schritt eine neue Bewusstseinslage hergestellt. So konnte man ins Schwärmen geraten, nicht mehr der Staat habe den Bereich der Ökonomie zu ordnen, sondern der Markt sei das bessere, weil objektive Instrument. Die Rolle des Marktes gewann in allen Debatten eine Bedeutung, die man bislang vergleichsweise in der Ägyptologie einem Pharao zugeschrieben hatte. Die nahezu göttlichen Eigenschaften des Marktes hatten einerseits die segensreiche Wirkung des Wettbewerbs, ermunterten zur kollektiven Anstrengung, andererseits versprachen sie, ökonomisch relevante, aber willkürlich gesetzte Grenzen zu durchbrechen, ja sogar eine erwünschte „Multikulturalität“ zu fördern, die mit dem Warentausch begann und mit der Freizügigkeit am Arbeitsmarkt zur Vollendung aller Liberalität führt.
Der Markt war als Terminus in aller Munde, seine Funktionen diktierten selbst die kulturelle Ausstattung der Gesellschaft in der Schulpolitik und disponierten über den Rang sozialer Werte. Somit war Staatseigentum zu privatisieren. Es war erstaunlich, dass wesentliche politische Kräfte diesen Markt zum „Dogma“ erklärten, zwar etwas großsprecherisch, aber wirksam, wenn im Lippenbekenntnis beteuert wurde, wir alle seien die „Wirtschaft“.
Nun begünstigten die neuen politischen Rahmenbedingungen der Europäischen Union das Ideal eines sich selbst regulierenden Marktes – mit Ausnahme der Landwirtschaft. Die einzelstaatlichen Kompetenzen wurden Stück für Stück nach Brüssel übertragen. Die Folge war, dass sich die europäische Ökonomie von der Politik emanzipierte – der große Unterschied zu den USA, in denen eine oft kritisierte Reziprozität erhalten blieb.
Ökonomisch-politisches Ungleichgewicht
Das Ungleichgewicht zwischen Ökonomie und Politik in der EU war recht positiv gesehen worden, weshalb die neuen Kriterien erfolgreichen Wirtschaftens ein Tugendmythos wurden. Daran waren die Medien nicht unbeteiligt, da sie die Jahressieger im Wettlauf um ökonomischen Erfolg regelmäßig feierten. Und die Sieger waren stets Manager diverser Konzerne, die mehrheitlich zur „Schlüsselindustrie“ Europas zählten. Sagenumwobene Tausendsassas hatten sagenhafte Umsätze und Gewinne erzielt.
Allerdings stammten diese Erfolge nicht oder nur geringfügig aus produktiven Unternehmungen, sondern eben aus Spekulationsgewinn. Die Manager folgten dieser überraschend erfolgreichen Gewinnmaximierung, da ja in Werkhallen weniger zu „gewinnen“ war als durch spekulative Anlagen.
Nun muss man in diesen Vorgang mehrere Faktoren einbeziehen. Arbeit war ja in Europa unermesslich teuer geworden und die Klage über sinkende Konkurrenzfähigkeit erschütterte selbst Gewerkschaften. Die Manager hatten daher erlernt, dass nur „Cleverness“ Erfolg garantiert, und die war recht gut anzuwenden dank der Liberalisierungen und ideenreichen Interessenverlagerungen, die der alte Staat früher behindert und besteuert hätte. So waren Konzerne in Subunternehmen, Töchtern und Filialen aufgeteilt worden, während die Gewinne auf exotischen Inseln geparkt wurden.
Die Transformation von Produktivität in verästelte Beziehungsgeflechte wurde durch die elektronische Revolution unglaublich gesteigert. Das hatte die Manager bestärkt, neue Wege des Profits zu beschreiten, da Kapitalanlagen bei Weitem höheren Nutzen bringen als jede Produktivität in den Fabriken. Und die Banken versprachen das Blaue vom Himmel, so im Portefeuille die Wertpapiere gut gestreut sind. Leider haben die Banken schließlich ihren eigenen Werbeprospekten zu viel Glauben geschenkt
Das ist aber nur die eine Seite der Medaille. Im Zuge der elektronischen Revolution war die vormalige und patriarchalisch anmutende Betriebsstruktur nicht mehr zu halten. Die Manager verloren gleichsam den Boden unter ihren Füßen. Betrachtet man alte Industrieanlagen, so wird man regelmäßig am Gelände einen Backsteinbau finden, in dem einmal der Eigentümer lebte. Außerdem ermöglichte der Schwund an Mitarbeitern, die ja wie ein teurer Klotz am Bein der Betriebe hingen, eine „flache“ Hierarchie, die gern für eine Demokratisierung betrieblicher Organisation gehalten wird. Dieser Wandel wurde als verbesserte Zusammenarbeit und größere Vertraulichkeit beschönigt, die Kehrseite zeigte aber Tendenzen zu Seilschaft und Kameraderie. Dank Kommunikationselektronik sind immer alle „online“, jedoch nahm das Phänomen von „mobbing“ und Informationsverweigerung zu. Diese neue Arbeitswelt prägte die Manager, machten sie einerseits umgänglicher und geübt im distanzlosen Sprachgebrauch, andererseits wurde kritische Distanz, erwogenes Bedenken eingebüßt. Das Ergebnis lautet in Kurzform, dass Betriebsinteressen und Aktionärsinteressen einander nicht mehr entsprechen. Der Manager sieht sich in diesem Konflikt zu geschickten Machenschaften gezwungen, in denen er eher Komplizen als Mitarbeiter benötigt. Und weil das so ist, war der Anreiz des Spekulierens und Schwadronierens an den Finanzmärkten begünstigt worden. Die Kraft der Innovation war geschwächt, denn zum einen war sie mit der Modernisierung der Datenverarbeitung verwechselt worden, zum anderen schien die betriebliche Erfahrung älterer Mitarbeiter verzichtbar. Die Konzerne werden nun von Menschen geleitet, die einer sehr homogenen Alterskohorte angehören, denen betriebliche Tradition, Produktqualität und zuverlässige Erzeugung nicht mehr geläufig ist. Manager haben zwar ihre ökonomischen und sozialwissenschaftlichen Ausbildungen erhalten, ihre Spezialisation in postgradualen Kursen, wie hingegen ein Turnschuh an den Fuß einer Konsumentin kommt, ist ihnen – grob gesagt - ein Rätsel.
Der Verrat der Politik
Der Verzicht auf Berufserfahrung, die sich ja vornehmlich in der Erzeugung als wertvoll erwies, wurde betriebswirtschaftlich als Kostenfaktor diagnostiziert, also ist die Entscheidung relativ einfach, sich von älteren Mitarbeitern zu trennen, wodurch eine Quelle von Einsparungen aller Art eröffnet wird, die umgehend die Aktienkurse steigen lassen. Regelmäßig ist es der Inhalt der Eröffnungsrede eines neu bestellten Managers. Dennoch wird man hier recht bald die Schattenseite erkennen können. Manager, die dieses fremde Eigentum zu verwalten beginnen, wissen von der ersten Stunde an, dass sie unter gehörigem Druck stehen. Sie haben ein ähnliches Schicksal wie Fußballtrainer. Also handeln sie enorme Summen an Abstandszahlungen aus, die deren Zukunft sichern helfen, doch zeigen diese Forderungen zugleich das Bild, dass sie mit dem Konzern kein langes Berufsleben verbinden wird. Somit ist die Tätigkeit nur als kurzer Lebensabschnitt verstanden, an der kein Herz hängt und der früher propagierten „corporate identity“ widerspricht. Diese ist jetzt ein historisches Relikt. Die Fähigkeit des Managers liegt im Taktieren und Lavieren, in geschickter Schönung des tatsächlichen Zustands einer Firma, in deren Schatten zuweilen die Gefahren von Korruption und Konkurs lauern. Es ist das Ende des historischen Gesellschaftsvertrags zwischen Kapital und Arbeit.
Manager ist also jener, der die psychische Disposition besitzt, sich innerhalb einer virtuell gewordenen Arbeitswelt für kurze Zeiträume zu halten. Er ist das Erfolgsprodukt des Ungleichgewichts von Politik und Ökonomie, von jenem Emanzipationsprozess, den die EU vermutlich unabsichtlich einleitete. Und die „Politik“ ließ sich obendrein verführen, nach dem Ende ungewisser politischer Karriere ein Vorstandsmitglied zu werden, also die Politik an diese „Ökonomie“ zu verraten. Es ist tatsächlich die Krise.
* Der Autor ist Professor für Soziologie an der Universität Wien
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!