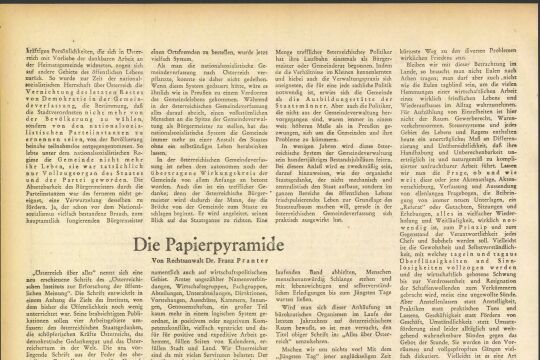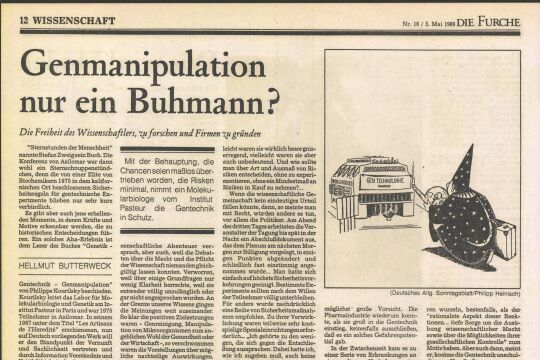Wenn man nicht mehr weiter weiß, dann evaluiert man erstmal." So kommentieren mittlerweile viele den allgegenwärtigen Versuch, Transparenz herzustellen. Evaluationen scheinen unverzichtbar, weil sie zeigen sollen, was wir noch "optimaler" machen könnten. Die permanente Rückversicherung, ob wir das Richtige tun -und dies auch richtig messen - ist symptomatisch für das schon in die Jahre gekommene "Public Management".
Seit Anfang der 1990er-Jahre mehren sich Studien, die zeigen, dass wir in einer "Audit Society" (Michael Power) leben, in der immer mehr beobachtet und immer weniger gehandelt wird. Mancher Schuldirektor ist dabei zum Verwaltungsprofi geworden und viele Wissenschafter zu Qualitätsmanagern. Meta-Evaluationen, also Studien über Evaluationen, zeigen: Teilweise werden doppelt so viele Personen mit der Bewertung von Lehrleistungen beauftragt als es Lehrbeauftragte gibt. Oder ein Projekt zur Lehrverbesserung wird von sechs anderen Projekten gleichzeitig evaluiert.
Wenn fast genau so viel Zeit - manchmal sogar mehr -für das Dokumentieren wie für das faktische Tun anfällt, dann bringt die so genannte "Evaluationitis" öffentliche Güter in bedenkliche Schieflagen. Denn das Kosten-Nutzen-Verhältnis von Evaluation selbst wird hochgradig prekär und damit rechenschaftspflichtig. Das gilt besonders dort, wo im vorauseilenden Gehorsam evaluative Bögen überspannt und regelrechte "Legitimationsfassaden" aufgebauscht werden, wie sie der Organisationsforscher Nils Brunsson sehr schön beschrieben hat. Diese Schaufenster-Evaluationen werden von der Politik bereits zaghaft kritisch beäugt, zum Beispiel durch Auftragsforschungen der Bildungsministerien, die es auf den Nachweis des Nutzens von Evaluation selbst abgesehen haben. Doch zugleich ist es gerade auch die Politik, die von der Legitimationsdienstleistung der Evaluation profitiert.
Politisches Katz-und-Maus-Spiel
Evaluation und Qualität sind zudem so hochelastische "Plastikworte" (Uwe Pörksen), dass sie für scheinbar alles herhalten können. Wozu Evaluation da ist, sei ja so klar, dass man gar nicht mehr darüber reden müsse. Doch haben Inspektionsverfahren nicht von sich aus Zwecke, sondern sie werden ihnen zugewiesen - wenngleich oft nur vage und austauschbar. Leistungsbewertung kann einmal im Dienste der Partizipation oder der Kontrolle stehen, ein anderes Mal im Dienste der Forschung, der Beratung oder der Intervention.
Doch ob Evaluation tatsächlich die Qualität von Abläufen verbessern hilft, hängt wesentlich davon ab, ob die ihr zugewiesene Aufgabe von den Beteiligten akzeptiert und getragen wird. Dient sie der Selbst-oder der Fremdsteuerung? Soll sie eingreifend sanktionieren oder zunächst nur dem Lernen dienen? Wenn die politische Funktion der Evaluation stets hin-und herchangiert, lädt sie ein zum politischen Katz-und-Maus-Spiel -und entfaltet eine fast anarchische Kraft. So kann eine berechtigterweise eingeforderte Versicherung über die Qualität sozialer Dienste zur für alle teuren Dauer-Verunsicherung werden.
Neben den Kosten der Herstellung von Transparenz und ihrer politischen Instrumentalisierbarkeit besteht ein weiteres Dilemma darin, dass Rechenschaftslegung voraussetzungsvoller und zugleich disponibler wird: Was eben noch (nur) ein fiskalisches Argument war, ist im Nu ein moralisches. Was eben noch unhinterfragbar war, wird plötzlich ökonomisch begründungspflichtig. Folgt man der Anthropologin Marilyn Strathern, so verändern sich Inspektionsstile dahingehend, dass Rechenschaft verschoben wird: auf Einzelne oder Teilbereiche, die "sich nicht mehr rechnen". Beim neuen Steuern hat sich das Verhältnis zwischen Staat und Individuum verändert.
Evaluationen zollen und entziehen Anerkennung für Leistungen, allerdings immer nur auf Zeit und bis zur nächsten Evaluationsrunde. Wo die Bewertungen als Möglichkeit dienen, sich elegant vor Verlässlichkeit zu drücken, verflüchtigt sich Verantwortung. Und hier übernehmen Evaluationen eine wichtige Schlüsselrolle des Offenhaltens -aber auch des Aufbrechens.
Organisationen besitzen die besondere Gabe, sich aussuchen zu können, was sie entscheiden und was sie eine zeitlang unentschieden lassen möchten. So bleiben sie flexibel für neue Anfragen ihrer Umwelt. Vielleicht liegt in diesem Uneindeutig- Lassen das gewaltigste Potential von Evaluation für so genannte "Entscheidungsträger": Sie können sich möglichst viele Optionen offen halten - bei geringen Risiken. Die legitimsten Führungsleistungen sind dann die immer noch nicht ganz entschiedenen. Ob die Erosion von Entscheidungsverantwortung nun Chance oder schon Risiko ist, zeigt sich dann wohl nur am konkreten Einzelfall. Ebenso, was unter dem Qualitätsbegriff firmiert und wie dieser die widersprüchlichen Anforderungen an Bildungsprozesse abzudecken vermag (zum Beispiel weniger Drop-Out bei höherem Leistungsniveau, Inklusion bei gleichzeitiger Standardisierung).
Trotz allen aufgenötigten Strebens nach Sichtbarkeit von Leistung ist kaum bestreitbar, dass Qualitätsnachweise wichtig sind - erst recht, wenn sich der Staat von bisherigen Aufsichtspflichten löst. Paradoxerweise braucht man gerade angesichts dieses Rückzugs legitime Entscheidungsinstrumente, um weniger Mittel besser verteilen zu können. Diese Versuche, Entscheidungen zu legitimieren, verkehren sich in der Praxis häufig ins Gegenteil, also in die strukturelle Vermeidung von Entscheidungen. Trotz aller Verbesserungs-und Emanzipationschancen durch Evaluation können deren Risiken und Nebenwirkungen nicht mehr ignoriert werden. Gerade wegen der unzähligen Willkürakte, die das scheinbar transparente "New Public Management" bietet, gelte es, bürokratische Überbleibsel zu wahren, wie der Soziologe Paul Du Gay mahnt.
Das Evaluationsritual als Politik
Aus historischer Sicht sind die heutigen Transparenz-Apparate und ihre neuen Legitimationsformen einerseits bloß ein winziger Schritt in einem langen Prozess, die Welt zu verwissenschaftlichen und -mit Verweis auf angeblich parteilose Zahlen -zu entzaubern. Andererseits entpuppt sich das moderne Evaluationsritual heute ganz unverblümt als Politik, die immer wieder neuen Konsens über Verteilungskriterien produzieren muss und somit darüber, welche Werte zu einem bestimmten Zeitpunkt als legitim erachtet werden und welche nicht mehr. Wie im religiösen oder stammesgesellschaftlichen Ritual muss das nun demonstrativ für alle immer wieder neu inszeniert werden.
Wegen dieser Ambivalenz von Entzaubern und Verschleiern gilt es, Evaluation sowohl zu verteidigen als auch zu kritisieren -manchmal sogar gegen ihre Befürworter und Gegner. Dies besonders dann, wenn Evaluationsrituale Lehrer daran hindern, Wichtiges möglichst gut zu tun, wie etwa die Erziehung zur Mündigkeit. Und die kann es nicht geben ohne Kraft zum Widerstand. Ein mündiger Umgang mit Evaluation bedeutet jedenfalls, sowohl Willkür-Entscheidungen als auch das verantwortungslose Aussitzen von Entscheidungen zu verhindern. Denn nur so liefert Evaluation einen Beitrag zur Demokratie.
Die Autorin ist Soziologin. Sie forscht und lehrt an der Leibniz-Universität Hannover.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!