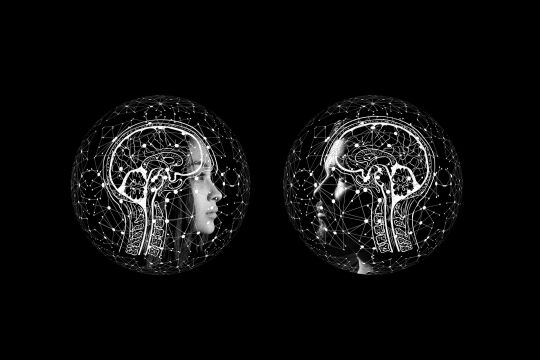Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
„Fortschritt fällt nicht vom Himmel"
DIEFURCHE: Die Verfechter des Binnenmarktes kündigten einen Konjunkturboom an Heute steckt die europäische Industrie in einer tiefen Krise. Wo ist der Boom geblieben^ LOTHAR SPÄTH: Den Boom hat es vordergründig ja gegeben. Zum einen hatten wir eine internationale Hochkonjunktur, die natürlich auch Europa begünstigt hat. Zum anderen haben die Unternehmen mit der Einführung des Binnenmarktes kräftig investiert, allerdings nur, und das ist der Punkt, innerhalb der Europäischen Union, also in einer Art europäischem Kreisverkehr. Von insgesamt 84 Milliarden Dollar Investition blieben 1991 drei Viertel innerhalb der Europäischen Union, knapp ein Viertel ging in die USA. In den asiatischen Ländern sind die europäischen Unternehmen dagegen kaum präsent. Nur vier Milliarden Dollar wurden in Asien und in die EFTA-Staaten investiert.
Diese Zahlen zeigen auch, daß die Europäische Union die Globalisierung der Weltwirtschaft glatt verschlafen hat. Diese kumulative Entwicklung hat die strukturelle Krise Europas zehn Jahre lang zugedeckt. Nun ist der Krückstock, auf den wir uns gestützt haben, zusammengebrochen, und der Patient Europa noch wackliger als vorher.
DIEFURCHE: Sie sprachen kürzlich sogar von einer neuerlichen „Eurosklerose". Kann es überhaupt noch ein Comeback für die Industrie geben? SPÄTH: Grundsätzlich brauchen wir wieder mehr Risikobereitschaft, mehr Mut Neues zu entwickeln und zuzulassen, statt ängstlich von der Ehrentribüne aus zuzusehen, wie sich die Welt um uns herum verändert. Risher war allerdings die Erhaltungsmentalität größer als die Erneuerungsmentalität. Ein Grund, warum Europa so viele Probleme hat, ist, daß in die Entwicklung und Fertigung neuer Produkte und in Schlüsseltechnologien viel zu wenig investiert wurde und stattdessen konventionelle Technologien immer mehr jerfektioniert wurden. Dazu ?am, daß die staatlichen Auflagen, Bestimmungen und Gesetze so streng sind, daß deutsche Unternehmen etwa ihre Forschungen in der Gentechnik fast ausschließlich in den USA betreiben.
Was heißt das für die Zukunft? Als erstes müssen die Europäer den Forschungsrückstand in den sogenanten Top Technologies aufholen, zumindest verkürzen. Das heißt, daß die Politik dafür den passenden Rahmen schaffen muß. Ich kann mir vorstellen, daß man die bisher komplizierten Genehmigungsverfahren, beispielsweise in der Gentechnik, vereinfacht und schneller macht. Grundsätzlich gilt: die Büro-kratisierung muß abgebaut, die Gesetzgebung vereinfacht und vereinheitlicht, die Verwaltung effizienter und schneller werden. Und wenn ich von Risikobereitschaft spreche, dann müssen die Staaten der EU für innovative Produkte, Verfahren und Techniken wesentlich mehr Risikokapital bereitstellen als bisher, um neue Unternehmen zu fördern. Außerdem müssen wir in Europa mehr Gewicht auf die anwendungsbezogene Forschung legen und die Förderung in diesen Bereichen gleichzeitig mit der Auflage verbinden, daß zu einem genau festgelegten Zeitpunkt auch brauchbare Ergebnisse feliefert werden.’ )ie Strukturkrise zeigt uns aber auch, daß die Hochlohnländer einen stärkeren Wandel von der Produktion zu den Dienstleistungen vollziehen müssen. Im Prinzip sind die Europäer für die neuen internationalen Herausforderungen nicht schlecht gerüstet. Aber der Europäisierung muß jetzt die Globalisierung folgen. Europa hat gute Karten. Sie müssen nur endlich richtig ausgespielt werden.
DIEFURCHE: In welchen Bereichen hat die europäische Industrie überhaupt noch Chancen gegenüber Japan und USA? SPÄTH: Zunächst natürlich in den Branchen, in denen wir Europäer eine starke Basis besitzen: Fahrzeug- und Maschinenbau, Elektrotechnik, Chemie. Hierauf bauen doch alle Zukunftstechnologien auf, seien es das Elektroauto und die Magnetschwebebahn, flexible Fertigungssysteme, Mikroelektronik, Bio- und Gentechnologie oder neue Werkstoffe.
Unser Problem liegt nicht in den Fähigkeiten und Voraussetzungen, sondern in unserer mangelnden Entwicklungsdynamik - und zwar weniger in technischer, sondern vielmehr in gesellschaftlicher Hinsicht. ¥& ist doch nicht so, daß wir die Gentechnik nicht beherrschen in Europa: Wir wollen sie nur nicht. Oder daß wir in der Mikroelektronik nicht mithalten könnten: Europa steckt lieber Milliarden ECU in Agrar- und Stahlsubventionen, als schlagkräftige Programme in dieser Zukunftsindustrie zu starten. Fortschritt fällt doch nicht wie Manna vom Himmel. In den USA hat man schon unter Reagan eine nationale Offensive mit dem Ziele der „World Leadership in Microelectronics" gestartet. Dagegen ist das europäische JESSI-Programm ein müder Abklatsch.
DIEFURCHE: Sie haben kürzlich in der österreichischen Zeitschrift „Industrie" gemeint, es fehlen die großen Visionen für Europas Industrie im Jahr 2000. Haben Sie denn welche? SPÄTH: Die Europäer müssen sich auf das besinnen, was sie gegenüber Japanern und Amerikanern auszeichnet, nämlich das Denken in Systemzusammenhängen. Wir brauchen im dichtbesiedelten Europa dringend neue, integrierte Verkehrssysteme mit satellitengesteuerten Leitsystemen. Wir brauchen ebenso eine europäische Integration von Datennetzen, mit denen der Informationsaustausch vom Atlantik bis zum Ural abläuft. Um solche großen Zukunftsinfrastrukturen schaffen zu können, müssen die Europäer aber noch viel stärker ihre nationalen Eigenbröteleien überwinden und zusammenarbeiten. Dabei dürfen sie sich nicht nach außen abschotten. Die Aufnahmen der EFTA-Staaten, unter ihnen Österreich, bringt die Union wirtschaftlich und technologisch voran. Ebenso gehören die Reformstaaten in Osteuropa in die Zukunftsplanungen hinein, weil sich dort völlig neue Möglichkeiten der industriellen Zusammenarbeit eröffnen. Ohne die osteuropäischen Billiglohnländer haben wir gegen die Tandems Japan-Südostasien und USA-Mexiko langfristig keine Chance.
ÜIEFURCHE: Bleibt die Industrie überhaupt der Schlüsselsektor der Wirtschaß? Der tertiäre Sektor ist im Wachsen SPÄTH: Die Konsequenz, die wir aus der derzeitigen Strukturkrise ziehen, heißt: Die Hochlohnländer werden wahrscheinlich trotz der Förderung neuer Produkte und Technologien nicht mehr so viele neue Arbeitsplätze schaffen können wie verlorengehen. Wir werden zum Teil Arbeitsplätze mit hoher Wertschöpfung schaffen. Aber diese Zahl reicht nicht mehr aus, um alle Produktionsarbeitsplätze halten zu können. Das bedeutet, der tertiäre Sektor wird in Zukunft eine viel größere Rolle spielen, egal, ob es sich um kom-)etenzintensive oder einfache Dienstleistungen handelt. In Amerika arbeiten heute 76 Prozent der Menschen in Dienstleistungsjobs. In Europa wird die Entwicklung ähn-ich sein. Damit werden allerdings eine Reihe von sozialen Spannungen verbunden sein, und die entscheidende Frage wird sein: Wieviele soziale Spannungen halten wir aus? Die I.eute, die in kompetenzintensiven Dienstleistungsberufen arbeiten, werden natürlich viel höhere Einkommen beziehen als die I^ute, die einfachere Dienstleistungsjobs machen. Das heißt, die Einkommensunterschiede werden stärker auseinanderdriften. Außerdem sind viele Menschen durch die hohen Sozialleistungen, die beispielsweise in Deutschland bezahlt werden, heute nicht bereit, einfache Dienstleistungsjobs anzunehmen. Ergebnis davon ist, daß die Sozialsysteme auf Dauer nicht finanzierbar sind. Wir müssen ein System entwickeln, damit auch die schlechter bezahlten Arbeitsplätze attraktiver werden. Die Amerikaner haben es vorgemacht. Sie haben in den letzten zehn Jahren durchschnittlich zehn Prozent ihres Realeinkommens verloren, aber zahllose Jobs, vor allem in den einfachen Dienstleistungen, geschaffen.
Die fragen stellte Elfi Thiemer.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!





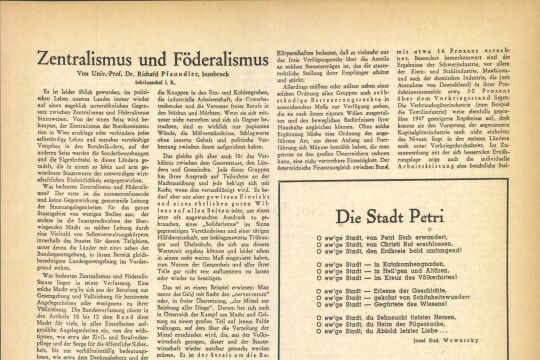























































































.png)