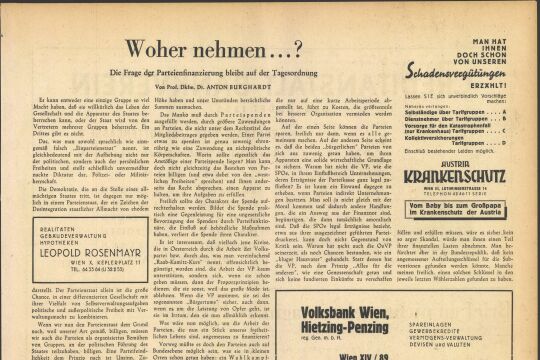Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Geld fur die Parteien
Das für Österreich akut gewordene Problem der Parteifinanzierung wurde bereits in dem Artikel „Das große Dilemma“ („Furche“ Nr, 5/1967) kurz angeschnitten. Die folgenden Ausführungen beleuchten die grundsätzlichen Aspekte der Parteifinanzierung.
Die Parteiflnanzierung ist, wie Max Weber feststellte, „aus begreiflichen Gründen das wenigst durchsichtige Kapitel der Parteigeschichte.“ Doch vielleicht wird sich daran schon bald etwas ändern. In den meisten Demokratien gehen die Parteien daran, sich für ihre wachsenden Kosten neue Quellen zu erschließen; so auch in Österreich.
Das einer demokratischen Partei traditionell am ehesten gemäße Finanzierungsverfahren ist das Ein-heben von Mitgliedsbeiträgen. Es gilt als Idealfall, würden die Mitglieder für die Kosten ihrer Partei selbst aufkommen. Doch alle Parteien in allen Demokratien entfernen sich immer mehr von diesem Idealfall — auch die sozialistischen Parteien, die ihm am nächsten kommen.
Bei den österreichischen Parteien sind die Mitgliedsbeiträge noch immer von großer Bedeutung. ÖVP und SPÖ sind ungewöhnlich dicht organisierte Parteien, beide weisen einen Mitgliederstand von mehr als 700.000 auf, beide können mit einem jährlichen Beitragsaufkommen von 60 bis 70 Millionen Schilling rechnen. Und dennoch sind diese Beträge bei weitem nicht ausreichend, den Aufwand der Parteien zu decken. Die Kosten für den Wahlkampf 1966 werden auf rund 100 Millionen Schilling geschätzt, wobei die eine Hälfte dieser Summe auf die ÖVP, die andere Hälfte auf die SPÖ und die übrigen wahlwerbenden Parteien entfallen sein sollen.
Mit den Mitgliedsbeiträgen, die zu einem hohen Prozentsatz auf verschiedene Neben- und Unterorganisationen (Bünde usw.) aufgeteilt werden, können auch Parteien mit einer überdurchschnittlichen Organisationsdichte, wie sie ÖVP und SPÖ aufweisen, bestenfalls ihre laufenden Kosten bestreiten. Um im Wahlkampf Schritt halten zu können, müssen sich die Großparteien jedoch andere Quellen erschließen. Dazu zählen Spenden und der Ertrag parteieigener Betriebe.
Doch diesen beiden Finanzierungsmitteln wird wahrscheinlich nicht die Zukunft gehören. Die Problematik der Finanzierung durch Spenden, die von Unternehmerseite einer Partei zukommen, hat sich im Fall Prinke deutlich gezeigt — die enge Verknüpfung von Politik und Profit, von Partei und Geschäft kann bedenkliche Formen annehmen. Aber auch der Aufbau parteieigener Unternehmungen (diesen Weg hat die SPÖ beschritten) bringt auf lange Sicht keine Lösung. Neben den grundsätzlichen Einwendungen — sogar bei einer extensiven Auslegung der Funktionen einer politischen Partei wird man nur schwer die Führung von Wirtschaftsunternehmungen diesen Funktionen zuzählen können — zeigt auch die Praxis der SPÖ-Finanzierung, daß der Gewinn aus parteieigenen Betrieben nur einen geringen Teil des Bedarfes decken kann: Die Einnahmen der SPÖ aus ihren Wirt-schaftsuntemehmungen machen nach fundierten Schätzungen kaum 10 Prozent des Beitragsaufkommens aus.
In dieser Situation soll nun der Staat den Parteien zu Hilfe eilen. Er könnte in indirekter Form die Parteien subventionieren, durch die Gewährung steuerlicher Abzugsfähigkeit für Parteispenden. Das würde zwar einen großen Anreiz zu vermehrtem Spendenfluß bieten und (vielleicht) den Parteien aus ihrer permanenten Geldverlegenheit helfen. Nichts würde sich jedoch an der Vermengung von Parteien, die den demokratischen Staat tragen, und privatem Profitdenken ändern. Vor allem aber steht einer solchen steuerlichen Begünstigung das Gleichheitspostulat entgegen. Denn jene Parteien, die eine den wohlhabenden Wählerschichten genehme Politik betreiben, würden gegenüber den anderen eine vom Staat sanktionierte Vorzugsstellung genießen. Die Parteien würden vom Gesetzgeber geradezu angeleitet werden, sich in ihrer Politik mehr und mehr an den wirtschaftlich Potenten zu orientieren. Die direkte Einnußmöglichkeit des Kapitals auf die Politik würde vom demokratischen Staat institutionalisiert werden.
Einer solchen Lösung wäre die direkte Subvention der Parteien aus Budgetmitteln unbedingt vorzuziehen — eine Möglichkeit, von der die Parteien stillschweigend auf dem Umweg über die Parlamentsklubs in immer stärkerem Ausmaß schon Gebrauch machen. Die direkte Subventionierung würde die Partei-flnanzen aus dem Halbdunkel mehr oder minder seriöser Geschäftigkeit herausheben und öffentlichen Kontrollen zugänglich machen.
Das größte Problem bei einer direkten Finanzierung der Parteien durch den Staat ist jedoch der Verteilungsschlüssel. Ein realistisch gangbarer Weg wird unbedingt den Status quo zur Grundlage der Verteilung haben müssen — den Status quo entweder in Form des Mandatsstandes oder in Form der Stimmenverteilung bei den letzten Wahlen. Und hier ist zu bedenken, ob eine auf dem Status quo basierende, staatliche Parteifinanzierung der Dynamik einer Demokratie gerecht wird, ob den Wählern nicht dadurch eine einschneidende Änderung des Stärkeverhältnisses im Parlament ungebührlich erschwert ist.
Doch eine faktische Bevorzugung der Großparteien besteht auch ohne direkte Subventionierung der Parteien durch den Staat. Auch wenn die Parteien ihre Mittel ausschließlich durch Beiträge und Spenden zusammenbringen könnten, sind die Großparteien bevorzugt: Einer starken Partei wird viel eher eine große Spende zufließen als einer Partei, die keine Einflußmöglichkeit besitzt und damit für potentielle Parteimäzene nur wenig attraktiv ist. Eine Subventionierung auf der Grundlage des Status quo würde diese Tatsache der besseren Ausgangsposition von Großparteien nur verfestigen, aber nicht neu schaffen.
Die politischen Realitäten beweisen immer wieder, daß die Parteien auch ohne staatliche Unterstützung letztlich doch die notwendigen Geldquellen auftreiben. Aber das geschieht unter Ausschluß der Öffentlichkeit, oft hart an der vom Strafgesetz gesteckten Grenze. Vor allem aber sind einige der Finanzierungsquellen, die sich die Parteien notgedrungen erschließen, jenseits der demokratischen Toleranzgrenze, jenseits des Gebietes, das von der Öffentlichkeit als das Gebiet demokratischer Sauberkeit angesehen wird. Und diese permanente Grenzverletzung schadet dem Ansehen der demokratischen Parteien und damit der Demokratie.
Ohne demokratische Parteien ist kein demokratischer Staat denkbar. Lebensinteressen der demokratischen Parteien sind Lebensinter-essen der Demokratie. Der demokratische Staat sollte daher die Aufgabe übernehmen, den Parteien dann unter die Arme zu greifen, wenn diese mit ihren Eigenmitteln, den Beiträgen, nicht mehr ihr Auslangen finden. Damit könnte erreicht werden, daß das, was sich jetzt teilweise auf einer Ebene abspielt, die nicht zufällig die Scheinwerfer öffentlicher Kontrolle und Kritik scheut, in einen Bereich gehoben wird, der diesen Scheinwerfern nicht mehr entzogen werden kann. Damit wäre nicht rur den Parteien, sondern auch der Demokratie gedient.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!