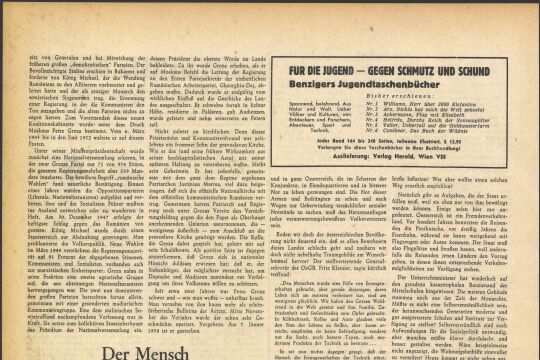Es kam, wie es kommen musste, das Datum des Tages der bitteren Wahrheit lautet 9. März 2010: In dieser Regierungssitzung legten Kanzler Faymann und Finanzminister Pröll ihre Pläne für die Sanierung des Budgets auf den Tisch. Sie kürzen Ausgaben, führen neue Steuern ein, erhöhen bestehende. Die Minister sind schockiert, öffentliche Proteste werden folgen.
Selten noch wurde eine Regierung so rasch von der Unvernunft der Parteiführungen und der Kurzsichtigkeit ihrer Wahlstrategien eingeholt wie diese. Faymann will einen reißenden Strom an Ausgaben wieder in geordnete Bahnen lenken, dem er vor zwei Jahren die Schleusen öffnete. Sein Fünf-Punkte-Plan aus dem Wahlkampf 2008 ist ein Sündenfall, begangen am 24. September, für den nur der Klubchef der mitverantwortlichen ÖVP, Wolfgang Schüssel, tags darauf die richtigen Worte fand.
Beschlussverbot blieb ungehört
Es seien „die Dämme der Vernunft“ gebrochen, sagte Schüssel, Faymann habe die „Büchse der Pandora“ geöffnet. In wechselnden Abstimmungskoalitionen wurden im September 2008, vier Tage vor der Nationalratswahl, Pensionen und Pflegegeld außertourlich erhöht, Vorrechte verlängert (Hacklerregelung), Studiengebühren abgeschafft. Das kostet mehr als drei Milliarden Euro. Jetzt will die Regierung 2,8 Milliarden einsparen, weitere 1,7 Milliarden Euro durch neue Steuern einnehmen. Im Klartext: Wie immer bezahlen die Wähler die Wahlzuckerl. Weil diese zudem ungesund sind, hatte Josef Pröll einen Monat zuvor, im August, vorgeschlagen, budgetwirksame Gesetzesbeschlüsse vor einem Wahltag zu limitieren. Allein: Er blieb ungehört.
Die Öffentlichkeit wurde hingegen mit Plänen behelligt, die Mehrwertsteuer auf Lebensmittel zu senken. Der Hausverstand verhinderte diesen groben und teuren Unfug. Für den im Wahljahr angerichteten Budgetschaden, verdoppelt durch Krise und Malversationen, zahlen wir jetzt die Zeche.
Dem geläufigen Gegenargument, für die Banken sei in der Krise offenbar mehr an Geld vorhanden als für die Bedürftigen, hat die Regierung mehr entgegenzusetzen als die Hinweise auf Mindestsicherung einerseits und Bankensteuer andererseits. Die Ausgangslage ist weiters zu unterschiedlich, um den österreichischen Sparkurs als milde Variante des griechischen zu verkaufen. Zudem sind große Sanierungsprojekte bereits gelungen, etwa in Neuseeland, in Finnland und zuletzt in Schweden. Aus dem internationalen Vergleich wäre zu lernen, so man will.
Was macht den Unterschied?
Der politische Preis für die Sanierung von Staatsfinanzen ist meist die Abwahl der Regierung. Der ist allerdings, gemessen an der Bedeutung funktionierender Haushalte, als gering zu veranschlagen. Wesentlich ist das Gelingen des Vorhabens, was Voraussetzungen benötigt, die ein Staat sehr wohl selbst herstellen kann. In Skandinavien ist dies gelungen, in Griechenland hingegen nicht, und das macht den für Österreich lehrreichen Unterschied.
In Schweden und in Finnland herrschen egalitäre Verhältnisse. Daher ist dort ein Sparkurs leichter durchsetzbar als in einer von krasser Ungleichheit geprägten und von Partikularinteressen gesteuerten Gesellschaft. Das Vertrauen in staatliche Institutionen ist in Nordeuropa höher als in Südeuropa, weil die Verhältnisse weniger korrupt sind. Und die getroffenen Maßnahmen, so hart etwa jene in Finnland und in Schweden waren, werden offengelegt. Sowohl das große Ziel als auch die einzelnen Schritte am Weg dorthin sind in Skandinavien stets Gegenstand wahrlich ausführlicher öffentlicher Debatte. Es sind also die Gleichheit der Bürger, das Vertrauen in die Institutionen und die Offenheit des Verfahrens, was eine Gesellschaft auch auf hartem Sanierungskurs stabil hält. Genau dazu hat sich die Regierung jetzt zu äußern. Die billige Methode, sich bei Wahlen Mehrheiten zu kaufen, ist auf Sicht zu teuer.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!