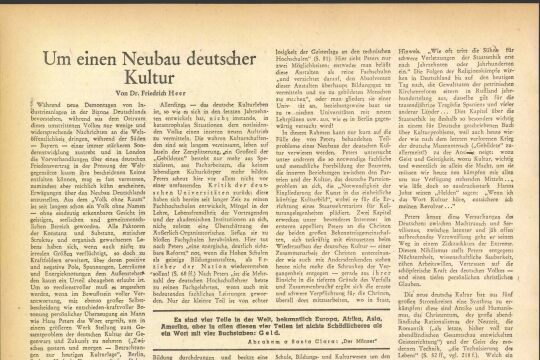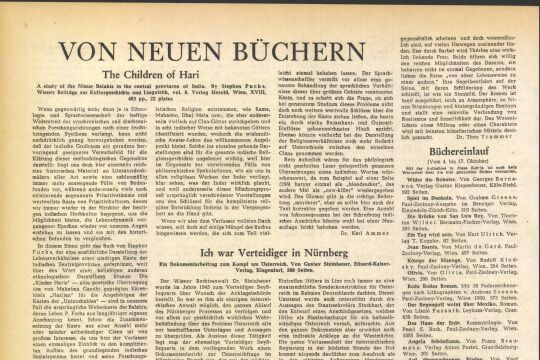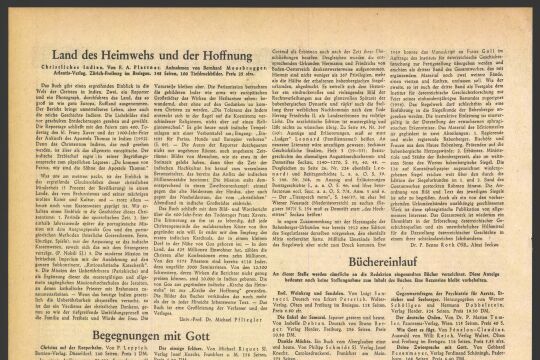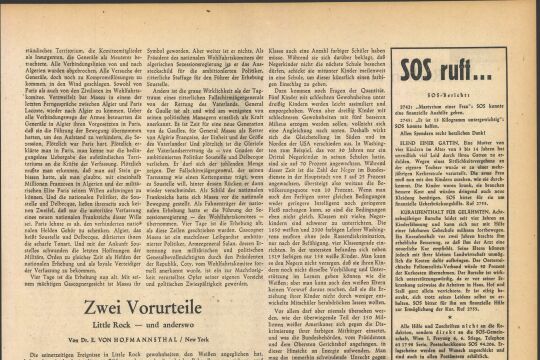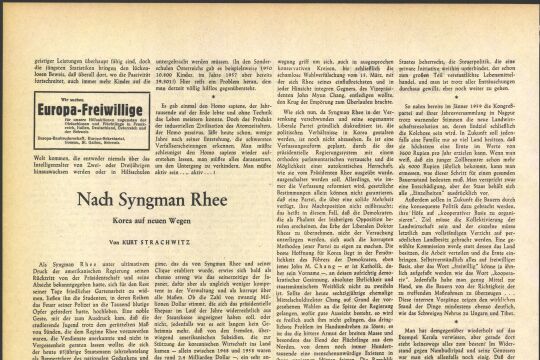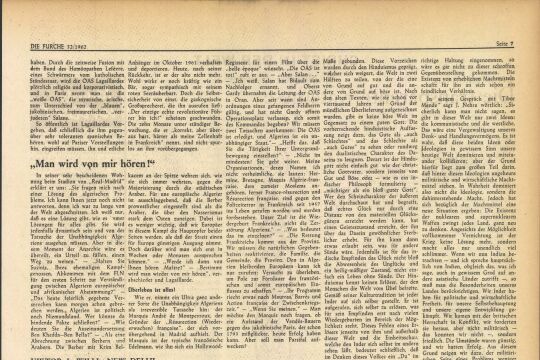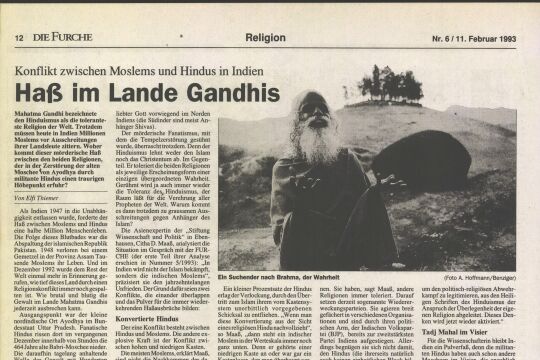Inder als IT-Spezialisten, Inder als Autobauer, Inder als Stahlproduzenten … Der Subkontinent zeigt seine Muskeln und hat seine Schwächen.
Als der indische Großindustrielle Tata am Genfer Autosalon ein neues Kleinauto vorstellte, das er in Indien und der übrigen Dritten Welt um 1700 und im Westen um auch nur 5000 Euro verkaufen will, und als er dann auch noch die britischen Nobel-Automarken Jaguar und Rover kaufte, horchte die Welt auf: Die ehemalige Kolonie Indien kauft zwei Prestigemarken des früheren Kolonialherren. Der Kleinwagen ist - mehr noch als das Heranwachsen des indischen Magnaten Mittal zum größten Stahlproduzenten der Welt - das Fanal dafür, dass ein neuer industrieller Konkurrent auf die Weltbühne getreten ist. Mit Mittal und Tata hat die Globalisierung konkrete Namen.
"Die Globalisierung hat einen Schatten auf Kannada geworfen", schreibt der Deccan Herald, eine englischsprachige Zeitung für die zentrale indische Hochebene. Kannada ist die Hauptsprache im südlichen Bundesstaat Karnataka, der fast zweieinhalbmal so groß ist wie Österreich und 57 Millionen Einwohner hat. Mit Globalisierung meint das Blatt aber nicht etwa die Einbindung Indiens in die Weltwirtschaft, sondern die dramatischen Spannungen und Konflikte, die die rasante Entwicklung im eigenen Land mit sich bringt.
Hindernis Sprachenvielfalt
Viele fürchten etwa um den Bestand der Regionalsprachen, die zunehmend unter den Druck der nationalen Sprachen Hindi, Urdu und Englisch kommen, auch wenn sie oft von Dutzenden von Millionen Menschen gesprochen werden. Die Sprachenvielfalt in Indien - auf den Geldscheinen finden sich 17 der vielen hundert Sprachen des Landes - ist zwar ein großer Reichtum an Kultur und Sitte, wird aber zugleich als Hindernis für das betrachtet, was man die innerindische Globalisierung nennen könnte.
Im Februar kam es zu einem Massenexodus von Wanderarbeitern aus dem vergleichsweise wohlhabenden Staat Maharastra und seiner Hauptstadt, der 15-Millionen-Metropole Mumbai, die unterdessen von den Gebildeten gern wieder mit ihrem britischen Namen Bombay bezeichnet wird. Tausende verängstigter Menschen stürmten die Eisenbahnen und Busse zurück in die Heimat, den armen, aber bevölkerungsreichen Unionsstaaten im Norden. Sie flüchteten vor den Angriffen von Schlägerbanden des hindu-nationalistischen Politikers Raj Thackeray auf die "Ausländer" und "Gastarbeiter", die den Einheimischen die Arbeitsplätze wegnehmen. In manchen Vierteln der Stadt kam es zu Straßenschlachten.
Auch für die Ereignisse von Bombay verwenden Kommentatoren das Wort Globalisierung als Metapher. In Indien ist die Furcht vor der "Balkanisierung", wie das hier heißt, allgegenwärtig, dem Auseinanderbrechen des Vielvölker- und Vielsprachen-Staates. (Deshalb auch die entschiedene Gegnerschaft Indiens gegen die Unabhängigkeit des Kosovo.) Bombay entdeckt - stellvertretend für ganz Indien - zu seinem Schrecken, dass es nicht der Ort kosmopolitischen Zusammenlebens ist, sondern eine Ansammlung verschiedenster Ethnien und Gruppen, vieler Sprachen, die nebeneinander her leben, und wie leicht sich die Ressentiments gegen Leute mobilisieren lassen, die keine Hindus sind, nicht Marathi sprechen, aus Gujarat oder Bihar kommen.
Man kennt die eindrucksvollen Schwarz-Weiß-Bilder aus den Dreißiger- und Vierzigerjahren des letzten Jahrhunderts: Eine Schar von hageren Männern zieht über die staubigen Straßen Indiens, um die Menschen zum Widerstand gegen die englische Kolonialmacht zu mobilisieren. Die Männer tragen weiße Kittel unter grobgewobenen Umhängen, die nackten Füße stecken in Sandalen, in den Händen haben sie einen Wanderstab, die symbolische Bettlerschale baumelt ihnen vor der Brust. Es ist Mohandas K. Gandhi mit den Seinen. Sie sind Politiker und zugleich Gelehrte, Revolutionäre und Asketen.
Gandhi wollte dem postkolonialen Indien eine aus den Quellen der hinduistischen Religion strömende erneuerte Lebensform geben. Einfachheit, Bescheidenheit, Reinheit, Genügsamkeit sollten die Werte dieser Ordnung sein. Selbstversorgung und die Belebung traditioneller Arbeitstechniken und Kunstfertigkeiten sollten die endemische Armut und das Massenelend am Subkontinent ausrotten.
Was von Gandhi blieb
So mager wie Gandhi waren zu seiner Zeit fast alle der damals 300 Millionen Inder. Es war freilich nicht ihre Wahl, für die allermeisten war bittere Armut der schicksalshafte Begleiter ihres Lebens. Wer aber heute auf einem indischen Flughafen ankommt, dem fallen als erstes die vielen dicken Menschen auf. Der neue "Mittelstand" will vom Ideal des gesunden Lebens oder gar der Bescheidenheit nichts wissen. Üppiger Konsum ist der allgemeine Wunschtraum, eine zunehmende Zahl von Indern kann sich ihn auch leisten und zeigt das ungeniert. Wie fremd Gandhi und sein Denken den heutigen Indern geworden sind, zeigt ein Journalist, der ihn - wohlmeinend - einen "Friedensapostel" nennt.
Die oft erwähnte indische Mittelklasse ist aber "eine nur sehr dünne Schicht der Bevölkerung", konstatiert der französische Indien-Experte Christophe Jaffrelot, der lediglich acht Millionen Haushalte dazuzählt, also vielleicht 50 Millionen Menschen. Die Mittelklasse definiert sich über das Einkommen, Bildung, Konsumgewohnheiten, die sich an westlichen Vorbildern orientieren, und - natürlich, möchte man fast sagen - Kaste. Es gibt auch eine Unberührbaren-Mittelklasse. Nur diese kleine Schicht kommt auch als potenzielle oder tatsächliche Steuerzahler in Frage. Ein Drittel der Inder, also 350 Millionen Menschen, lebt von weniger als 40 Rupien am Tag, das sind 80 Cent. Der "Rest", die große Mehrheit der Bevölkerung, liegt irgendwo dazwischen, aber der Armut näher als dem Wohlstand.
Nirgendwo ist auch der Satz vom "privaten Reichtum und der öffentlichen Armut" so zutreffend wie in Indien. Von den acht reichsten Männern der Welt sind vier Inder, am Rand der Städte wachsen elegante Villenviertel, überall werden Luxuswohnungen angeboten, die Immobilienpreise haben in manchen Gegenden und Städten das Niveau wie in den Industrieländern erreicht. Aber für eine Verbesserung der öffentlichen Einrichtungen, von Schulen und Spitälern und für die Infrastruktur fehlt das Steuergeld. Wenn man einen Inder fragt, wozu er denn ein Auto brauche, bekommt man sofort zur Antwort: Um damit zur Arbeit zu fahren. Jeder möchte den öffentlichen Verkehrsmitteln entkommen, den meist heillos überfüllten, uralten Bussen, den langsamen Zügen, den ländlich anmutenden Bahnhöfen.
Beim indischen Wirtschaftswunder darf man die Dimensionen nicht aus den Augen verlieren. Noch immer ist der Außenhandel Indiens nicht größer als der von Belgien. Die berühmte indische Computer- und IT-Wirtschaft ist nur ein verschwindend kleiner Teil der Wirtschaft. Man kann in Indien in ein hochmodernes Hotel kommen, wo es keine Rezeptionisten mehr gibt - eingecheckt wird am Bildschirm. Wenn man aber das Hotel verlässt, stolpert man leicht in eine Straßenbaustelle, für die noch nicht einmal die Scheibtruhe erfunden wurde. Erde, Sand, Steine, heißer Asphalt werden von barfüßigen Frauen in Körben auf den Köpfen transportiert. Selbst Autobahnen werden mit diesen Methoden gebaut.
Kaste als großes Rätsel …
Die Kaste ist das große Rätsel für jeden Besucher Indiens, es ist das unsichtbare und zugleich unzerreißbare Netz, in dem jeder Inder hängt. Auf die Frage, welcher Kaste er angehöre, knöpfte ein Arzt wortlos vor mir sein Hemd auf und zog die weiße Schnur heraus, die er um den Hals hängen hat: Brahmin. "Wenn Sie Hindi sprächen, würden Sie das sofort an meinem Namen erkennen, der soviel bedeutet wie Oberlehrer. Die Oberlehrer, das waren eben die Brahmanen."
… und Kaste für die Quote
Erörterungen über das Kastenwesen kann man jeden Tag in der Zeitung lesen, auch bittere Abrechnungen mit dieser ältesten und gewissermaßen ehrwürdigsten sozialen Einrichtung Indiens. Es ist ein System, "das die Luft in Indien verpestet und jeden ansteckt", wie der große Führer der Unberührbaren, Bhimrao Ambedkar, einer der Schöpfer der indischen Verfassung, einmal zornig sagte. Ambedkar selbst konnte nur studieren und dann eine politische Karriere machen, weil ihm ein verständnisvoller Lehrer zu einem Brahmanen-Namen verhalf.
Es gehört zu den indischen Paradoxien, dass gerade die Versuche, das Kastensystem zu überwinden oder seine sozialen und wirtschaftlichen Folgen zu kompensieren, es erst recht stabilisiert haben. Für Schulbesuch, Studium, Posten im öffentlichen Dienst, Vergabe von Sozialwohnungen herrscht ein striktes Quotensystem, das vor allem den niedrigen Kasten und den "rückständigen Klassen" Zugang zu diesen Einrichtungen entsprechend ihrem Anteil an der Bevölkerung verschaffen soll. Das System habe sich schon aufzulösen begonnen, meint ein Kommentator sarkastisch, aber "heute kennt wieder jeder seine Kaste besser als seine Blutgruppe, denn davon hängt sein ganzes Leben, von der Schule bis zum Beruf, ab". Es soll sogar Eltern aus hohen Kasten geben, die für ihre Kinder Ehepartner aus einer niedrigen Kaste suchen, damit die Enkel später über die Quote in eine gute Schule kommen.
Der Autor war Leiter der Wiener Redaktion der "Kleinen Zeitung".
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!