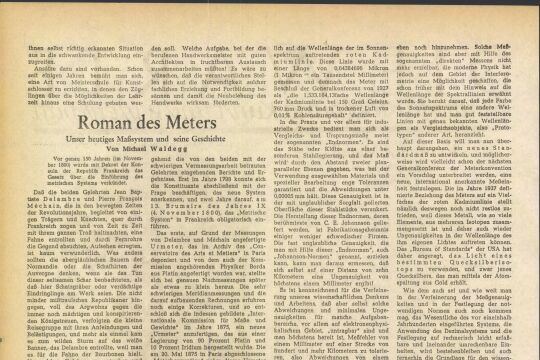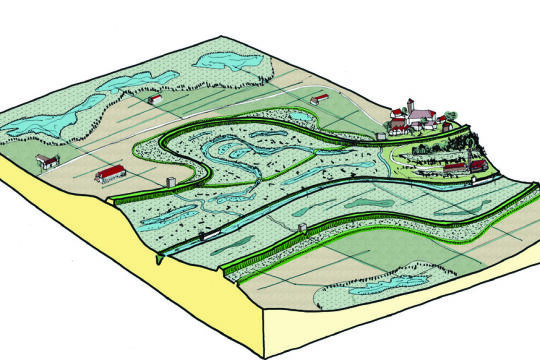Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Jagd nach dem verlorenen Kristall
Vom Schmuckstück bis zum industriellen Schüsselprodukt: Kristalle haben sich zu einem Wettbewerbsfaktor entwickelt. Österreich ist mit dabei.
Vom Schmuckstück bis zum industriellen Schüsselprodukt: Kristalle haben sich zu einem Wettbewerbsfaktor entwickelt. Österreich ist mit dabei.
Viele Großfirmen haben vor etwa drei Jahren die Kristallzüchtung aufgegebenen.
Nun kaufen Sie Kristalle in Japan“, warnt Professor Anton Preisinger vom Institut für Mineralogie der Technischen Universität Wien, denn Europa lasse sich so manches zukunftsweisende Geschäft entgehen. Die Computerindustrie braucht neue Kristallzüchtungen, weil für neue Chips mit noch mehr und noch kleineren Schaltelementen die bisherigen Kristalle qualitativ nicht gut genug sind.
Neue Anwendungsgebiete harren der Nutzung. Zum Beispiel könnten leuchtende Kristalle, ähnlich den Leuchtdioden, Glühbirnen in Verkehrsampeln ersetzen. Sie würden weit weniger Strom verbrauchen und weniger Servicekosten verursachen. „Wer schneller ist, der macht das Geschäft“, denn, so Preisinger, „naqjamachen ist nicht zielführend und kostet nur Patentgebühren.“ Das Problem dabei: um einen neuen Kristall zu entwickeln, braucht man mindestens zwei Jahre.
In den siebziger Jahren war Europa führend und hat beispielsweise die Leuchtdiode entwickelt. Nun führt Japan, das seit rund zehn Jahren seine Grundlagenforschung zentral koordiniert und an industriellen Einsatz orientiert. Kein Wunder, daß Europas Produktion von Kristallen für die Elektronik sinkt. Produzierte der alte Kontinent 1990 noch knapp 15 Prozent des weltweit verwendeten Galliumarsenid (GaAs) und Gallium- phosphid (GaP) ' so sank 1992 der Anteil an der Weltproduktion auf unter ein Prozent.
Österreichs Kristallforscher sind nicht untätig und propagieren unter dem Namen „Euro-Chryst“ die Idee, in Österreich ein internationales Forschungszentrum für Kristallzucht aufzubauen. Europas Kristallzüchter unterstützen diese Idee, die 1992 in Budapest beim internationalen Kongreß der Kristallzüchter vorgestellt wurde. Wissenschafter aus 17 europäischen Staaten tragen zum Beratungskomitee von Euro Chryst bei. Das Großforschungszentrum soll 300 bis 400 Wissenschafter, Techniker und Hilfspersonal unter einem Dach vereinen. Grundlagenforschung soll konzentriert und mit bestehender erforschte Wissen soll rascher der praktischen Anwendung zugänglich gemacht werden. „Bisher war Kristallzüchten eine Kunst und hatte viel mit Alchemie zu tun. Nun sollte der Schritt zur Wissenschaft getan werden“, so der Initiator von Euro- Chryst, Professor Helmut Rauch vom Österreichischen Atominstitut.
Worin liegt nun die Schwierigkeit, die sogenannten Einkristalle - deren Atome im Gegensatz zu den Polykristallen, wie zum Beispiel Kohle, regelmäßig in einem „Gitter“ angeordnet sind - industriell zu erzeugen?
Beim gängigen Kristallziehverfahren von Czochralski, wird das Ausgangsmaterial unter hohem Druck auf knapp über die Schmelztemperatur erwärmt. Mit einem Saatkristall wird ein Kristallblock aus der Schmelze gezogen. Beim Abkühlen kristallisiert dann das Material. Nicht nur Druck und Temperatur müssen genau stimmen, auch muß der Kristall mit der richtigen Geschwin-digkeit aus der Schmelze gezogen werden. Das stellt nicht nur hohe Anforderungen an die Genauigkeit der Apparaturen, sondern es müssen in langwierigen Versuchen erst die richtigen Werte gefun-den werden.
So sind 90 Prozent der Entwicklungskosten für die empirischen Versuche. Derzeit ist es nicht einmal möglich, das Kristallziehen durch Messungen zu kontrollieren. Erst am fertigen Kristallblock kann festgestellt werden, ob der Kristall gelungen ist. Meßmethoden, mit denen die Schmelze und das Kristallziehen überwacht werden können, müssen erst entwickelt werden. Was im Labor bei kleinen Geräten funktioniert, kann oft nicht auf größere Maschi-umgelegt werden.
Das Projekt Euro-Chryst greift die im Regierungsabkommen vor vier Jahren festgeschriebene Bemühung auf, „zumindest eine international tätige Großforschungseinrichtung nach Österreich zu bringen“. Bisher zahlt Österreich zwar viel Geld an internationale Großforschungsprogramme, und österreichische Forscher wandern ins Ausland ab, doch hierher nach Österreich kommen weder Geld noch Forscher.
Mitbewerber um die Großforschungseinrichtung ist das Projektteam „Austrotron , das einen Neutronenbeschleuniger errichten will. Für beide Vorschläge hat das Wissenschaftsministerium je eine Machbarkeitsstudie finanziert. Anneliese Stoklaska, sie betreut im Wissen schaftsministerium die internationale Forschungskooperation, wäre es am liebsten, wenn beide Projekte verwirklicht werden.
Der Pferdefuß ist die Finanzierung. Stoklaska schränkt diesbezügliche Erwartungen an die Regierung ein: „Es sollte nicht sein, daß der Bund die Vorleistung erbringt, es soll ja eine internationale Einrichtung werden.“ Zwei Drittel sollen vom Ausland kommen. Beide Projekte sollen in Brüssel lanciert werden, um Geldgeber zu suchen. Die langen Koalitionsverhandlungen haben die für Dezember erwartete Entscheidung wieder verschoben.
„Vielleicht könnte“, sinniert Helmut Rauch, „auch wieder einmal ein Österreicher einen Nobelpreis erringen.“
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!