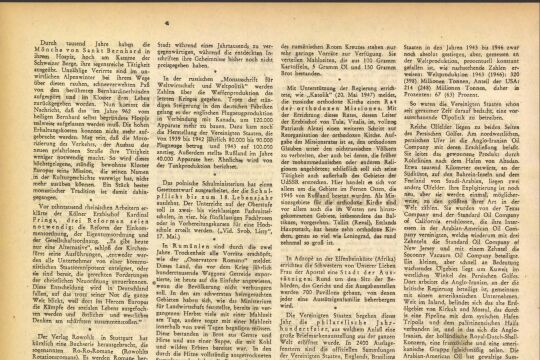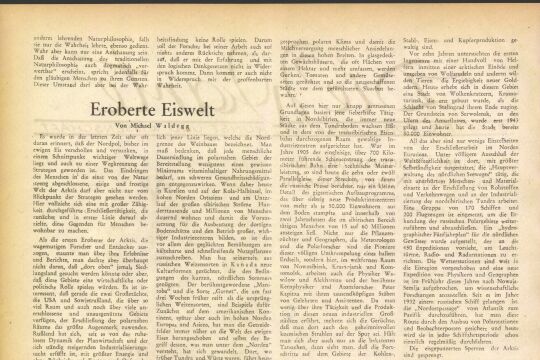Meeresaussicht mit Bohrplattformblick
Die Erdölkonzerne wagen sich wieder an riskante Projekte. Sowohl im hoch empfindlichen Ökosystem der Arktis als auch in der Adria soll nach Erdöl und Erdgas gebohrt werden. Die Politik ist dafür, aber Wissenschafter und NGOs warnen.
Die Erdölkonzerne wagen sich wieder an riskante Projekte. Sowohl im hoch empfindlichen Ökosystem der Arktis als auch in der Adria soll nach Erdöl und Erdgas gebohrt werden. Die Politik ist dafür, aber Wissenschafter und NGOs warnen.
Das indigene Volk der Chenega lebt seit mehr als 10.000 Jahren an den Ufern des Prince William Sund in Alaska. Die Chenegas sind genügsame Menschen. Ihren Lebensunterhalt bestreiten sie mit Fischfang und Robbenjagd. Selbst ein Tsunami, der die Küste 1964 verwüstete, vermochte das Leben nicht nachhaltig zu erschüttern. Doch dann kam das Öl. Am 23. März 1989 lief der Tanker Exxon Valdez unweit von Tatitlek auf das Bligh Riff auf -40.000 Tonnen Schweröl liefen aus und verursachten eine Umweltkatastrophe, die bis heute nachwirkt. Der gesamte Heringsbestand wurde vernichtet, und mit den Tieren die Lebensgrundlage der Chenegas. Tausende Seeotter verendeten, die Schwertwalpopulation sank auf wenige Exemplare, 250.000 Seevögel starben.
Schäden über Jahrhunderte
Mehr als 26 Jahre später ist das Öl immer noch nicht verschwunden. Laut dem Bericht des "Exxon Valdez Oil Spill Trustee Council", ist das Wasser an den Stränden des Prince William Sund noch immer von Öl verseucht -auf einer Länge von insgesamt 700 Kilometern Küste. Das Council schätzt, dass die Verseuchung noch Jahrhunderte anhalten könnte.
Zwölf der 27 Haupttierarten der Region haben sich von dem Desaster bis heute nicht erholt. Der Hering, das Hauptnahrungsmittel der Inuit, ist verschwunden, der Schwertwal ebenso. Die Chenegas müssen heute von der finanziellen Unterstützung der US-Regierung leben.
Die dramatischen Auswirkungen der Exxon Valdez-Katastrophe zeigte beispielhaft, wie lange es in kühlen Gewässern der Arktis dauert, mit einer Ölpest fertigzuwerden. Während in wärmeren Gewässern pro Jahr bis zu 20 Prozent des Öls durch natürliche Mikroorganismen abgebaut werden können, sind es im Nordpazifik gerade einmal ein Prozent. Und das ist nicht alles. Eine Langzeitstudie, die im Prince William Sund durchgeführt wurde zeigte zudem, dass die Toxizität des Öl-Spills bis heute nicht geringer geworden ist.
Aufgrund des extrem empfindlichen biologischen Gleichgewichts warnen Umweltschutzorganisationen und Wissenschafter seit Jahren davor, die Erdölreserven des Gebietes anzuzapfen. Doch nun scheint der Damm gebrochen. Seit Shell sich die Bohrkonzessionen in der Tschuktschensee gesichert hat, sind die Umweltschützer geschlagen. Die Mahnung von US-Präsident Barack Obama, dass man auch an der Energiewende arbeiten sollte, wirkt dabei fast wie eine Entschuldigung.
Auch der Preisverfall an den internationalen Ölmärkten konnte Shell nicht von seinem Engagement abbringen. Mehr als fünf Milliarden Dollar lässt sich der Konzern sein Arktisprogramm kosten. Frühere Kalkulationen waren davon ausgegangen, dass erst ein Ölpreis von über 300 Dollar pro Barrell die Förderung in einem derart unwirtlichen Gebiet rentabel erscheinen lässt. Doch das scheint nun unerheblich zu sein. Nicht nur die Amerikaner gestatten den Einsatz von Bohrinseln, die Ausbeutung von Bodenschätzen ist auch deklariertes Ziel der Arktis-Strategie Russlands, norwegische und dänische Firmen planen ebenfalls die Erschließung neuer Quellen. Immerhin werden mehr als 16 Prozent der Erdöl-und über 20 Prozent der Gasreserven nördlich des 60. Breitengrades vermutet.
Die Adria als Erdölfeld
Doch die Arktis ist nicht die einzige Region, die von einem neuen Erdölboom betroffen sein könnte. Auch unter der "Badewanne" der Österreicher, der Adria, wurden große Öl-und Erdgaslagerstätten geortet. Die Wissenschafter gehen von Ölfeldern von bis zu 1600 Quadratkilometern Gesamtfläche aus. Die kroatische Regierung verkündete unlängst, der "Energiegigant" Europas werden zu wollen. Mit tatkräftiger österreichischer Hilfe: Sieben von zehn im Jänner vergebe nen Lizenzen für die Erschließung der Lagerstätten gingen dabei an die österreichische OMV.
Die hohen Erwartungen haben nun auch in Italien eine heftige Diskussion angeheizt, ob die Energiereserven unter dem Meer intensiver angezapft werden sollen. Tatsächlich muss Italien vier Fünftel seiner Energie importieren, während Experten der staatlichen Ölgesellschaft Eni versichern, das Land sitze auf Reserven, die es für mindestens 50 Jahre erhalten könnte.
Italiens Ex-Premier und EU-Kommissionspräsident Romano Prodi hat deshalb schon begonnen, die Werbetrommel zu rühren und gegen Bürgerinitiativen mobil zu machen, die um Italiens Tourismus fürchten. Prodi: "Hören wir doch auf, uns selbst weh zu tun, indem wir diese Schätze im Boden lassen." Einen der stärksten Befürworter hat die Eni auch in Ministerpräsident Matteo Renzi. Der will gleich aufs Ganze gehen: "Ich werde dafür sorgen, dass wir diese Energie gewinnen. Auch wenn das ein paar Wählerstimmen kostet."
Während Italien also noch heftig diskutiert, hat sich Kroatien weitestgehend festgelegt. Allein aus den Investitionen der Ölfirmen erhofft sich das Land 2,5 Milliarden Dollar.
Freilich ist Kroatien ebenso wie Italien vom Tourismus abhängig. Ölplattformen in Küstennähe könnten sich da äußerst negativ auswirken. So finden sich Tourismusexperten mit Umweltschutzorganisationen wie Greenpeace in einem Boot. "Die OMV setzt die Zukunft der Adria aufs Spiel und gefährdet mit den geplanten Ölbohrungen nicht nur das dortige Ökosystem, sondern auch den wichtigsten Wirtschaftszweig Kroatiens", meint etwa Greenpeace-Sprecher Lukas Meus.
Tatsächlich müsste man sich das Panorama einiger dalmatinischer Küstenstädte in Zukunft etwas anders vorstellen. "Einige Bohrfelder sollen direkt vor der historischen Stadt Dubrovnik liegen", so Meus. Damit wären die Angst vor einer Ölpest um die Angst vor einer Bohrplattform-Aussicht erweitert. Während es Hoffnung gibt, dass erstere nicht eintritt, ist letztere allerdings garantiert.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!