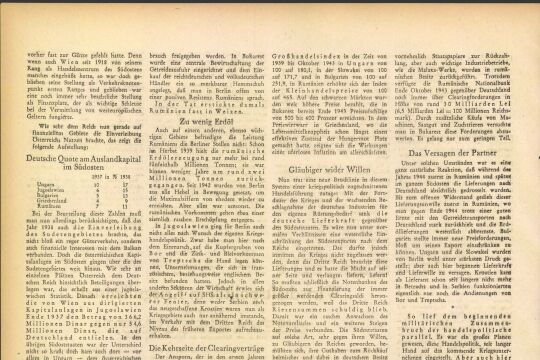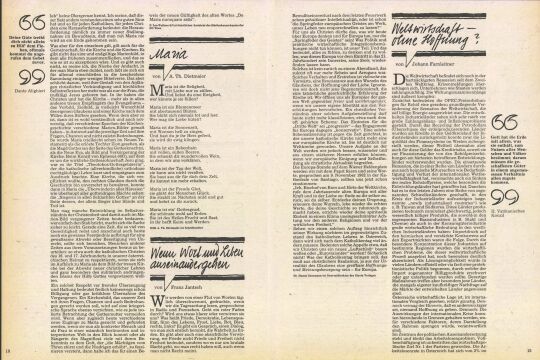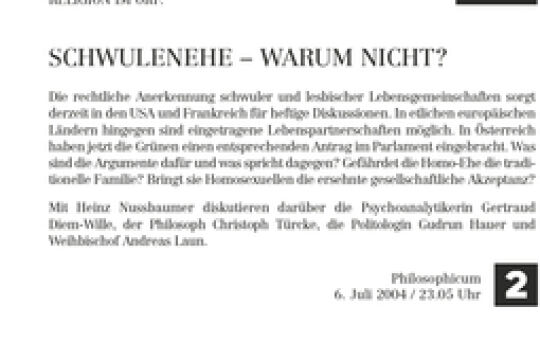Nichtregierungsorganisationen verlangen ebenso wie zahlreiche Ökonomen eine Steuer auf Devisenspekulationen. Und das nicht erst, seit George Soros die Bank of England in die Knie gezwungen hat.
Täglich wechseln 1.200 Milliarden US-Dollar auf den internationalen Kapitalmärkten den Besitzer, der größte Teil davon für sehr kurze Zeit. Denn 80 Prozent der Anlagen fließen innerhalb von längstens sieben Tagen in das Ursprungsland zurück. Der Verdacht liegt nahe, dass ein bedeutender Teil davon hochgradig spekulatives Kapital ist, darauf gerichtet, binnen kürzester Zeit Gewinne zu machen und dann sofort wieder aus dem jeweiligen Land abgezogen zu werden. Wirtschaftswissenschafter warnen vor diesem sehr mobilen Geld: Wenn in einem Land die Gefahr bestehe, dass viel Kapital rasch abgezogen werden kann, steigt die Schwankungsbreite der Währung, diese wird instabil, was wiederum der Wirtschaft schadet.
Währungen sind bezwingbar
Mit kurzfristigen Spekulationen werden Währungen auch gezielt angegriffen, wie es der US-amerikanische Investmentbanker George Soros tat, als er 1992 gegen das Britische Pfund spekulierte, bis es massiv an Wert verlor und aus dem Europäischen Wechselkursverbund ausscheiden musste. Soros ging in die Geschichte ein als "der Mann, der die Bank of England in die Knie zwang" und damit eine Milliarde US-Dollar Gewinn machte. Zwar sind viele Ökonomen der Ansicht, Währungsspekulanten allein könnten keine Währungskrise auslösen, aber sie werden oft mitverantwortlich gemacht, wie etwa bei der Wirtschaftskrise in Mexiko 1994 und bei der Asienkrise 1997.
"Der Devisenmarkt ist der größte Markt der Welt, aber er unterliegt keiner Regulierung", beklagt daher Paul Bernd Spahn, Professor für Öffentliche Finanzen an der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt am Main. "Aktienspekulationen dagegen sind genau geregelt, Verstöße werden teilweise massiv bestraft", führte der Wirtschaftswissenschafter vergangene Woche in Wien auf der Veranstaltung "Tobin-Tax - Möglichkeiten der Besteuerung internationaler Devisentransaktionen" des Renner-Institutes aus. Auch Währungsgeschäfte müssten in die richtigen Bahnen gelenkt werden. Und das gehe am besten mit einer Steuer.
Alte Idee, junge Verfechter
Die Idee, Devisengeschäfte zu besteuern, ist aber keine Reaktion auf die Finanzkrisen der 1990er Jahre. Sie kam dem späteren Wirtschaftsnobelpreisträger James Tobin vielmehr bereits in den 70ern: US-Präsident Richard Nixon erklärte damals das System fixer Wechselkurse von Bretton Woods für beendet. Als die Kurse der zuvor in das System eingebundenen Währungen daraufhin frei schwankten, fanden Währungsspekulanten ein Betätigungsfeld, das für die Wirtschaft der betroffenen Länder gefährlich war. Tobin empfahl, diese Spekulationen mit einer Steuer zu belegen, die gerade so hoch sein müsste, dass kurzfristige Spekulationen unterbleiben, langfristige Investitionen jedoch nicht behindert würden. Dadurch würden die Wechselkurse stabilisiert. Umgesetzt wurde die Idee damals wie heute aber nicht.
Auch Non-Profit-Organisationen wie Attac propagieren den Gedanken. In der Tobin-Steuer sehen sie neben der Eindämmung "unfairer" Spekulationen noch einen zusätzlichen Effekt: Schätzungen zufolge würde ein Steuersatz von nur 0,1 Prozent jedes Jahr 150 Milliarden Dollar einbringen - Geld, das nach Attac-Wunsch Entwicklungsländern zugute kommen soll.
Spahn ist dagegen skeptisch, was die Verquickung von Stabilisierungseffekt und Einnahmen betrifft: "In der Tat könnte die Tobin-Steuer schöne Summen lukrieren", gibt er zu. "Aber sie hat zwei Probleme: Ist sie zu gering, macht sie weniger aus als die Gewinne kurzfristiger Spekulationen und stellt somit kein Hindernis dar. Ist sie zu hoch, hält sie neben kurzfristige Spekulanten auch längerfristige Investoren ab und ist somit eine Gefahr für die Liquidität eines Landes." Ist diese zu gering, bedeute das erst wieder eine Gefahr für die Wechselkursstabilität. "Krisen abwenden kann Tobins Modell jedenfalls nicht", ist Spahn überzeugt.
Doppelt hält besser
Die von ihm vorgeschlagene "Spahn-Steuer" wurde heuer in Belgien beschlossen, tritt aber erst in Kraft, wenn die anderen EU-Länder folgen. Auch in diesem Modell bleibt die Tobin-Steuer bestehen. Allerdings hauptsächlich, um Gelder zu lukrieren und in so geringem Ausmaß, dass Kapital dennoch fließt. Bewegen sich die Kursschwankungen innerhalb einer Bandbreite, die sich aus den Kursen der vergangenen 20 Tage berechnet, fallen keine weiteren Transaktionssteuern an. Gibt es jedoch Ausreißer aus diesem Korridor, werden diese zusätzlich besteuert - um bis zu hundert Prozent. "Die Anleger haben dann kein Interesse an Aktionen, die eine massive Bewegung auslösen würden."
Die Sorge vieler Finanzwissenschafter, dass schon die Tobin-Steuer allein zur Abwanderung von Investitionen führe, solange sie nicht weltweit eingehoben würde, teilt Spahn nicht. Er ist überzeugt, dass es schon genügen würde, sie in ganz Europa einzuführen. "Auch der Finanzplatz London ist immer teurer geworden, und er ist noch immer einer der wichtigsten der Welt."
Gegenteilige Folgen
Was für viele schön klingen mag, ist aber beispielsweise für Nationalbankdirektor Josef Christl nicht denkbar. "Die reale Welt ist komplizierter", meint der Ökonom dazu. Eine Besteuerung von Devisengeschäften wäre seiner Ansicht nach kontraproduktiv: Statt Stabilisierung würde sie möglicherweise sogar noch höhere Wechselkursschwankungen bringen. Denn sie behindere den Kapitalzufluss in die Märkte, und "je weniger Kapital auf einem Finanzmarkt ist, umso größer ist die Volatilität". Zudem seien Finanzkrisen wie in Asien und Lateinamerika hausgemacht. "Mit Währungsspekulationen hat das nichts zu tun, sondern mit hoher Auslandsverschuldung, schlechter Fiskalpolitik, rigiden Wechselkurs-Regimen und schlechtem Risikomanagement der Finanzinstitute." Zusätzlich wäre eine Tobin-Steuer auch noch unfair: "In keinem europäischen Land gibt es so viele Fremdwährungskredite wie in Österreich. Sollen jetzt also die Haushalte bestraft werden?"
Darüber müssen sich die Österreicher aber wohl ohnehin nicht so bald Sorgen machen. Denn die USA wollen Devisengeschäfte nicht besteuern - "und die meisten anderen Länder sitzen wie das Kaninchen vor der Schlange und bewegen sich nicht".
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!