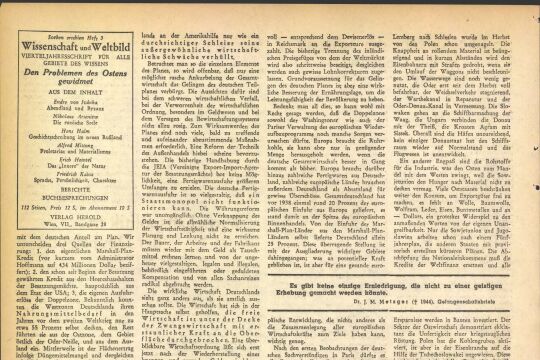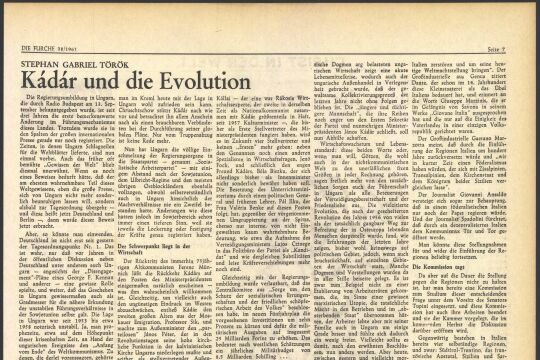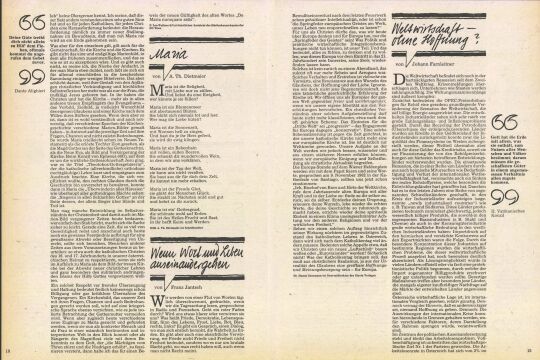Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Nicht alle wollen schnell nach Brüssel
Der Schlüssel für den Abbau des wirtschaftlichen Gefälles zwischen Ost- und Westeuropa liegt bei den postkommunistischen Reformländern selbst.
Der Schlüssel für den Abbau des wirtschaftlichen Gefälles zwischen Ost- und Westeuropa liegt bei den postkommunistischen Reformländern selbst.
Alle fünf Kontinente sind durch Meere voneinander getrennt, nur zwischen Europa und Asien besteht eine Landgrenze, die nach politischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten schwer zu bestimmen ist. Wird sie vom deutschen Steuerzahler festgelegt?
Diese manchmal gehörte, nicht sehr taktvolle Äußerung will zum Ausdruck bringen: Der Abbau des wirtschaftlichen Gefälles zwischen Ost und West - für viele Beobachter unabdingbare Voraussetzung für dauerhafte demokratische Strukturen - kann nur durch massive Unterstützung von seiten der wohlhabenden Länder Westeuropas erfolgen, die in ihrem eigenen Interesse durch finanzielle Zuwendungen, staatlich subventionierte Investitionen und Schuldenerlaß zu einem möglichst raschen Aufbau einer funktionierenden Marktwirtschaft in den postkommunistischen Reform-ländern beitragen sollen. Das Ausmaß dieser Hilfe und die Auswahl der begünstigten Länder würden dann für die Ostgrenze Europas maßgebend sein.
Diese Betrachtungsweise ist eindimensional. Alle Erfahrungen zeigen, daß jegliche Unterstützung durch das Ausland nur subsidiär in Ergänzung zu den eigenen Anstrengungen zufriedenstellende Ergebnisse bringen kann. Substantielle wirtschaftliche Fortschritte sind an Voraussetzungen gebunden, die die osteuropäischen Staaten selbst erfüllen müssen.
Die Stärke einer Volkswirtschaft wird weitgehend durch die Qualität ihres Standortes bestimmt, wofür neben ökonomischen Faktoren auch technologische und kulturelle Gegebenheiten maßgebend sind. Dabei spielt der von der Geschichte, der Religion, dem Klima und den Lebensumständen geprägte Volkscharakter eine wichtige Rolle. Dies zeigt etwa die Tatsache, daß das frühere Jugoslawien das exorbitante Wohlstandsgefälle zwischen Slowenien und Mazedonien auch in sieben Dezennien nicht abbauen konnte - weder in der Zwischenkriegszeit, noch unter Tito. Und so bewegt die politische Geschichte Osteuropas in den letzten hundert Jahren auch war -Monarchien wurden gestürzt, Grenzen immer wieder verändert, Militärdiktaturen errichtet, Okkupationen erlitten, der Kommunismus ertragen und überwunden -, an den Niveauunterschieden der Volkswirtschaften dieser Länder untereinander (Polen/Ukraine, Tschechien/Slowakei, baltische Staaten/Rußland) hat sich seit 1895 so gut wie nichts geändert.
Tschechien, dessen privater Sektor bereits zwei Drittel des Bruttoinlandsproduktes umfaßt und das im vergangenen Jahr sogar einen Budgetüberschuß erwirtschaftete, ist ein gutes Beispiel dafür, daß der Westen den Einfluß der Wirtschaftshilfe und der Auslandsinvestitionen auf die Entwicklung der Marktwirtschaft in Ost-Mitteleuropa überschätzt hat. Denn die bisherigen direkten und indirekten Auslandsinvestitionen in den 27 postkommunistischen Reformländer sind mit wenig mehr als fünf Milliarden Dollar im vergangenen Jahr eher bescheiden.
Diese Größenordnung entspricht ungefähr dem Betrag, den die Philippinen an Auslandskapital erhalten haben. Doch das ist nicht entscheidend: Worauf es ankommt, sind Unternehmergeist, demokratische Reformen, Ermutigung zu marktwirtschaftlichen Lösungen und inländisches Risikokapital. Die Systemänderung von der zentral gelenkten Kommandowirtschaft zur Marktwirtschaft mit ihren Kernelementen wie Entmonopolisierung, Aufbau der Kontakte mit dem Ausland, Privatisierung des Vermögens der Hoheitsverwaltung, Rückstellung von enteignetem Vermögen, Schaffung eines funktionierenden Finanzsystems, insbesondere des Kapitalmarktes, Förderung des Kleingewerbes und insbesondere die Schaffung einer rechtlichen und administrativen Infrastruktur bedarf mutiger Entscheidungen.
Der tschechische Premierminister Vaclav Klaus sagte vor einigen Monaten in einem Interview, daß die Staaten Zentral- und Osteuropas mit einem Krankenhaus verglichen werden können, in dem jeder Patient weiß, daß er sich einer bestimmten Behandlung unterziehen muß. Einige ziehen es vor, Aspirin zu schlucken, und hoffen dadurch der notwendigen größeren Operation zu entgehen. Andere lassen sich zwar in den Operationssaal führen, verlieren aber auf dem halben Weg den Mut und bleiben mit aufgeschnittenem Brustkorb liegen. Eine dritte Gruppe findet nach gelungener Operation ihren Weg in die Rekonvaleszenz. Die mutigsten aber sind bereit, sich nach dem notwendigen Eingriff in einem Fitneß-Zentrum zu regenerieren und Kraft zu holen, damit sie im internationalen Wettbewerb bestehen können.
Interessanterweise gehen aber hoher wirtschaftlicher Standard und gute Wachstumschancen mit dem Wunsch nach völliger europäischer Integration nicht unbedingt konform: Die Paul Lazarsfeld-Gesell-schaft für Sozialforschung veröffentlichte gegen Ende des vergangenen Jahres eine Umfrage in den postkommunistischen Reformländern, die die Bereitschaft zu einer engen Zusammenarbeit mit Westeuropa untersucht:
Die konkrete Frage war, ob sich das Land in Richtung der westeuropäischen Staaten oder den nationalen Traditionen entsprechend weiterentwickeln solle. Nur die Slowenen (mit 69 Prozent), Kroaten (67 Prozent) und Polen (52 Prozent) entschieden sich mehrheitlich für den Westen. Rumänien und die Slowakei sprachen sich zu 47 Prozent beziehungsweise 42 Prozent, die Ukraine zu 39 Prozent, Bulgarien, Ungarn und Tschechien lediglich zu 36 Prozent für eine größere Nähe zum Westen aus. Das Schlußlicht bildeten Weißrußland mit 29 Prozent und Rußland mit 22 Prozent.
Die Umfrage zeigt deutlich, daß die prowestliche Einstellung nicht so sehr mit den wirtschaftlichen Erwartungen als mit der äußeren Sicherheit zusammenhängt.
Die Slowenen und Kroaten fühlen sich offenbar durch die kriegerischen Ereignisse im ehemaligen Jugoslawien bedroht, die Polen sind durch ihre tragische Geschichte gebrannte Kinder. Auch in Rumänien, der Slowakei und der Ukraine herrscht Angst vor einem bewaffneten Konflikt mit dem Nachbarn. In den anderen Ländern ist das nicht der Fall.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!