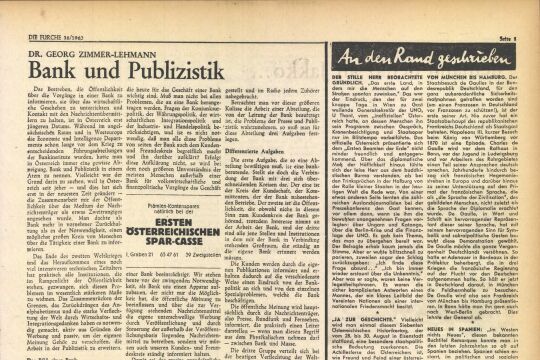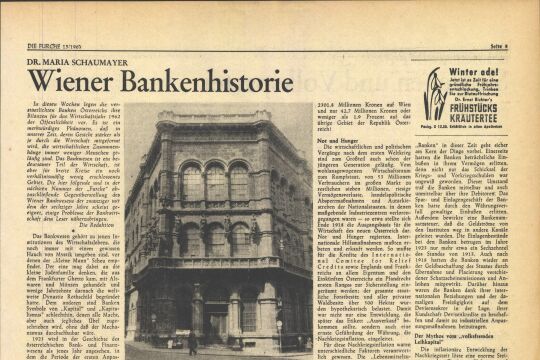Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Pulverfaß CA-Verkauf
Die causa prima der österreichischen Innenpolitik zu Beginn dieses Jahres - der Verkauf der Credit-anstaltaktien im Staatsbesitz -bietet in diesen Tagen ein durch Desinformation und Halbwahrheiten verzerrtes Bild. Mit den Händen greifbar ist jedoch der unabsehbare und nachhaltige Schaden für die betroffenen Banken, für den Finanzplatz und Wirtschaftsstandort Osterreich sowie für die Glaubwürdigkeit der Regierungsparteien.
Wie konnte es dazu kommen? Ausgangspunkt war die Erkenntnis, daß das österreichische Bankwesen nur durch Strukturverbesserungen mittels Konzentration und Ra-tionalisierung im internationalen Wettbewerb bestehen kann. Der Staat als Eigentümer tut sich dabei erfahrungsgemäß schwer; vor allem braucht er dringend Geld. So entstand entgegen früherer ideologischer Bedenken ein breiter Konsens, die im Besitz des Bundes befindlichen CA-Anteile zu privatisieren.
Bei der konkreten Durchführung dieses schon vor Jahren gefaßten Beschlusses zeigte sich eine folgenschwere Schwäche der bürgerlichen Seite, die den Eigeninteressen der ihr nahestehenden Institute großen Spielraum ließ und persönliche Animositäten einflußreicher Vorstände als retardierendes oder gar prohibi-tives, Element akzeptierte. Dabei war der systematische Aufbau eines sozialistischen Bankenimperiums mit entscheidender Hilfe des jeweiligen Finanzministers bereits im vollen Gange: Es kam zunächst zur Übernahme des Osterreichischen Creditinstituts durch die Länderbank, die ihrerseits mit der Zentralsparkasse der Gemeinde Wien zur Bank Austria (BA) fusioniert wurde. Bald danach erweiterte dieses nunmehr größte, wenn auch nicht ertragreichste österreichische Geldinstitut durch die feindliche Übernahme der bisher bürgerlichen GiroCredit seinen Einfluß - dank unentschlossener Konkurrenz.
Nicht'nur, daß die ÖVP dieser Entwicklung tatenlos zusah - sie reagierte auch bei konkreten Verkaufsofferten der CA-Aktien defensiv. So wurde nie in Erwägung gezogen, statt der entschiedenen Ablehnung des Angebotes der Credit Suis-se Holding die Zustimmung für eine Übernahme durch eine ausländische Bankengruppe von der völligen Privatisierung der Bank Austria abhängig zu machen. Österreich hat -te bei dieser Konstruktion den Anschluß an einen Global Player - also an ein weltweit agierendes Institut - gewonnen und zugleich eine auch im EU-Vergleich ansehnliche, dem Einfluß der Parteien entzogene Großbank geschaffen.
Unentschlossenheit und Schwäche zeigten sich auch in der mangelnden Unterstützung der Offerte des Raiffei-sensektors und des Konsortium Erste Österreichische - EA Generali. Warum ist die Idee einer breiten Streuung durch steuerbegünstigte Volksaktien nicht schon früher zur Diskussion gestellt worden?
Im Rückblick unverständlich bleibt auch die Zustimmung der ÖVP zu einem Ermächtigungsgesetz, das dem Finanzminister die alleinige Entscheidung überläßt, ohne in Übereinstimmung mit dem Regierungsübereinkommen Käufer unter der Kontrolle der öffentlichen Hand eindeutig auszuschließen.
Denn das jahrelange Tauziehen um die CA-Privatisie-rung brachte die sozialistischen Finanzgewaltigen der Stadt Wien und den aggressiven und zielbewußten Bank-Austria-Generaldirektor auf die Idee, mit einem unschlagbar hohen Angebot selbst in den Ring zu steigen, um auf diese Weise einen nahezu marktbeherrschenden Einfluß auf den österreichischen Kreditsektor zu gewinnen.
Unabhängige Finanzexperten sind überzeugt, daß dieser Coup primär politisch motiviert ist. Wirtschaftliche Erwägungen allein könnten den Einsatz von 17 Milliarden Schilling, um 20 Prozent höher als das nachfolgende Angebot, nicht rechtfertigen. Zwar würde die Übernahme einen Au-strogiganten schaffen, der 85 Prozent der Großkunden und eine extrem starke Stellung im Anlagegeschäft hätte; wenn aber die Bank Austria aus diesem Scheinmonopol Nutzen ziehen wollte, würde sie ihre Kunden sehr rasch an die nach Österreich drängende ausländische Konkurrenz verlieren.
Auch wird Größe gerne überschätzt. Entscheidend ist nicht die Bilanzsumme, sondern das Betriebsergebnis. Und das ist bei der CA, dem Übernahmekandidaten, deutlich besser als bei der Bank Austria. Der vielzitierte Synergieeffekt
- Einsparungen durch das Zusammenlegen von Aktivitäten
- wird ohne große soziale I harten nur sehr beschränkt zu erreichen sein. Die österreichischen Geldinstitute stehen insgesamt vor einem unvermeidbaren Personalabbau; die Bank Austria mit wesentlich höheren Personalkosten, der de facto Unkündbarkeit eines großen Teils ihrer Mitarbeiter und einem mächtigen, in den Aufsichtsrat zum Teil-mit Vetorecht hineinregierenden Betriebsrat tut sich da noch schwerer. Die Angst der CA-Angestellten, daß sie letztlich auf der Strecke bleiben, ist daher begründet. Feierliche Versprechungen, das hat man beim Konsumdebakel gesehen, werden durch die normative Kraft wirtschaftlicher Entwicklungen zur Makulatur.
Wie ernst die Lage ist, zeigt ein von Martin und Schumann in ihrem Buch „Die Globalisierungsfalle“ (siehe FURCHE 47/1996, Anm. d. Red.) angestellter Vergleich, der die Produktivität der Bank Austria, der CA (und deutscher Institute) mit dem Ergebnis der amerikanischen Citycorp mißt. Danach hätte die BA ihren Personalstend um 1.963 auf 7.000, dieCAuml.l75auf6.310Mit-arbeiter zu reduzieren. Dies ist aber nur eine Momentaufnahme aus dem Jahre 1995. Man muß wissen, daß die amerikanischen Banken eine weitere Verminderung ihres Personals um 20 Prozent bis zum Jahr 2000 erwarten.
Die Übernahme sollte handstreichartig erfolgen. Die Betreiber gewannen den Finanzminister für ihre Idee (er kann sich rühmen, dem Bund drei zusätzliche Milliarden zu bringen, wenn er unerwähnt läßt, daß der Deal risiko-jjk reich ist und der Wiener Steuerzahler im Insolvenzfall haftet). Noch bevor der Koalitionspartner (und möglicherweise auch der Bundeskanzler) in Kenntnis gesetzt wurde, versicherte man sich der stillschweigenden Zustimmung Jörg Haiders. Damit glaubte man den Koalitionspartner ausgetrickst zu haben.
Dieser Überraschungscoup ist zunächst mißlungen. Die Entschiedenheit, mit der die tiefenttäuschte ÖVP spät, aber doch energischen Widerstand leistete, bewog den FPÖ-Chef drei Stunden vor der entscheidenden Nationalratssitzung, (he den Sozialisten gegebene Zusage zu überdenken. Er sah nicht zu Unrecht eine willkommene Chance, die Kluft zwischen den Begierungspartnern weiter zu vergrößern. Seither bietet sich Haider beiden Streitparteien an und wartet, welche Seite den höheren Preis zu zahlen bereit ist.
Wer aber die Unterstützung der Freiheitlichen sucht, bewegt sich auf dünnem Eis: Die mangelnde Paktfähigkeit des FPÖ-Obmanns, die entschiedene Ablehnung jeglicher Kooperation durch einen erheblichen Teil der eigenen Wählerschaft und die zu erwartende Trotzreaktion des überfahre-nen Regierungspartners, der mit gleicher Münze zurückzahlen könnte, lassen nichts Gutes erwarten.
Auf der anderen Seite müssen alle in einer Regierungskoalition auf gegenseitiges Vertrauen angewiesenen Partner wissen, was dem anderen zugemutet werden kann. Dieser Grundsatz wurde zuerst von den der Bank Austria nahestehenden Politikern grob mißachtet.
Nur eine solche Einsicht läßt auf eine Verständigung zwischen den Koalitionsparteien in letzter Minute hoffen.
Der Autor ist Publizist.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!