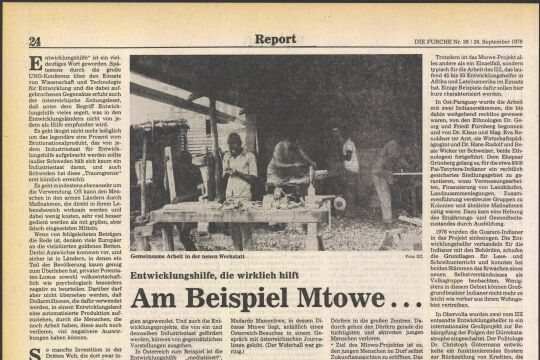dieFurche: ,,Ärzteohne Grenzen"-eine weltweit tätige Hilfsorganisation, wann entstand sie?
Clemens Vlasich: Sie wurde vor 25 Jahren von einer kleinen Gruppe von Ärzten in Frankreich gegründet: „Me-decins sans frontieres". Sie wollten schnell, effizient, unbürokratisch in Notlagen helfen. Als Anfang der achtziger Jahre die Flüchtlingsströme zunahmen, wuchs auch die Organisation und wurde professioneller. Es reichte nicht, einige Leute in weißen Kitteln wohin zu schicken.
dieFurche: Wie geht das heute vor sich?
Vlasich: Es kommt auf die Art der Hilfe an. Nehmen wir das aktuelle Reispiel der Überschwemmungen in China. Ein großes Problem ist dort, das Wasser trinkbar zu machen. Da brauchen wir nicht viel Personal. Es ist vor Ort vorhanden, nur eben überfordert. Wir helfen dort mit Material und einigen Spezialisten, schicken also nicht nur Ärzte und Pflegepersonal. Man braucht ja immer Laute, die organisieren können. Nehmen wir andere Einsätze, etwa in Sri Lanka oder in Ex-Jugoslawien: Da unterstützen wir das in den Spitälern zurückgebliebene Personal oder ersetzen es, wenn es nicht mehr vorhanden ist.
dieFurche: Haben Sie fixe Mitarbeiter?
Vlasich: Nein, im allgemeinen nicht. Wir stellen zunächst nicht an, zahlen aber eine Entschädigung von 9.000 bis 10.000 Schilling, alle Kosten und ein Taschengeld vor Ort. Die Einsatzdauer beträgt durchschnittlich sechs Monate, kann aber stark variieren. Ein Wiener Chirurg war jetzt in seinem Urlaub fünf Wochen in Sri Lanka im Einsatz. Er hat dort jeden Tag operiert. Diese Arbeit würde er sechs Monate nicht durchhalten. Anders ist es, wenn ein praktischer Arzt oder eine Krankenschwester auf Einsatz gehen. Sie haben viel mit den Leuten zu tun und sollten mindestens ein Jahr bleiben.
dieFurche: Sie setzen vor allem erfahrene Personen ein?
Vlasich: Ausschließlich. Ärzte müssen mindestens den Turnus absolviert haben. Wenn wir zum Beispiel in einem Flüchtlingslager arbeiten, so muß man etwa eine kleine Klinik aufbauen oder eine Impfkampagne organisieren. Da braucht man einfach Erfahrung, weil man auch eigenständig arbeiten muß.
dieFurche: Was unterscheidet ,/irzte ohne Grenzen" von anderen Hilfsorganisationen?
Vlasich: Erstens konzentrieren wir uns auf medizinische Hilfe. Allerdings schicken wir nicht nur Arzte, die Leute behandeln, sondern sind auch bemüht, vorbeugend zu arbeiten. Etwa in einem Flüchtlingslager sauberes Wasser bereitzustellen, für Hygiene zu sorgen (Latrinen, Abwasser- und Müllentsorgung ...), um Infektionskrankheiten zu verhindern. Aktivitäten, die nichts mit Medizin zu tun haben, übernehmen wir nicht. Unser zweites Anliegen ist es, soweit wir von Menschenrechtsverletzungen erfahren, auf diese hinzuweisen.
dieFurche: Kürzlich machten Sie auf Mißstände in Burundi aufmerksam ...
Vlasich: Eigentlich herrscht dort eine chronische Katastrophe, ein Bürgerkrieg im kleinen Stil. Dauernd gibt es da und dort ein Massaker, nicht tausende Tote auf einmal, über die berichtet würde, aber jeden zweiten Tag zehn Tote. Wir bleiben dort präsent, um für die Menschen die medizinische Versorgung sicherzustellen. Es wird immer schwerer. Nach dem jüngst erfolgten Sturz des Präsidenten wurde ein Embargo über Burundi verhängt, das auch humanitäre Hilfsgüter betraf. Damit sind wir an die Öffentlichkeit gegangen. Dadurch hat sich die Situation etwas gebessert.
dieFurche: Wie rekrutieren Sie Ihre Mitarbeiter in Osterreich?
Vlasich: Wir haben im medizinischen Milieu einen recht guten Bekanntheits-grad. Ärzte und Krankenpflegepersonal, die sich für eine solche Art von Arbeit interessieren, stoßen fast automatisch auf uns. Unsere Möglichkeiten reichen nicht, gezieltLeute zu suchen. Wir warten, daß sich Interessenten an uns wenden. Bisher wollten rund 500 Personen eine erste Information, 90 Prozent medizinisches Personal. Seit Oktober 1994 waren 13 Personen im Einsatz - die meisten mehrmals. Heute fliegt eine Krankenschwester nach Kenia.
dieFurche: Wer initiiert die Projekte?
Vlasich: Sechs Zentren: in Frankreich, Belgien, Holland, der Schweiz, Spanien und Luxemburg. Von dort aus werden die Projekte gestartet und geleitet In den letzten fünf Jahren sind 13 Außenstellen (auch die in Österreich) dazugekommen. Sie unterstützen die Zentren durch Personal und Geld.
dieFurche: Wie fällt die Entscheidung, einem bestimmten Land zu helfen?
Vlasich : Nachrichtenagenturen und internationale Organisationen informieren uns über das Weltgeschehen. Eine wichtige Informationsquelle sind die Mitarbeiter vor Ort: 2.000 bis 3.000 in 70 Ländern. In den Zentren wird diese Information bewertet. Kommt man dort zu der Überzeugung, daß irgendwo Hilfe notwendig wäre, wird ein Erkundungsteam losgeschickt. Dieses entscheidet vor Ort. Oft muß alles dann sehr rasch gehen.
dieFurche: Stehen Helfer dann sofort bereit?
Vlasich: Man schafft es nicht von heute auf morgen, jemanden aus dem Spital zu holen. Mittlerweile gibt es daher ein Gruppe permanenter, angestellter Mitarbeiter, die in einem Team für Notfälle bereitstehen. In Frankreich, wo „Medecins sans frontieres" sehr bekannt ist, gibt es außerdem Abkommen mit Spitälern, die bereit sind, Ärzte kurzfristig für Einsätze freizustellen.
dieFurche: Sie waren selbst bei Einsätzen Wis waren Ihre Erfahrungen?
Vlasich: Mein erster Einsatz war 1992 in Bangladesh, wo es 20.000 Flüchtlinge aus Burma im Grenzgebiet gab. Unser Team war klein: eine Ärztin, eine Krankenschwester, ein Logistiker und ich. Man rechnete mit einem einfachen, kurzen Einsatz. Vor Ort stellte sich heraus, daß die Lager in schlechtem Zustand waren: Unterernährung, sehr schlechte hygienische Bedingungen (Leben auf engsten Baum ohne sanitäre Maßnahmen). Wir haben dort eine Basis-Medizinversorgung aufgebaut, eine Klinik eingerichtet, Ernährungs-zentren ins Leben gerufen, um den schwer unterernährten Kindern zu helfen ... Unterstützt von einem Dolmetscher begann ich mit klinischer Arbeit, behandelte 70 bis 80 Leute pro Tag. Es war eine große Umstellung: keine Hilfsmittel, nur die eigenen Sinne zur Diagnose. Medikamente hatten wir. Man muß lernen, sich auf die wichtigsten Fälle zu beschränken: Malaria, Lungenentzündungen ... Als die Not immer größer wurde (bald waren es 200.000 Flüchtlinge), verstärkte „Ärzte ohne Grenzen" den Einsatz auf zwei Teams von 25 Leuten. Ich war beeindruckt, wie gut, in dieser schwierigen Situation gearbeitet wurde: Wir hatten Material, wurden technisch-fachlich von Spezialisten unterstützt. Und alles wurde extrem rasch auf die Beine gestellt.
dieFurche: Wie finanzieren sie sich?
Vlasich: Mehr als 50 Prozent aus privaten Spenden. Es ist wichtig, daß wir nicht ganz von öffentlichen Geldern abhängig sind. Ohne private Mittel könnte man nicht schnell reagieren. Öffentliche Mittel zu bekommen, dauert meist lange. Mittlerweile gelingt es, rasch mit der EU Verträge zu unterzeichnen. Aber da wird nichts rückwirkend finanziert. Die erste Einsatzwoche, die meist sehr teuer ist, muß man eben privat finanzieren. Eine der wichtigen Aufgaben hier in Österreich wird es sein, private Spendengelder aufzutreiben.
dieFurche: Wo sehen Sie die größten Probleme in Sachen Menschenrechte?
Vlasich: Da ist sicher Burundi und Ruanda. Immer wieder steht man da vor der Frage: Ist es wichtiger zu helfen oder die Öffentlichkeit zu alarmieren. Tut man letzteres gefährdet man die Hilfe. In Ruanda wurden wir letztes Jahr ausgewiesen wie viele andere auch. Aber soll man medizinische Hilfe fortsetzen, wenn man damit die allgemeine Situation verschlechtert? In Tschetschenien haben wir in dieser Hinsicht auch große Probleme. Die Entführung zweier Mitarbeiter (denen zu guter Letzt nichts zustieß) zwang uns, die Art des Einsatzes zu überdenken. Wir wollen in keinem Fall das Leben unserer Leute in Gefahr bringen.
Das Gespräch
führte Christof Gaspari