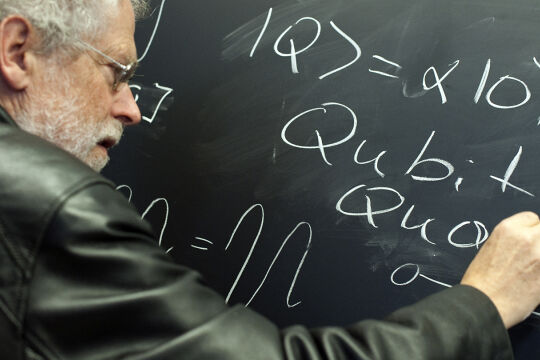Nobelpreisträger und trotzdem kein fixes Einkommen? O doch, sowas gab es. Ein Blick in die wundersame Welt der Nobelpreisträgerinnen.
Diese Woche hat die Wissenschaft einmal mehr ihre klügsten Köpfe gekrönt. In Stockholm wurden wie jedes Jahr um diese Zeit die Nobelpreise für Medizin (Montag), Physik (Dienstag) und Chemie (Mittwoch) verliehen. Vieles hat sich geändert, seit der erste Nobelpreis 1901 vergeben wurde. In den Anfängen wurde etwa Köche, Ehefrauen und Kinder für die Feierlichkeiten dazugenommen, um überhaupt ein Publikum zu haben. Heute trifft sich die wissenschaftliche High Society in Stockholms Konzerthaus. Einiges ist aber auch gleich geblieben - wie etwa die verschwindend kleine Anzahl an Top-Forscherinnen, die den Nobelpreis erhalten. Gerade mal zwei Prozent, um genau zu sein. Oder weniger abstrakt ausgedrückt: eine Nobelpreisträgerin pro Jahrzehnt.
Wissen ist Macht
Erklärungsbedürftig ist der geringe Frauenanteil in der Spitzenforschung schon. Der Ökonomie-Professor Larry Summers vermutete vor rund eineinhalb Jahren ein genetisches Handicap beim weiblichen Geschlecht. Er erntete massive Kritik und trat darauf als Präsident von Harvard zurück. Eine weitaus plausiblere Erklärung würde wohl eine Betrachtung der sozialen und politischen Umstände liefern. Beispielhaft hat dies die Wissenschaftsforscherin Hilary Rose in ihrem Buch Love, Power and Knowledge für die wenigen Nobelpreisträgerinnen in den Naturwissenschaften getan. Für Rose stellt der Nobelpreis gleichsam einen Mikrokosmos der Genderpolitik in den Wissenschaften dar. Doch warum hat sie sich auf Chemie, Physik und Medizin beschränkt und nicht auch die Preise für Frieden und Literatur berücksichtigt? "Weil vor allem den Top-Forschern mit dem Preis ein ungemein hohes symbolisches Kapital mitgegeben wird", so Rose im Interview. Konkret heißt das: Man wird für einen herausragenden Beitrag auf einem sehr kleinen Gebiet ausgezeichnet und wird dann zu allen möglichen gesellschaftspolitischen Fragen als Experte herangezogen. Unergründlich bleibt, wie der Nobelpreis die Bedeutung erlangt hat, die er heute hat. Offensichtlich jedoch ist: Frauen hatten und haben es schwer, überhaupt für die höchste wissenschaftliche Auszeichnung in Betracht gezogen zu werden.
So auch Marie Curie. Obwohl der Nobelpreis 1903 nicht so prestigeträchtig wie heute war, wollte die französische Akademie nur Pierre Curie und Henri Becquerel für ihre Verdienste um die radioaktive Strahlung vorschlagen. Marie Curie bekam ihn trotzdem - dank der Hilfe eines schwedischen Mathematikers und der Hartnäckigkeit ihres Mannes. 1911 erhielt sie ihn sogar ein zweites Mal - ganz allein - für die Entdeckung von Polonium und Radium.
Auch die nächsten zwei Nobelpreisträgerinnen wurden zusammen mit ihren Ehemännern ausgezeichnet: Irène mit Frédéric Joliot-Curie (1935) und Gerty mit Carl Cori (1947). Gerty Cori war dabei die erste Ehefrau, die in Stockholm auch sprechen durfte - den Mittelteil der Nobelpreisrede, Anfang und Schluss machten ihr Mann. Auffallend auch, dass Gerty Cori erst mit 53 und neun Jahre nach dem Nobelpreis eine normale akademische Anstellung erhielt. Zuvor hatte sie als unbezahlte Assistentin im Labor ihres Mannes gearbeitet.
Auch die vierte Nobelpreisträgerin, Maria Goeppert-Meyer, hatte zeitweise ohne Entgelt geforscht. Sie war mit einem Physiker verheiratet, erhielt 1963 den Physik-Nobelpreis - ohne ihren Mann. Jedoch teilte sie ihn mit Hans Jensen. Beide hatten gleichzeitig, aber unabhängig voneinander das Schalenmodell für Atome entwickelt. Nur ein Jahr später folgte der Nobelpreis für Dorothy Crawfoot Hodgkin für die Strukturaufklärung biologischer Substanzen - darunter auch Penicillin, ein gesellschaftlich relevantes Molekül, das Millonen von Menschenleben rettete. In Hodgkins Chemie-Labor waren stets gleich viele Männer wie Frauen beschäftigt. Das war damals sehr ungewöhnlich und ist es heute auch noch.
Bis zur nächsten Auszeichnung einer Frau sollten dreizehn Jahre vergehen: Rosalyn Yalow bekam den Medizin-Nobelpreis 1977 für eine medizinische Diagnosemethode. Auch ihr Weg war steinig: Sie kam aus einfachen Verhältnissen und ihre Familie wollte, dass sie Volksschullehrerin wird. Sie aber wollte an der Universität bleiben und blieb, zunächst als Sekretärin. 1983 kam der Nobelpreis für Barbara McClintock für die Entdeckung der springenden Gene.
Gerade in Hodgkin und McClintock glaubte Hilary Rose eine neue, feministisch geprägte Wissenschaft erkennen zu können. Hodgkin vertrat eine Wissenschaft, die humanen Zwecken diente. Und McClintocks Entdeckung eröffnete eine holistische Sichtweise des Lebens. Auf die erhoffte feministische Transformation der Wissenschaften angesprochen, meint Rose: "Damals war ich zu optimistisch. Heute erscheinen meine Ideen wohl als ziemlich naiv."
Neben McClintock erhielten zwei weitere Frauen in den 1980er Jahren den Nobelpreis: Rita Levi-Montalcini (1986) und Gertrude Elion (1988). Tatsächlich waren diese drei Nobelpreisträgerinnen allesamt greise Damen, zwischen siebzig und achtzig Jahre alt. Und ihre Bahn brechenden Experimente lagen zum Teil schon dreißig bis vierzig Jahre zurück. "In diesem hohen Alter lässt sich das symbolische Kapital, das der Nobelpreis mit sich bringt, nicht mehr so ausschlachten, wie wenn man jünger ist", ist Rose überzeugt. Dennoch hätte man glauben können, dass das Nobel-Komitee sich endlich der Top-Forscherinnen entsonnen habe, die es offensichtlich gab. Dem war nicht so. Seither gab es lediglich zwei weitere Preisträgerinnen: 1995 Christiane Nüsslein-Volhard und 2004 Linda B. Buck. Zumindest sind die Nobelistinnen jetzt etwa gleichalt wie ihre männlichen Kollegen.
Preisträgerin und Mutter?
Und Nüsslein-Volhard hat die Lorbeeren politisch zu nutzen gewusst. Unter anderem hat sie für Nachwuchswissenschafterinnen eine Stiftung eingerichtet. Mit den ausgeschütteten Geldern soll verhindert werden, dass junge begabte Frauen daheim bleiben, Hausarbeit machen und Vollzeitmütter werden. Wie Hilary Rose das findet? "Das ist natürlich eine pragmatische Lösung. Ich bin eher Utopistin. Für mich zeigen sich hier vor allem zwei Dinge: Erstens, dass es in den Naturwissenschaften heute eine unmenschliche Arbeitswut gibt. Zweitens, dass zurzeit eine neue dienende Klasse, ein Kinderbetreuungs-und Putzpersonal, entsteht. Das sind nicht die Veränderungen, die ich mir ersehnt habe. Als Feministin wünsche ich mir soziale Gerechtigkeit für alle Frauen und Männer".
Buchtipp:
Love, Power and Knowledge
Von Hilary Rose
Polity Press Verlag
Cambridge 1994, 326 Seiten