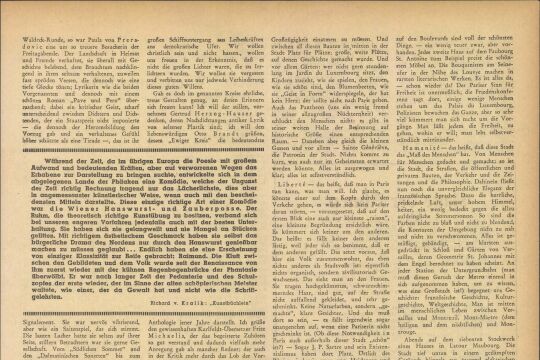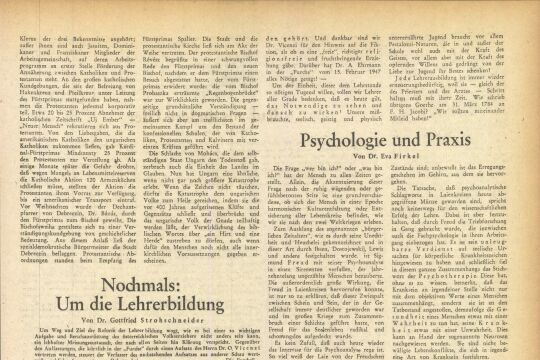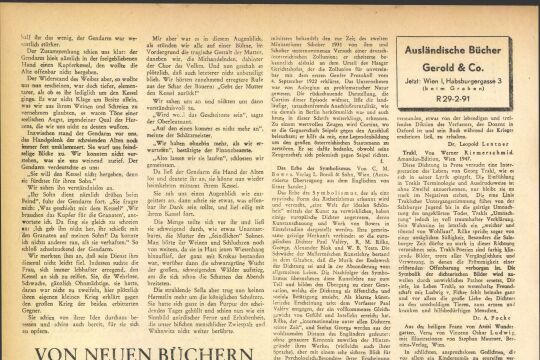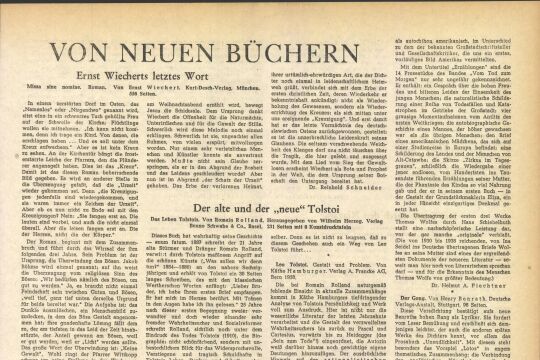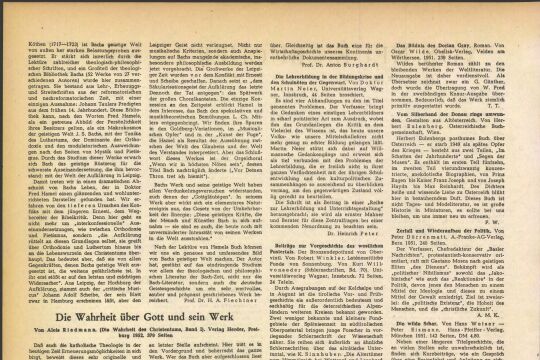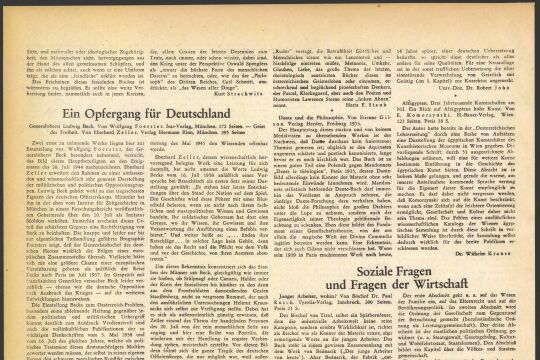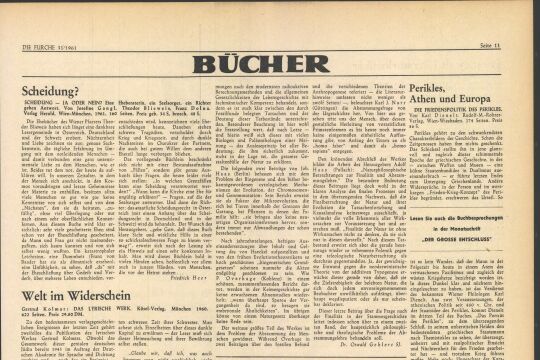Die Geologie entdeckt im 19. Jahrhundert, dass die Erde nicht ein paar tausend, sondern Milliarden von Jahren alt ist. Bei den damaligen Menschen löste diese Einsicht nachhaltige Irritationen aus.
"Haben Sie sich je in die Unendlichkeit des Raumes und der Zeit versenkt und die geologischen Werke von Cuvier gelesen? Haben Sie einmal, von seinem Genius wie von der Hand eines Zauberers getragen, über dem grenzenlosen Abgrund der Vergangenheit geschwebt?" Mit diesen Worten wendet sich Balzac 1831 an sein Lesepublikum. Zugleich fasziniert und verwirrt von der Lektüre der Forschungsarbeiten seines berühmten Zeitgenossen beschreibt er, "wie die Seele erschrickt, begreifend, dass da Milliarden von Jahren, Millionen von Gattungen waren", lange bevor der Mensch auf der Erde erschienen ist.
Das Erschrecken, welches der französische Romancier schildert, kann in Anlehnung an Sigmund Freud als "geologische Kränkung" bezeichnet werden. Freud hat bekanntlich drei zentrale "Kränkungen" des Menschen durch die Wissenschaft ausgemacht: Eine "kosmologische" durch die kopernikanische Revolution, eine "biologische" durch die darwinistische Evolutionstheorie und schließlich - nicht ganz unbescheiden - eine durch die Psychologie. Wie der amerikanische Wissenschaftshistoriker Stephen Jay Gould bemerkte, fehlt in dieser Trias eine Kränkung, deren Auswirkungen auf die Moderne gar nicht überschätzt werden können: Diejenige durch die Entdeckung der geologischen "Tiefenzeit" ("deep time"), durch die der überschaubare Rahmen einer christlich verstandenen Weltgeschichte von knapp 6000 Jahren gesprengt wurde. Nun wurden Zeiträume von vielen Jahrmillionen erahnbar, was die temporale Dimension der menschlichen Existenz in einem ganz neuen Licht erscheinen ließ. Es öffnete sich der von Balzac erwähnte Zeitabgrund, bei dessen intensiver Betrachtung man, wie Goethe kurz vor seinem Tod in einem Brief an Zelter bemerkte, "wahnsinnig" werden könnte.
Beunruhigende Marginalisierung
Hatte die "kosmologische Kränkung" im 16. Jahrhundert eine räumliche Dezentrierung zur Folge gehabt, so ergab sich durch die Erschließung geologischer Zeiträume eine nicht minder beunruhigende temporale Marginalisierung des menschlichen Lebens und der menschlichen Kultur. Überall wurde nun, wie Gotthilf Heinrich Schubert 1852 formulierte, eine Vergangenheit sichtbar, "welche zu dem Menschen saget: ich kenne dich nicht." Wann die Geschichte dieser Kränkung genau einsetzt, ist nicht einfach zu bestimmen. Verschiedene Spuren sind bereits in der Aufklärung auszumachen. Breitenwirksam setzte sich die Vorstellung einer sich unendlich langsam entwickelnden Erdgeschichte allerdings erst im 19. Jahrhundert durch, und wie stark die heraufkommende Moderne dann von dem gleichermaßen faszinierenden wie erschreckenden Blick auf diese Geschichte geprägt wurde, erweist sich zunächst an der intensiven Rezeption naturwissenschaftlicher Werke, in denen frühere Entwicklungsstadien der Erde rekonstruiert wurden. Hier wurden gleichsam untergegangene Welten wieder neu geschaffen, weshalb Balzac auch meinte, Cuvier sei im Grunde der "größte Dichter" des 19. Jahrhunderts. Die Begeisterung des Publikums über diese wissenschaftlichen Schöpfungsakte kannte kaum Grenzen.
Die Entdeckung der Langsamkeit
Die Schriften von führenden Wissenschaftlern wurden immer wieder neu aufgelegt und in verschiedene Sprachen übersetzt, und die neuen Entdeckungen wurden auch in einer Fülle von populärwissenschaftlichen Publikationen verbreitet, so dass es nur als leichte Übertreibung zu werten ist, wenn die Schriftstellerin Harriet Martineau im Rückblick auf ihr Leben im viktorianischen England bemerkte: "Leute aus dem Mittelstand erwarben im Allgemeinen fünf Exemplare eines teuren geologischen Werkes auf einen der beliebtesten Romane ihrer Zeit."
Die Konzeption der Tiefenzeit hat wesentlich zu tun mit der Einsicht in die unendliche Langsamkeit geologischer Prozesse. Zumal im Lichte einer "aktualistischen" Theorie wie derjenigen des vielleicht bedeutendsten Geologen des 19. Jahrhunderts, Charles Lyell, das heißt im Lichte einer Theorie, die davon ausgeht, dass für die geologische Vergangenheit keine anderen Veränderungsprozess vorausgesetzt werden dürfen als solche, die auch noch in der Gegenwart im Gange sind, wurden damals viele geologische Phänomene erklärbar als (Zwischen-)Resultate einer unendlichen Akkumulation von beständig wiederholten Mikroveränderungen. Hier wurde ein Entwicklungsrhythmus wenn nicht sicht- so doch denkbar, der in seiner Langsamkeit jenseits jeden menschlichen Maßstabs liegt; ein Rhythmus, der in schärfstem Gegensatz steht zur - mit Goethe zu sprechen - "veloziferischen" Beschleunigungskultur der heraufkommenden Moderne. Ist die Diskussion um die Zeitkultur der Moderne und ihre ästhetischen Implikationen oft einseitig auf die dramatische Akzeleration des Lebens fokussiert, wird im Blick auf die intensive Auseinandersetzung des 19. Jahrhunderts mit der Tiefenzeit deutlich, dass das Moment der Beschleunigung immer in Relation zu sehen ist zum gleichzeitig erwachten Bewusstsein um eine Langsamkeit, die ebenfalls von grundlegender Bedeutung ist für die Moderne.
Inwiefern die Entdeckung der geologischen Zeitabgründe und der Erdgeschichte für die Literatur bedeutsam war, zeigt sich exemplarisch an Balzacs Rede von Cuvier als "größtem Dichter". Vor allem wird in dieser Formulierung auch deutlich, dass es bei der Frage nach der Beziehung von Literatur und Geologie nicht nur darum geht, wie wissenschaftliche Erkenntnisse und Motive in literarischen Werken übernommen wurden. Vielmehr wird der Blick auf den Umstand gelenkt, dass auch in den wissenschaftlichen Texten mit literarischen Mitteln gearbeitet wird. Das erweist sich nicht nur an den zahlreichen Metaphern und Sprachbildern, auf welche die Geologen in ihren Darstellungen zurückgreifen, sondern auch an den Erzählmustern, nach denen sie ihre Großnarrative über die Erdgeschichte ordnen.
"Der Mensch nur ein Einschiebsel"
Unter diesen Großnarrativen lassen sich im 19. Jahrhundert grundsätzlich zwei verschiedene Varianten unterscheiden. Die einen sind geprägt von Versuchen, eine Geschichte mit Anfang und Ende zu erzählen, wobei die Erzählung des Endes oft apokalyptischen Mustern folgt; so beispielsweise in der - auf den französischen Naturgeschichtler Buffon zurückgehenden - Theorie einer schließlichen Vereisung der Welt. Daneben wird aber auch eine andere Narrativ-Variante entwickelt, in der es weder um einen Anfang, noch um ein Ziel der Erdgeschichte geht. Vielmehr sprechen die Vertreter dieser Variante nur von beständigen und nicht einmal immer gerichteten Prozessen, wie etwa James Hutton, der seine "Theory of the Earth" mit dem Satz abschloss: "Das Ergebnis der vorliegenden Untersuchung ist [...], dass wir keine Spur eines Anfangs, kein Anzeichen eines Endes finden."
Aber ganz gleich, ob die Erdgeschichte nach zyklisch-endlosen oder nach teleologisch-gerichteten Mustern erzählt wurde; ihre Entdeckung und Rekonstruktion löste im 19. Jahrhundert nachhaltige Irritationen aus. In ihr erschien sowohl das einzelne menschliche Leben wie das Leben der Gattung in erschütternder Weise marginalisiert, wie beispielsweise auch Heinrich Drendorf, der Protagonist in Adalbert Stifters "Nachsommer", erfahren muss, als er sich in seinem Bildungsgang der Geologie zuwendet. Diese Beschäftigung lehrt ihn, dass - wie er posthumane Szenarien im Sinne Nietzsches antizipierend formuliert - "die Geschichte der Erde, die ahnungsreichste, die reizendste [ist], die es gibt, eine Geschichte, in welcher die der Menschen nur ein Einschiebsel ist, und wer weiß, welch ein kleines".
Der Autor ist Germanist an der Uni Zürich und derzeit als Research Fellow am IFK in Wien.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!