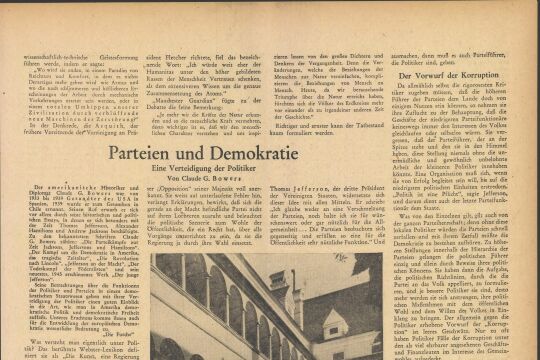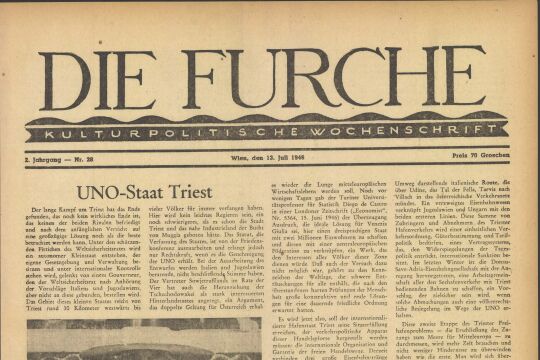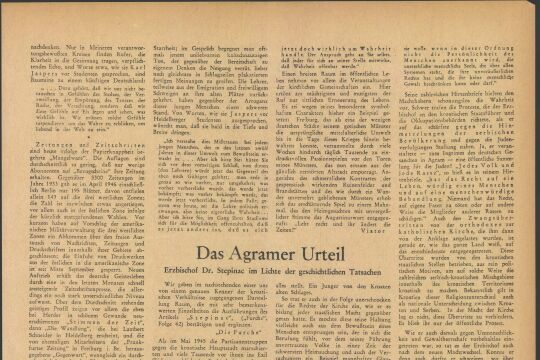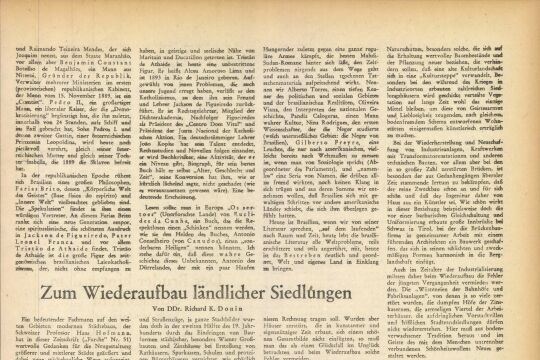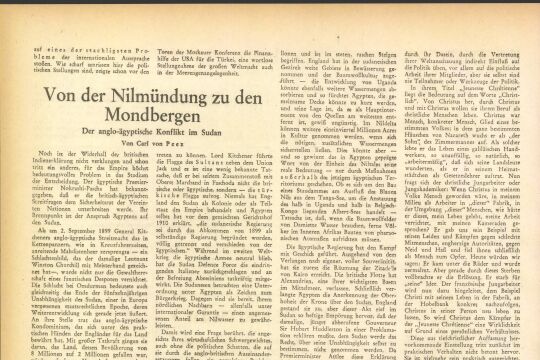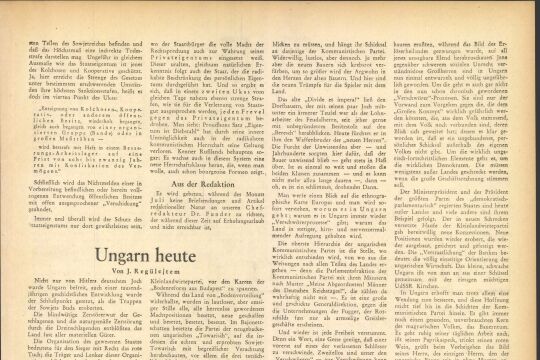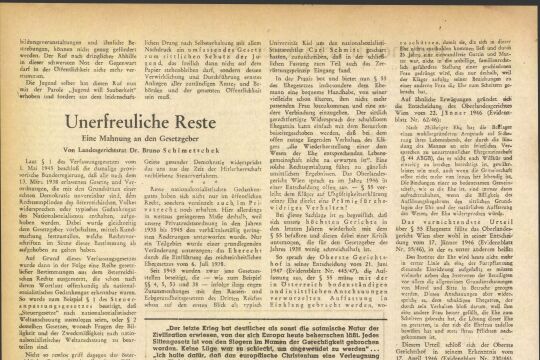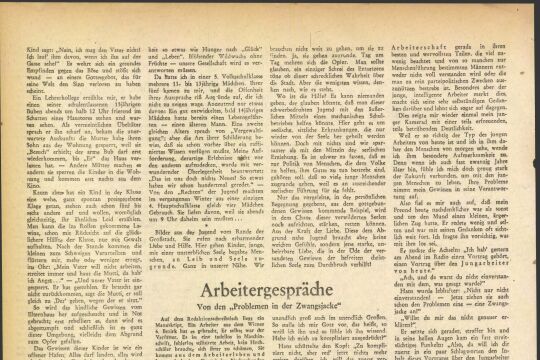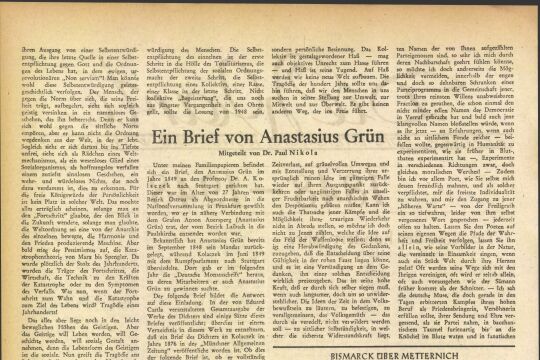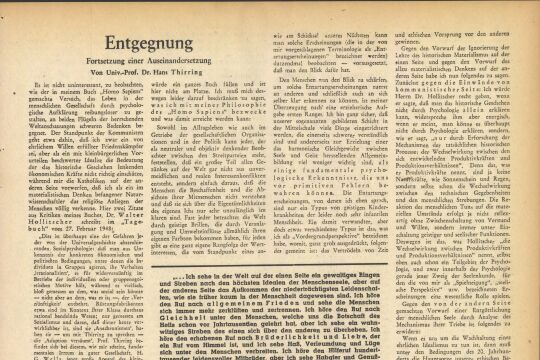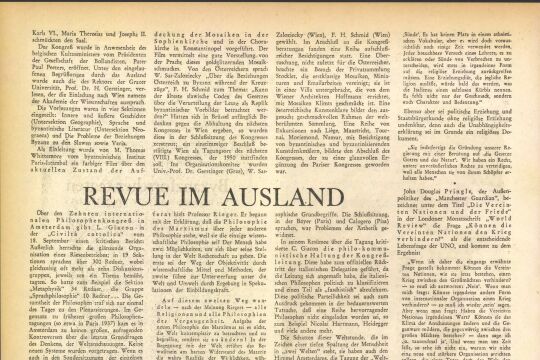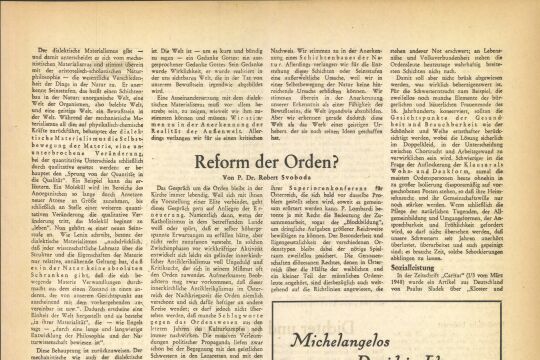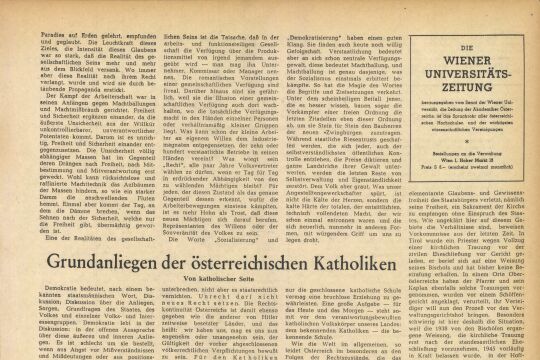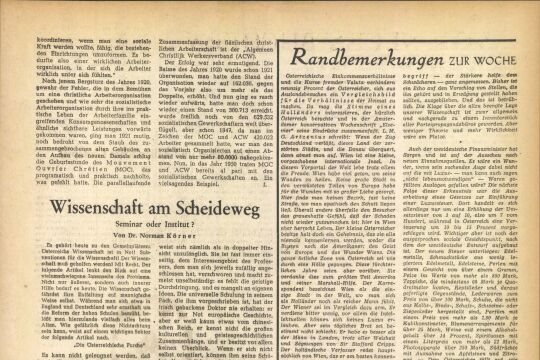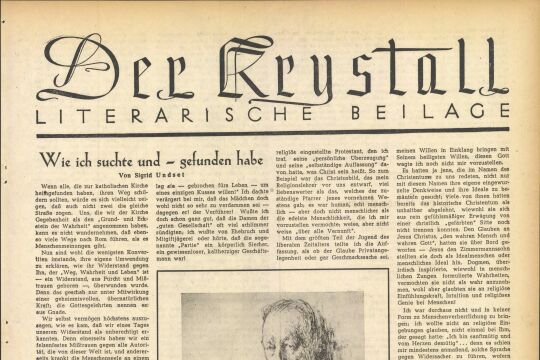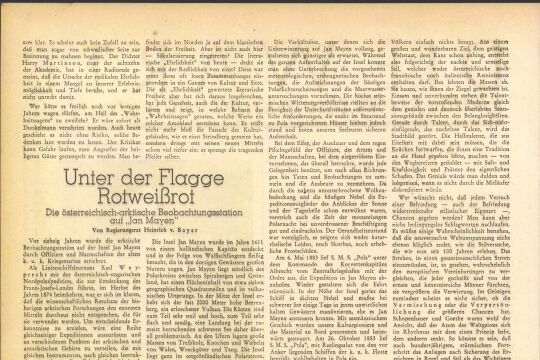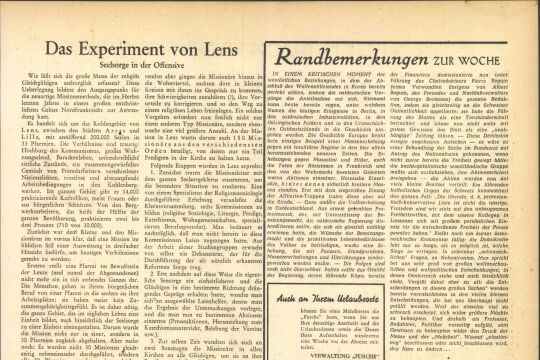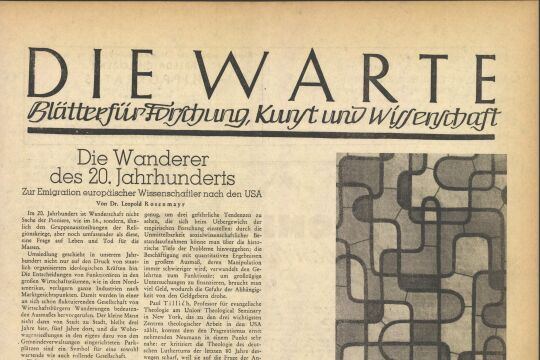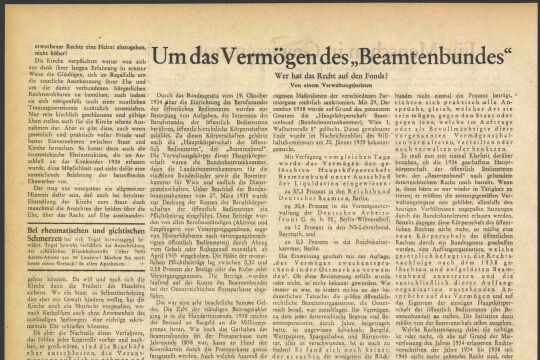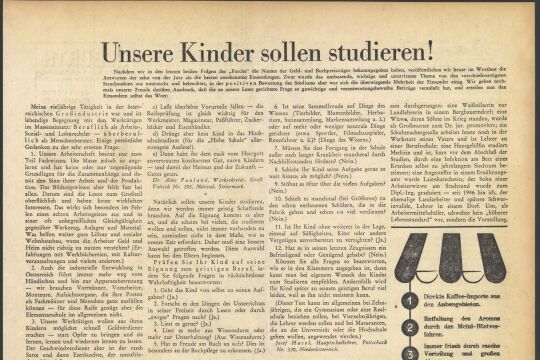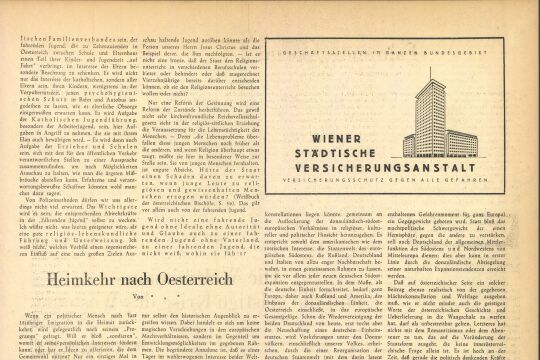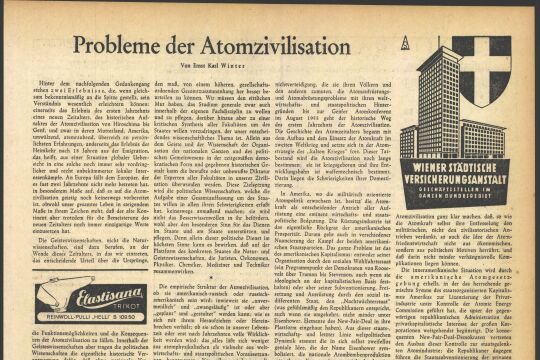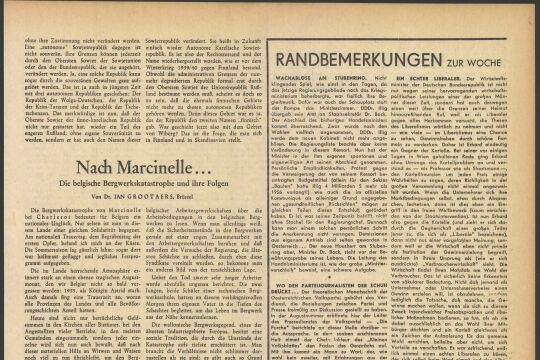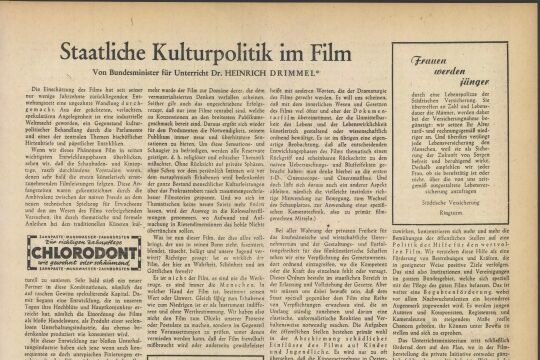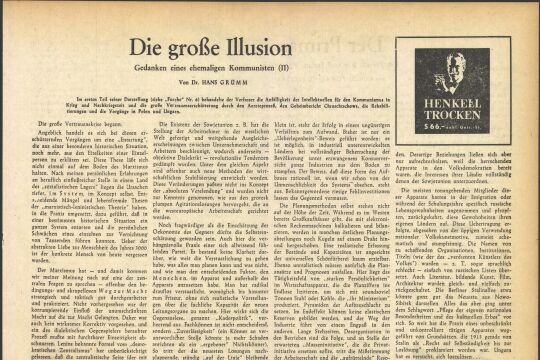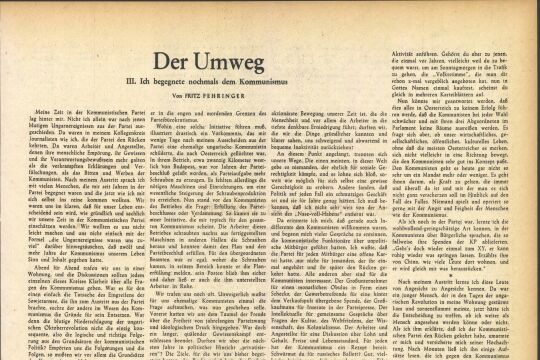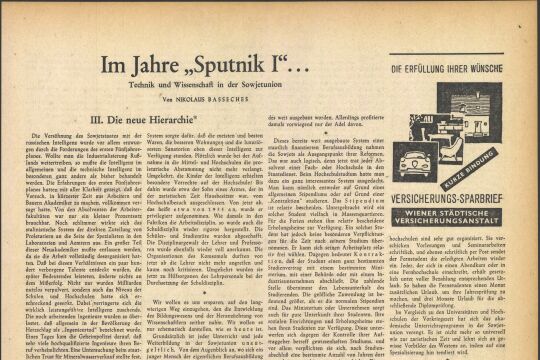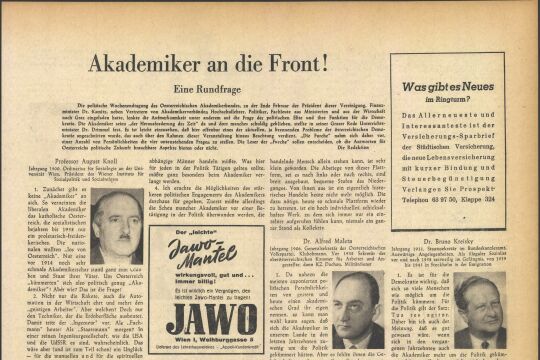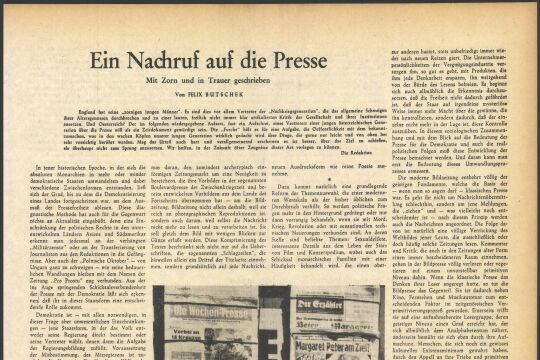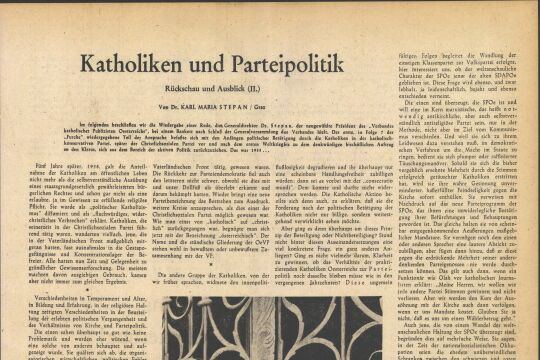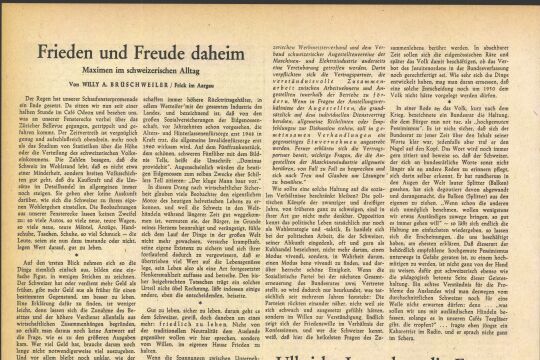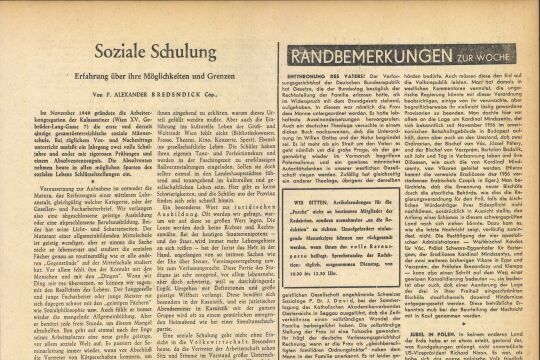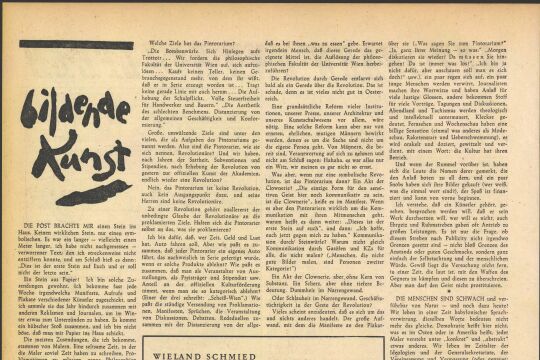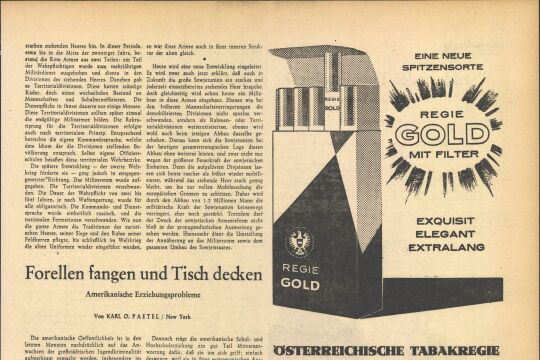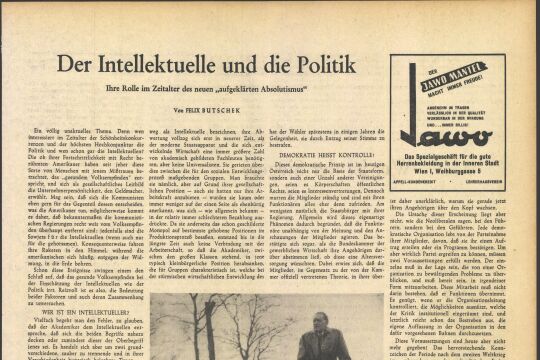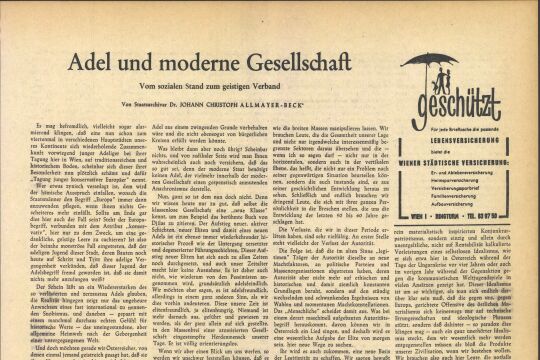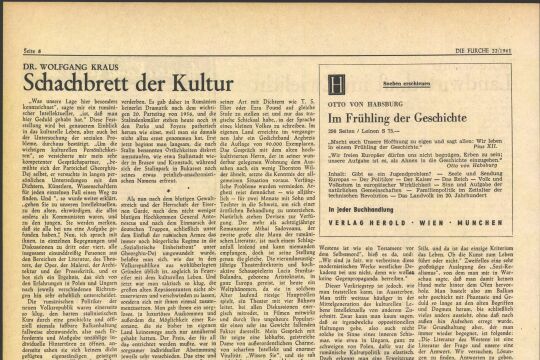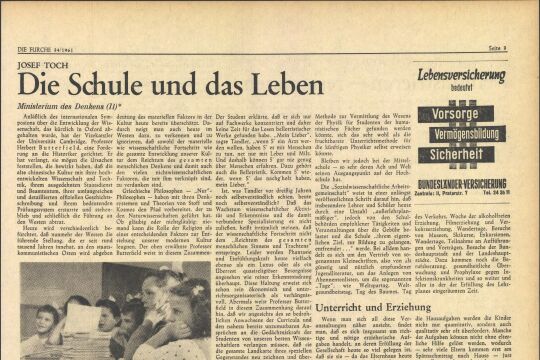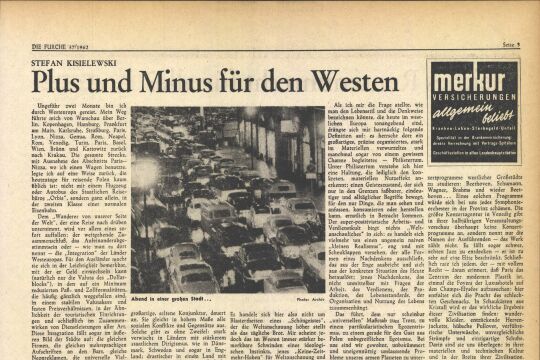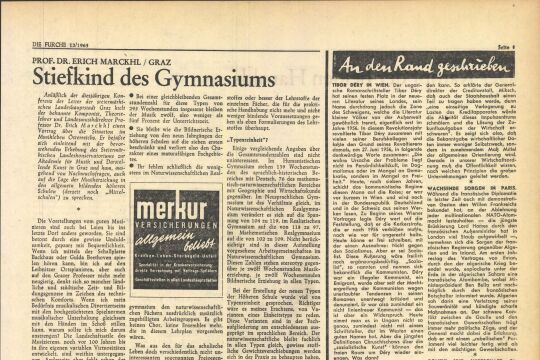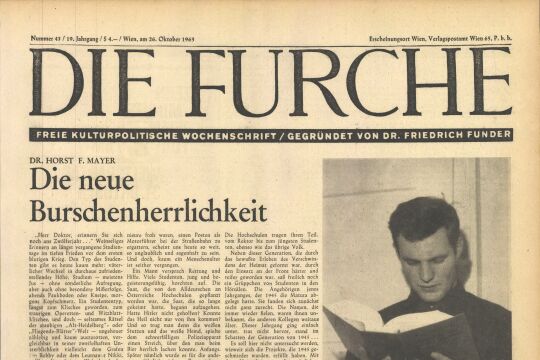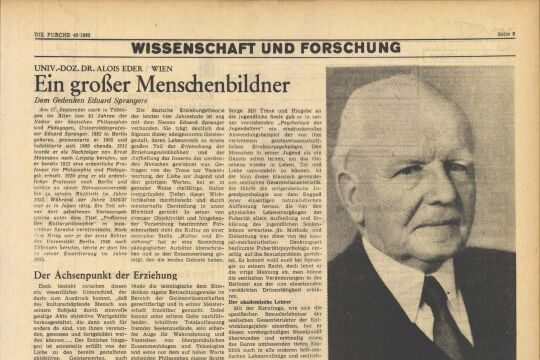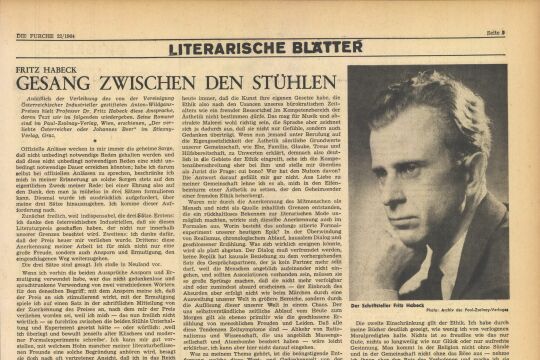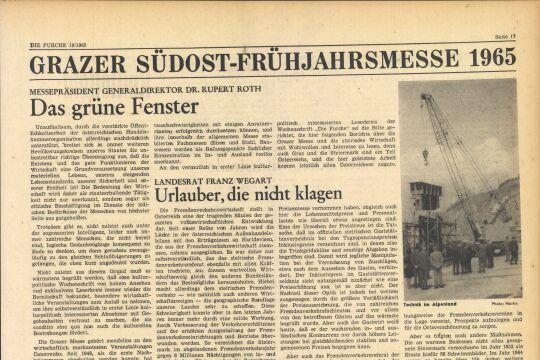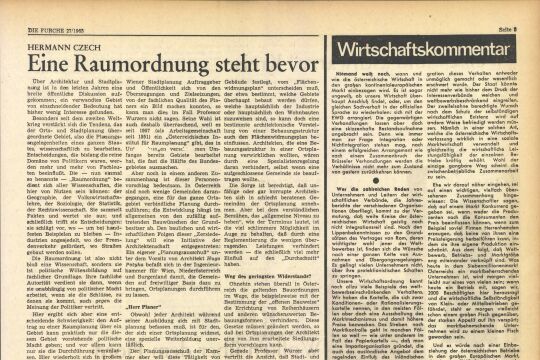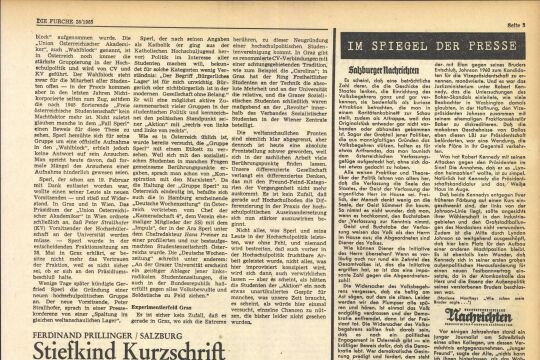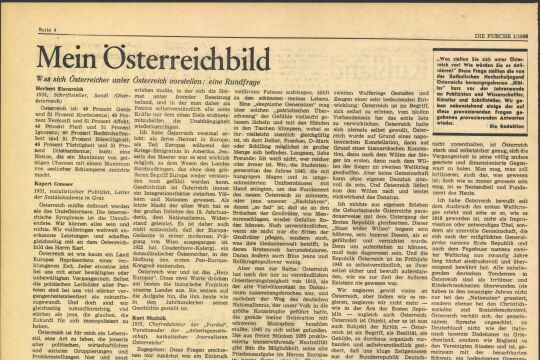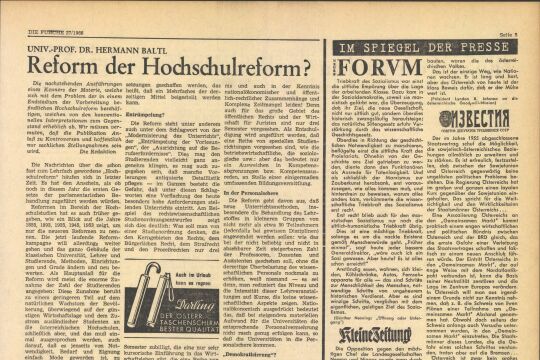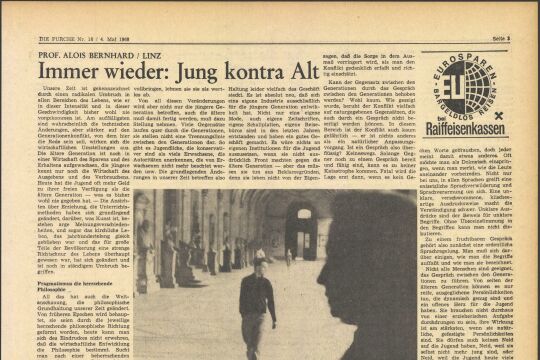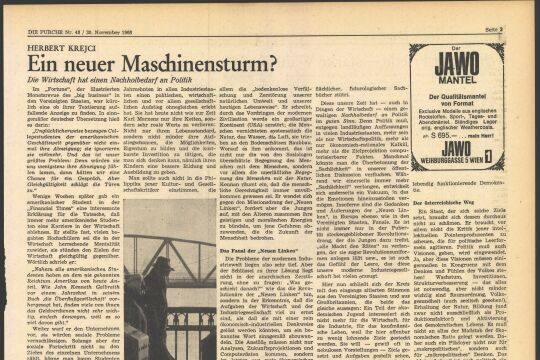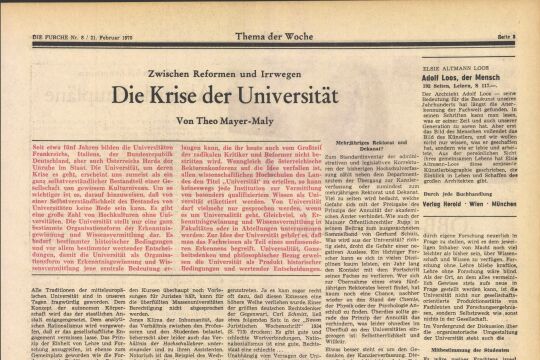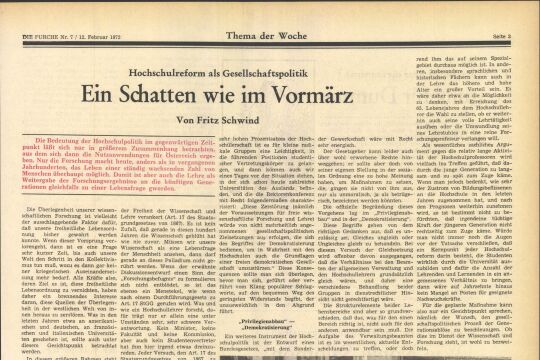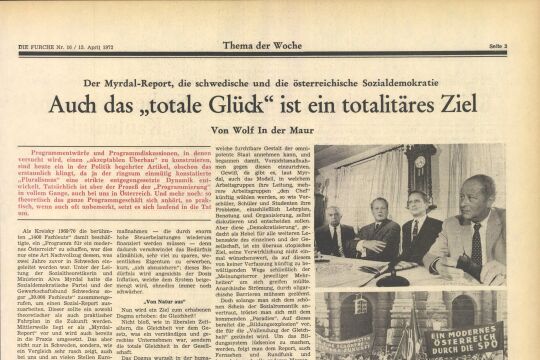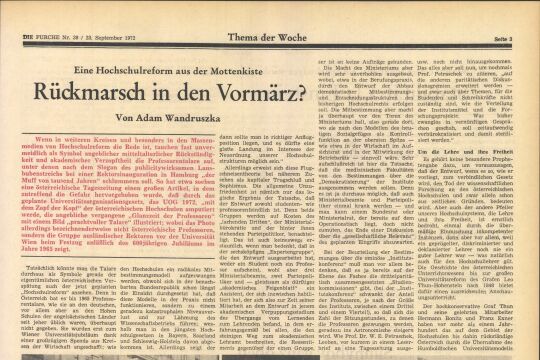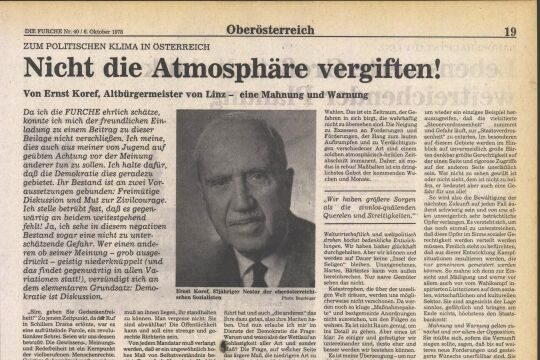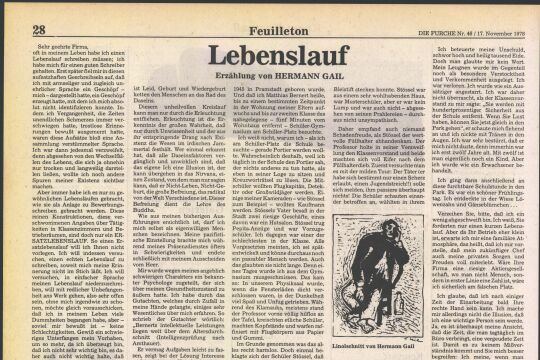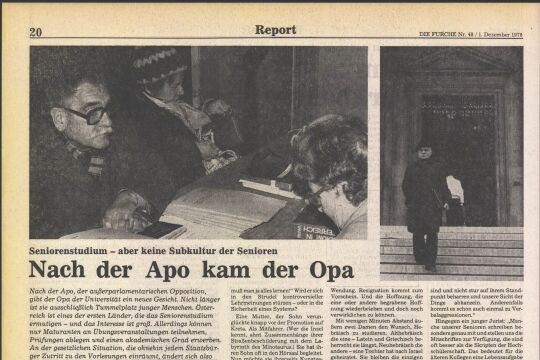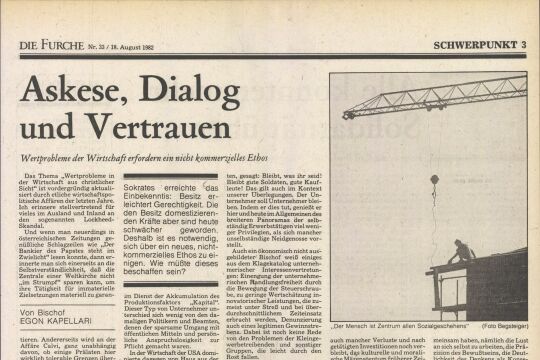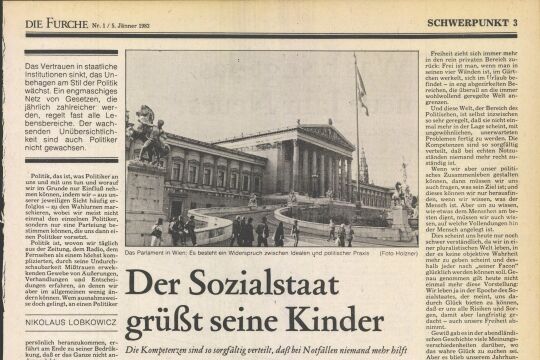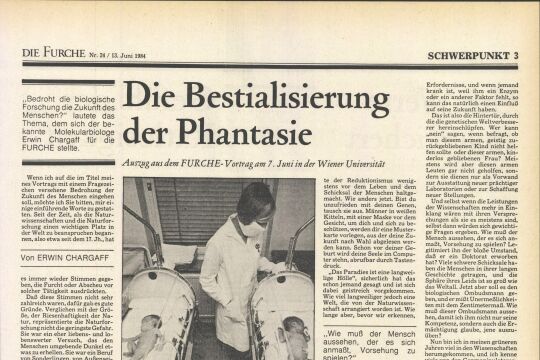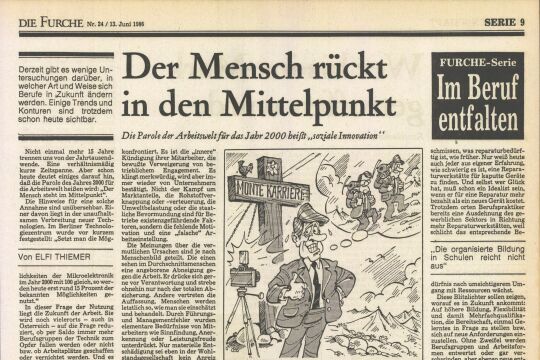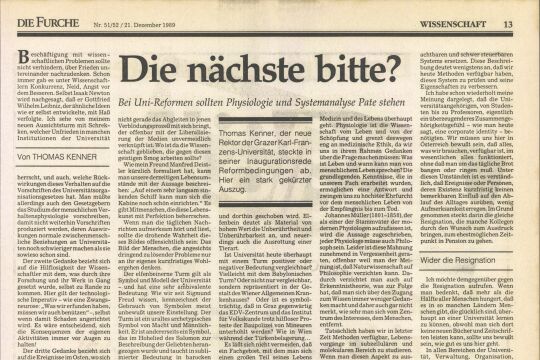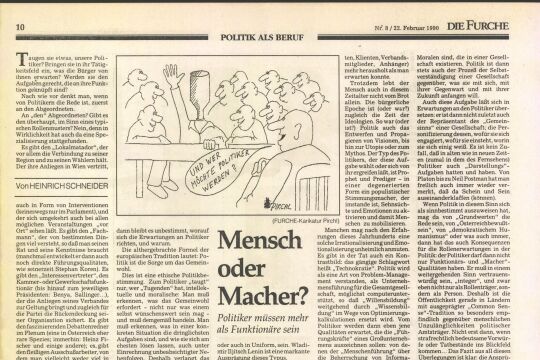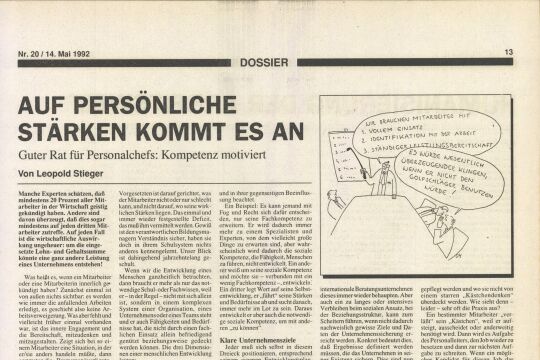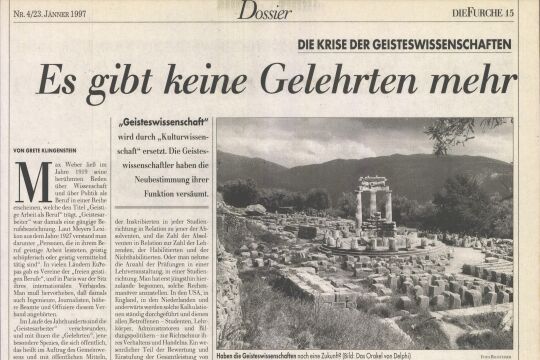Schafft Wissen!
DISKURS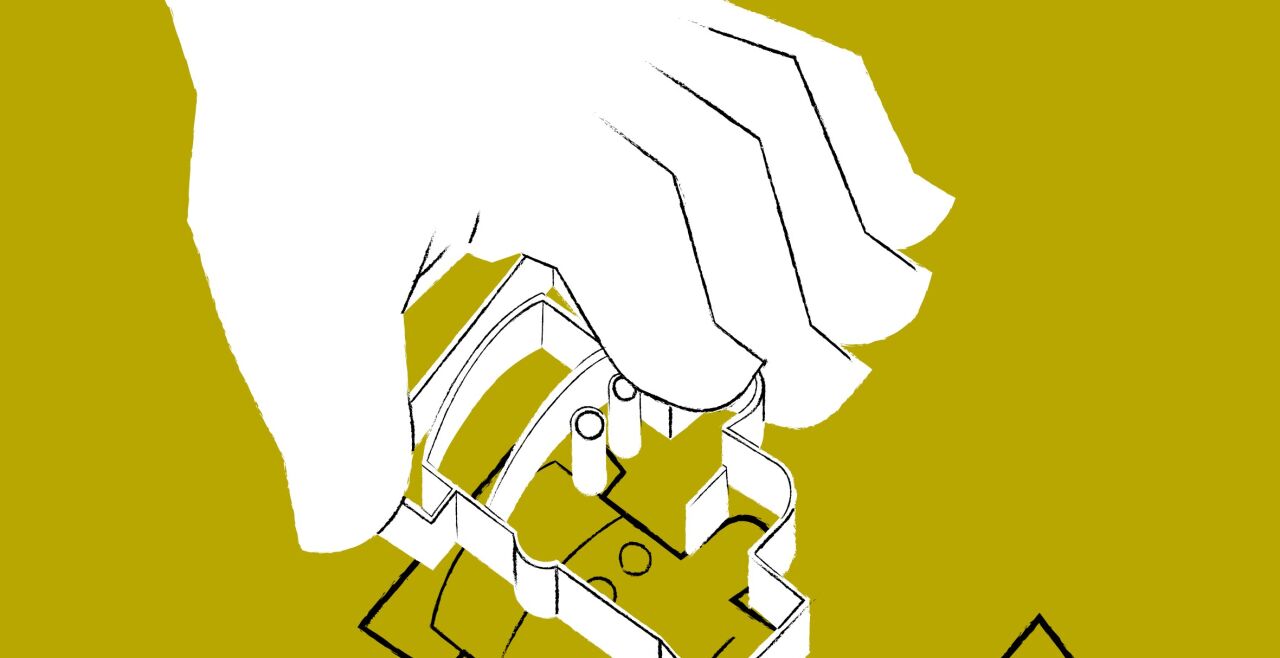
Universitäten: Gleicher als gleich
Die Demokratisierung der Universitäten geht mit einer Anpassung und Normierung des Denkens einher. Auf der Strecke bleiben die Freigeister der Forschung. Erinnerungen eines Emeritierten.
Die Demokratisierung der Universitäten geht mit einer Anpassung und Normierung des Denkens einher. Auf der Strecke bleiben die Freigeister der Forschung. Erinnerungen eines Emeritierten.
Ich selbst begann meine Universitätslaufbahn noch im alten System der staatlichen Universität, um schließlich, als außerordentlicher Professor, in den unkündbaren Beamtenstand versetzt zu werden. Diese Art von Souveränität hatte zwei Seiten. Die eine Seite erzeugte ein Gefühl, weniger einem Beruf als einer Berufung zu folgen. Die andere Seite war unerfreulich. Unter dem Deckmantel der „Pragmatisierung“ schlichen sich Schlendrian, schlechte Qualifikation und Parteilichkeit ein. In den folgenden Reformprozessen – Stichwort „Autonomisierung“ – wurden derlei Systemmängel besonders hervorgehoben.
Landläufig stellt man sich unter Autonomisierung eine Erhöhung der Freiheitsgrade vor, aber gemeint war etwas grundsätzlich Anderes: Die Universitäten sollten – grob gesprochen – strukturell wie ein Unternehmen am freien Markt funktionieren, und dies bedeutete – wiederum grob gesprochen –, dass sie, bei wechselseitiger Konkurrenz, mit dem Staat Verträge abzuschließen hatten, sogenannte „Leistungsvereinbarungen“, deren Basis umfängliche Lehr- und Forschungsprofile mit entsprechenden Schwerpunktsetzungen waren.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!