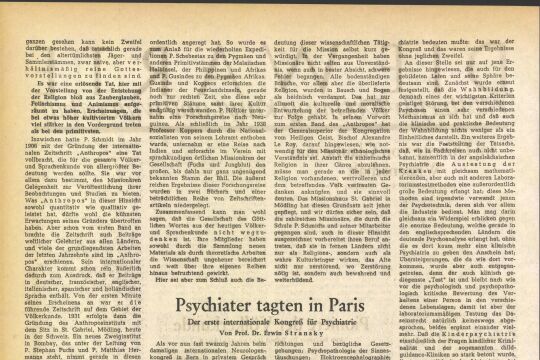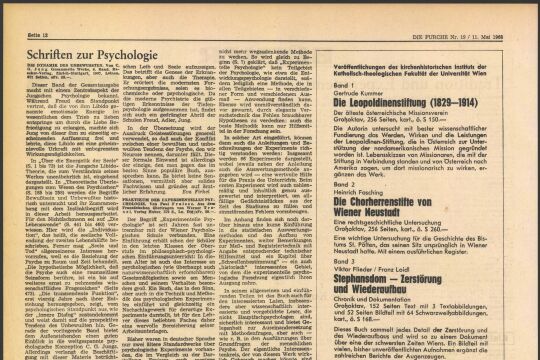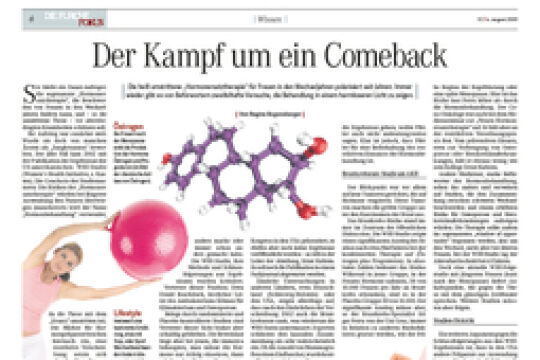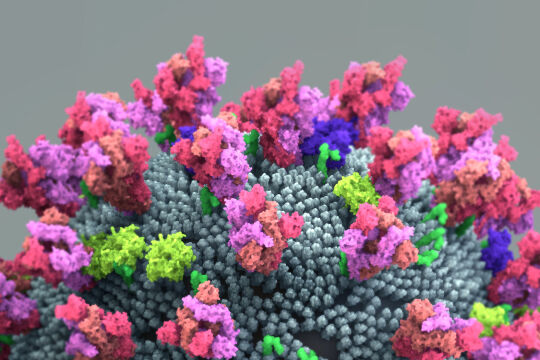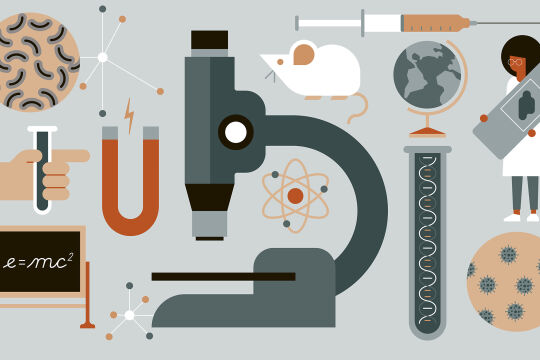Antidepressiva lehren viel: Über Medien, Pharmaindustrie, Medizin-Statistiker und -Praktiker. Von Thomas Mündle
Antidepressiva wirken kaum. So lautete eine Aufsehen erregende Schlagzeile der österreichischen Presseagentur APA Ende Februar. Hinter der Nachricht verbarg sich tatsächlich eine brisante Studie (PloS Medicine, 26.2.08). Jedoch wurden die Studienergebnisse in mehrfacher Hinsicht falsch interpretiert - und in dieser Form von einigen österreichischen (Qualitäts-)Medien unkritisch übernommen.
Besonders tragisch ist, dass am Ende der Pressemeldung die Dementi zweier großer Pharmafirmen angefügt wurden: "Andere Untersuchungen hätten sehr wohl die positive Wirkung der Medikamente gezeigt." Damit verfehlten die Journalisten die eigentliche Pointe der Studie, die nach besten Kriterien der evidenzbasierten Medizin argumentierte. Dem angloamerikanischen Team um Irving Kirsch ging es darum, auf verfälschende Effekte im Publikationssystem hinzuweisen.
Gewichtige Analyse
Dazu haben die Autoren eine sehr umfassende Meta-Analyse über die sechs am häufigsten verschriebenen Antidepressiva erstellt. Um die aus den 35 klinischen Studien gewonnene Aussage zu entkräften, müssten ähnlich viele Studien mit bedeutend besseren Resultaten vorliegen - die gibt es aber nicht. Am Schluss der Wissenschafter lässt sich folglich nicht rütteln: Die wichtigsten Antidepressiva wirken nicht signifikant besser als ein Placebo-Zuckerl - außer in sehr schweren Fällen (Doch das ist nicht gleichbedeutend mit der Botschaft: "Antidepressiva wirken kaum" - siehe Infokasten).
Anstatt die Statements der pharmazeutischen PR-Maschinerie abzudrucken, wäre es klüger gewesen, die amerikanische Zulassungsbehörde FDA um eine Stellungnahme zu bitten. Denn sie war die Quelle, von der Kirsch und Kollegen bis dahin unveröffentlichtes Datenmaterial angefordert hatten.
Dass die FDA mitunter pikante Studienergebnisse in ihren Schubladen parat hält, haben amerikanische Wissenschafter um Erick Turner ebenfalls unlängst eindrucksvoll gezeigt (NEJM, 17.1.2008). Sie analysierten 74 Studien von zwölf Antidepressiva und fanden Erstaunliches: Jede dritte bei der FDA registrierte Studie war nicht veröffentlicht worden. Und: Nach der publizierten Literatur brachten 94 Prozent der Studien ein tendenziell positives Ergebnis; von den FDA-Studien aber waren nur rund die Hälfte positiv.
Warum hält die FDA also solch kritisches Material unter Verschluss? Weil ihre Zulassungspolitik nach andern Regeln funktioniert. "Es müssen zwar alle klinischen Studien vorher angemeldet werden, letztlich benötigt man aber nur positive Ergebnisse von zwei unabhängigen Studien-Zentren", erklärt Professor Winfried Rief, klinischer Psychologe an der Universität Marburg, das Prozedere. Wie die andern Studien dann ausgehen, sei nicht von Belang.
Dass negative Ergebnisse sich nicht in den wissenschaftlichen Fachmagazinen wiederfinden, hat aber auch mit dem Publikationssystem zu tun. Negative Ergebnisse werden von der Scientific Community oft nicht als Ergebnisse akzeptiert. Sie haben es deshalb schwer, überhaupt veröffentlicht zu werden. "Statistisch signifikante Ergebnisse sind nach zehn Jahren zu 80 Prozent publiziert; bei nicht signifikanten Studien sinkt die Chance einer Veröffentlichung auf 20 Prozent", zitiert Professor Gerald Gartlehner, klinischer Epidemiologe an der Donau Uni Krems, eine australische Meta-Analyse.
Publish or perish
Wie wichtig die Publikationsliste für Karriere und Reputation eines Wissenschafters ist, bringt ein englischer Slogan auf den Punkt: publish or perish - publiziere oder gehe unter. Deshalb finden manche Wissenschafter auch Wege, um zu Ergebnissen zu kommen, die für sie (und den Studiensponsor) vorteilhafter sind - etwa durch eine gezielte Auswahl der Probanden.
Rief hat nachgewiesen, dass die-se Methode auch bei Antidepressiva angewandt wird. "Man entscheidet sich für Depressive mit einem bestimmten Schweregrad, hält die Stichprobe entsprechend klein und kann damit immense statistische Vorteile gewinnen." Solch tolle Resultate sind natürlich leicht in wissenschaftlichen Journalen unterzubringen. Jedoch entfernt man sich damit gleichzeitig von der klinischen Praxis, wo eine große Bandbreite an Depressiven auf medizinische Besserung hofft. Im Gegensatz zur Probandenwahl wirkt ein anderer Effekt wohl auch unbewusst: Die Wirksamkeit eines Antidepressivums wird im Regelfall von einem Mediziner bewertet; nur in jeder vierten Studie geben auch die Patienten ihr Befinden zu Protokoll. Rief fand in einer Analyse, dass die Ärzte den Placebo-Effekt viermal höher einschätzten als die Patienten. Und: Die Überbewertung der Wirksamkeit hat über die Jahre zugenommen.
Dass die Placebo-Wirkung bei Antidepressiva ungewöhnlich hoch ist, ist schon längere Zeit bekannt. Nach Rief beruht die Wirkung der Psychopharmaka zu einem Drittel auf Biochemie und zwei Drittel Psychologie. Natürlich bemüht sich die Pharmaindustrie bei neuen Medikamenten die biochemische Wirksamkeit kontinuierlich zu steigern.
Doch würde es sich nicht anbieten, die starken psychologischen Effekte gezielt einzusetzen? "Ich kann doch meinen Patienten nicht einfach ein Zuckerl geben. Das wäre ein Vertrauensbruch", argumentiert Manfred Stelzig, Primararzt und Psychotherapeut an der Uniklinik Salzburg. Auch Rief sieht ein ethisches Problem, wenn statt richtiger Medikamente nur mehr Placebo-Pillen verschrieben würden. Doch in anderer Hinsicht gibt es viel Spielraum. Dazu Rief: "Wahrscheinlich macht es einen Unterschied, ob die Schachtel lieblos über den Tresen geschoben wird oder aber damit positive Erwartungen verknüpft werden. Etwa mit Kommentaren wie: Das ist ein tolles Medikament. Das hilft." Auch könnte mit niedrigeren Dosen experimentiert werden. Konkrete Studien, die in diese Richtung gehen, gibt es bislang keine. Denn der Placebo-Effekt galt bis vor kurzem noch als bloßes medizinisches Kuriosum.
Schaden entsteht im Kopf
Dass Worte nicht nur helfen, sondern auch schaden können, hat Rief in einer anderen Studie belegt. Schon lange ist bekannt, dass die älteren Trizyklika-Antidepressiva mehr unerwünschte Wirkungen als die neueren SSRI-Antidepressiva zeigen. Rief nahm jedoch die Kontrollgruppen (die eine Pille ohne Wirkstoff bekamen) genauer unter die Lupe: Tatsächlich litten jene, die ein Trizyklika-Placebo schluckten öfters unter Nebenwirkungen als jene, die ein SSRI-Placebo einnahmen. Selbstverständlich wird der Arzt den Patienten auch in Zukunft über Nebenwirkungen aufklären müssen. Rief glaubt trotzdem, dass sich die schädlichen Effekte vermindern lassen. "Die meisten Nebenwirkungen auf den Beipackzetteln sind nicht wissenschaftlich belegt. Man erschreckt die Patienten und induziert reale körperliche Beschwerden."
Übrigens: Das Pharma-Marketing, das gerne Fakten schön redet, hätte in diesem Fall damit einen positiven Beitrag zur Gesundheit geleistet. Ein seltsamer Gedanke.