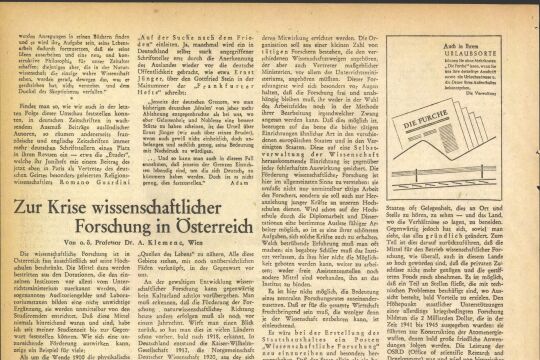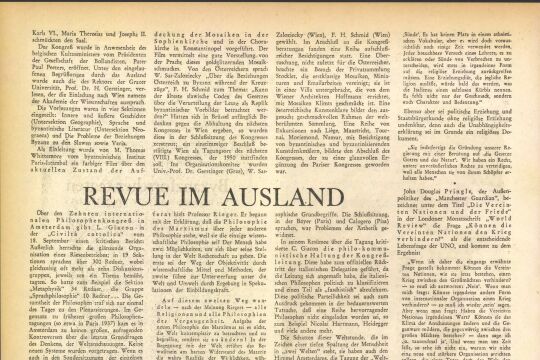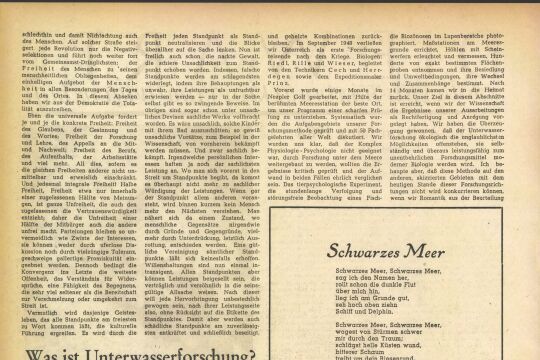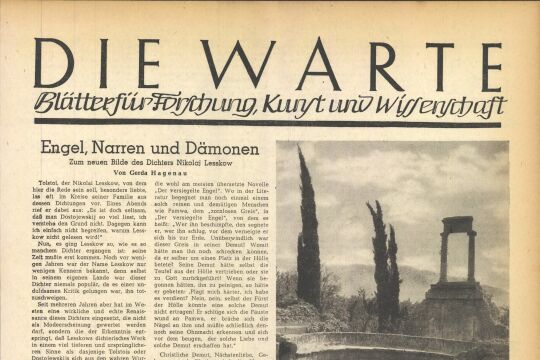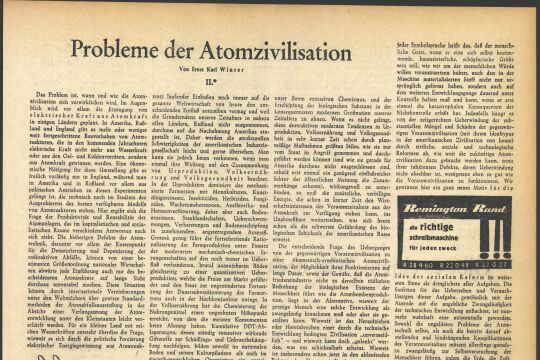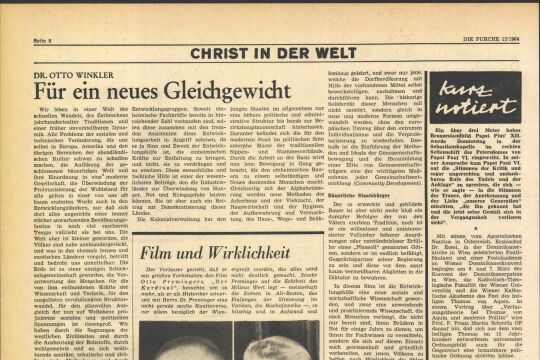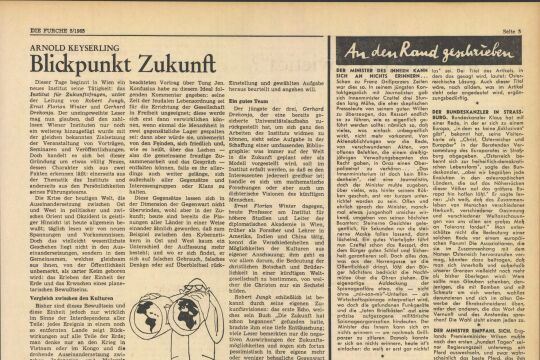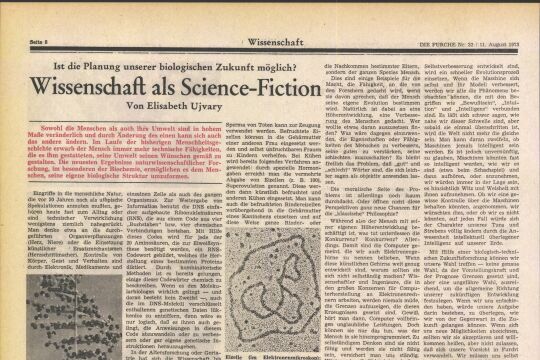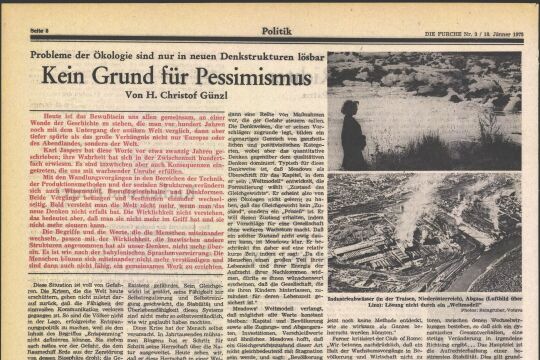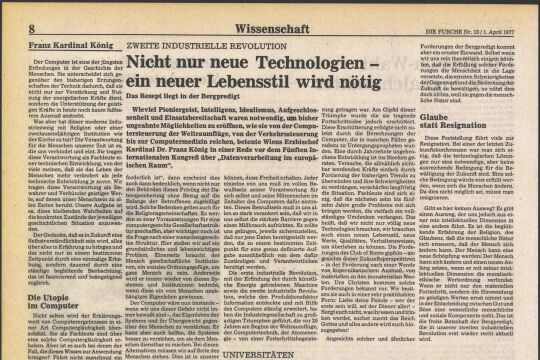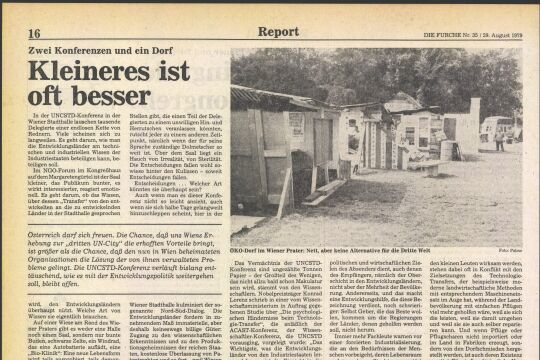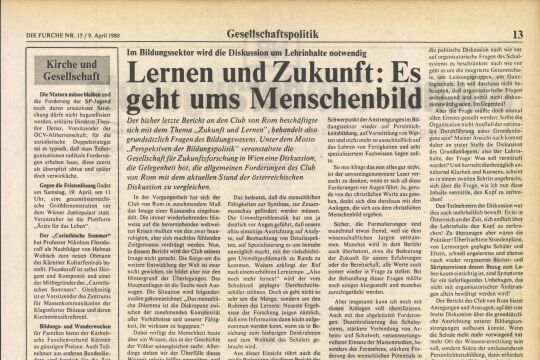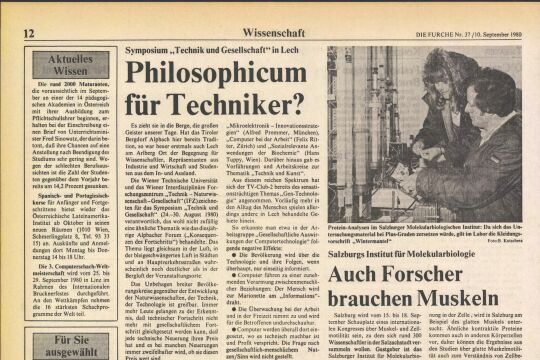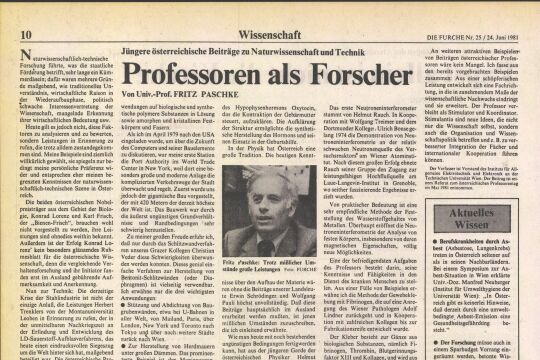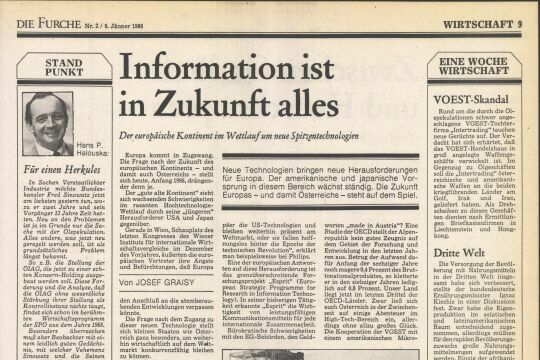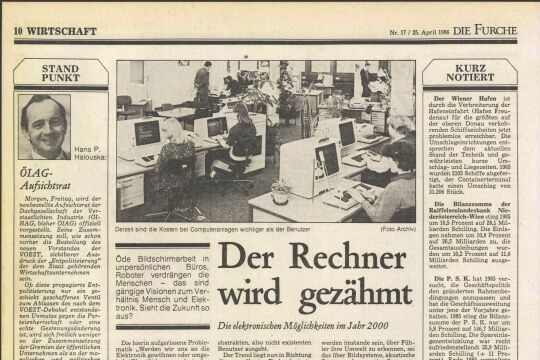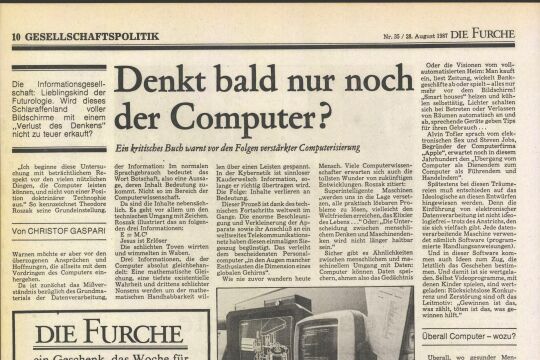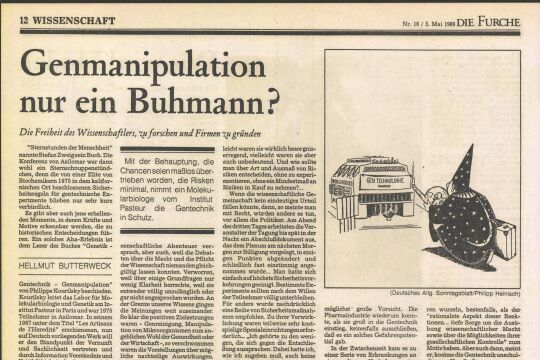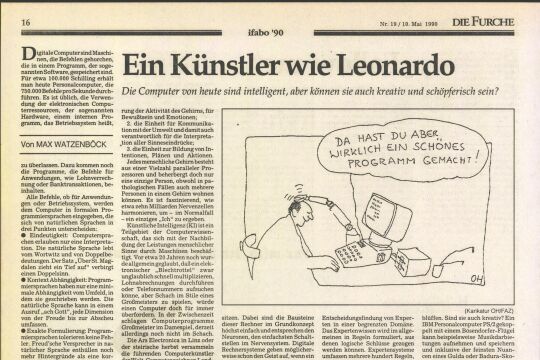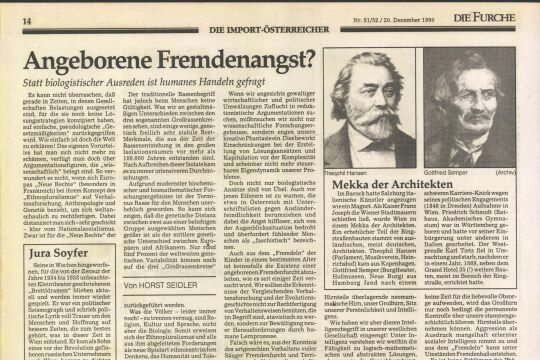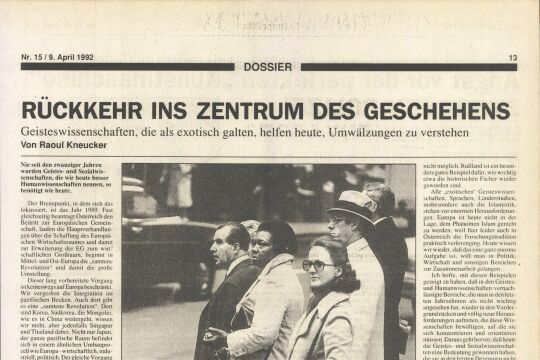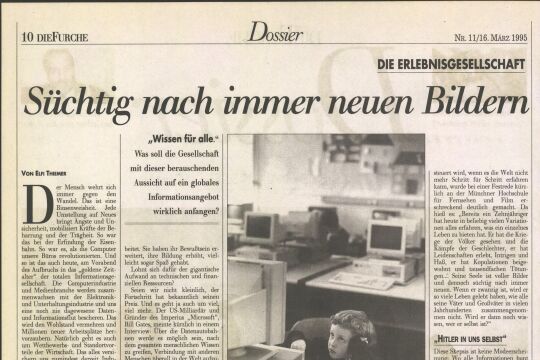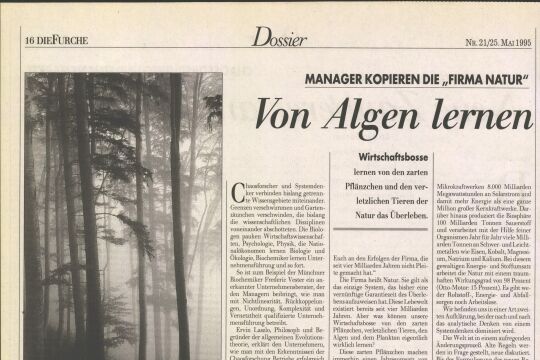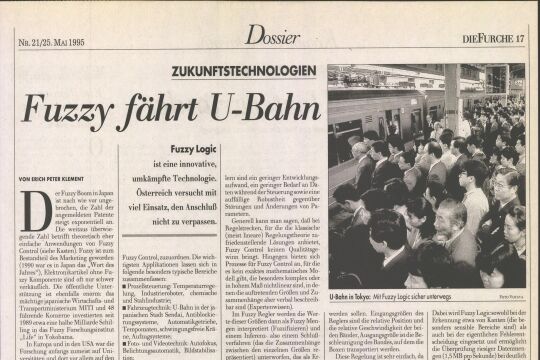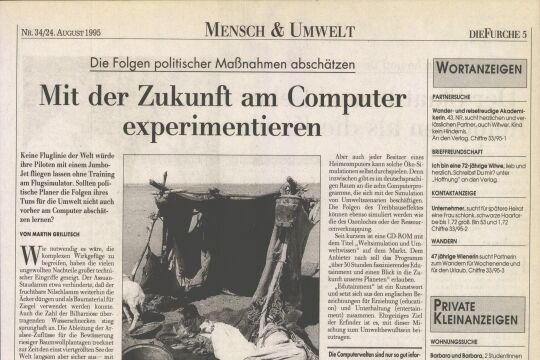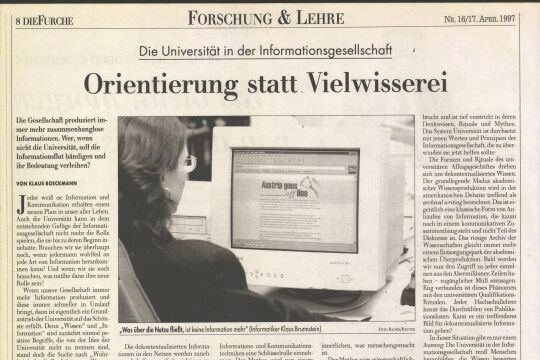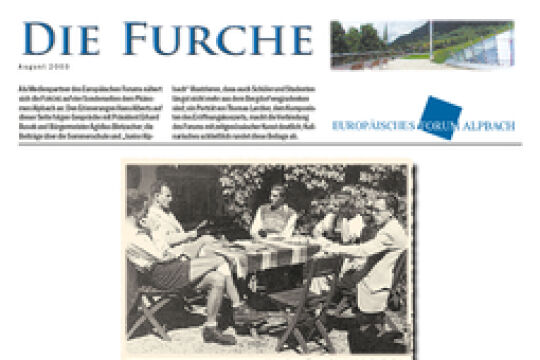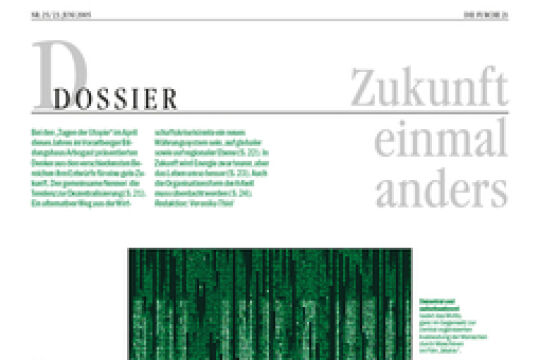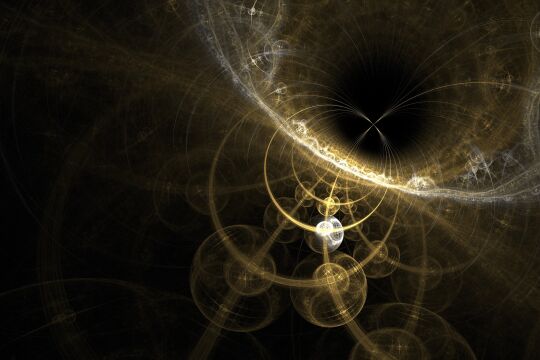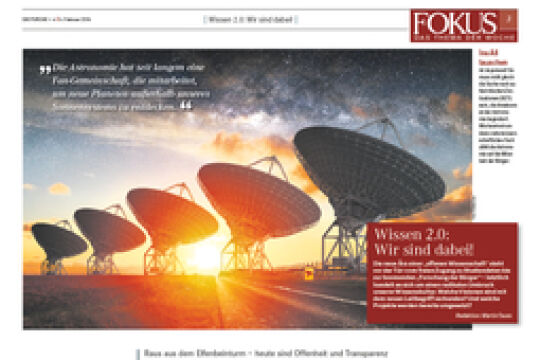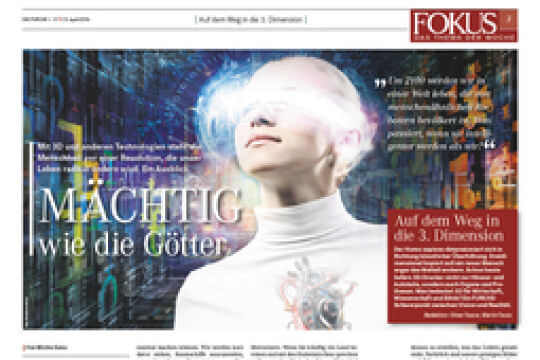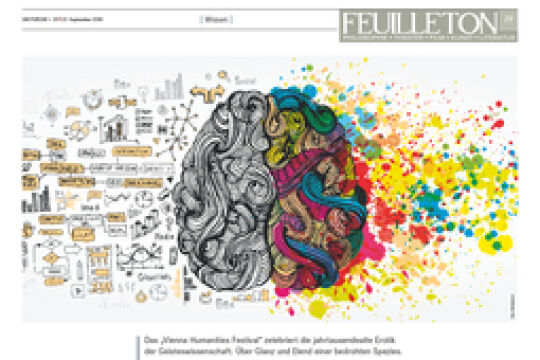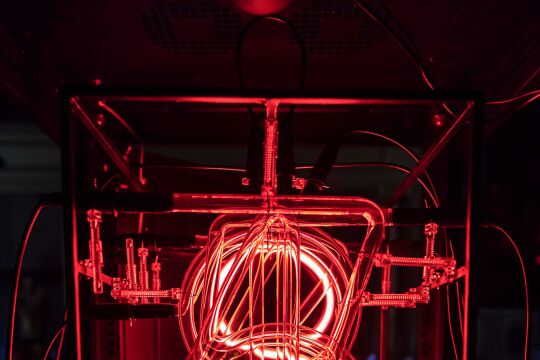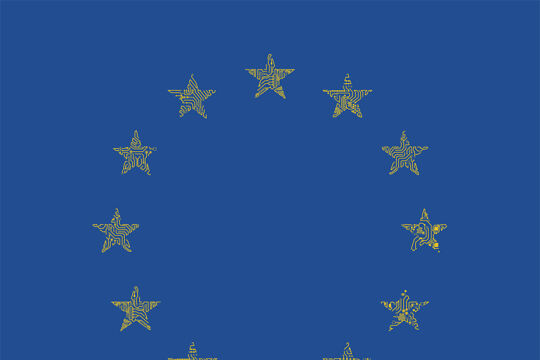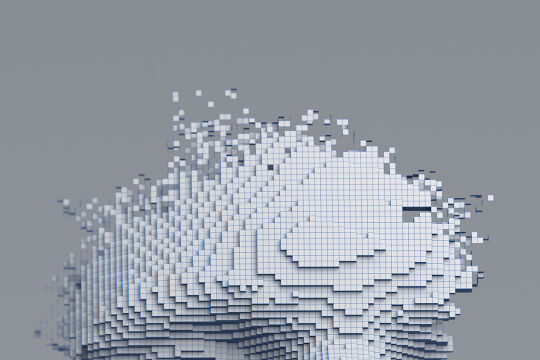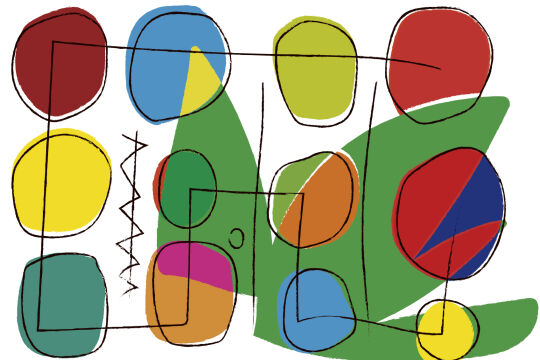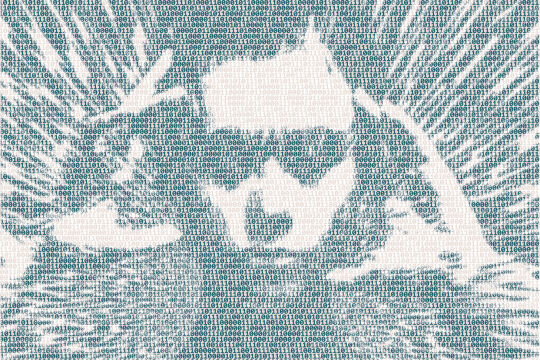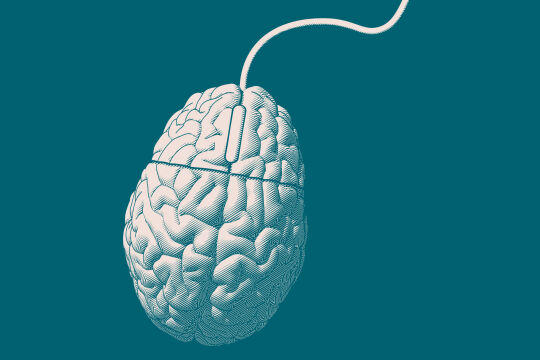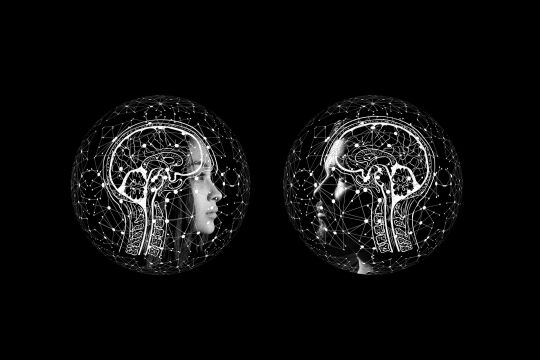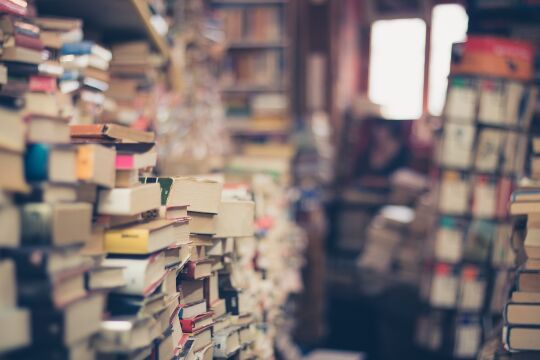Künstliche Intelligenz: „Ein Werkzeug wie jedes andere“
"Artificial Intelligence" ist das größte Innovationsthema des 21. Jahrhunderts. Sie sorgt für überschwängliche Utopien ebenso wie für schaurige Zukunftsvisionen. Umso mehr bedarf es eines nüchternen Blicks – unter verstärkter Beteiligung der Geisteswissenschaften.
"Artificial Intelligence" ist das größte Innovationsthema des 21. Jahrhunderts. Sie sorgt für überschwängliche Utopien ebenso wie für schaurige Zukunftsvisionen. Umso mehr bedarf es eines nüchternen Blicks – unter verstärkter Beteiligung der Geisteswissenschaften.
Künstliche Intelligenz (KI) wird oft nur in Extremen diskutiert, beobachtet Herta Nagl-Docekal. Die einen sehen in ihr die Lösung fast aller Probleme und ein großes Geschäft; andere fürchten, dass Roboter und Algorithmen bald die Weltherrschaft übernehmen werden. Höchste Zeit, dass „Artificial Intelligence“ sachlicher und differenzierter betrachtet wird, findet die emeritierte Philosophieprofessorin der Uni Wien. Sie hat daher angeregt, dass sich die Kommission „The North Atlantic Triangle“ der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) mit diesen brandaktuellen Fragen aus Sicht der Geistes- und Sozialwissenschaften beschäftigt.
„Wir haben damit vor zwei Jahren begonnen und wollten im März eine Konferenz dazu abhalten, aber die Pandemie hat das leider verhindert“, bedauert Waldemar Zacharasiewicz, Obmann der Kommission, die den kulturellen Austausch zwischen Europa, den USA und Kanada interdisziplinär untersucht. Die Konferenz wurde auf Herbst verschoben und konnte dann gerade noch als Hybrid aus Präsenz- und Onlineveranstaltung durchgeführt werden. Die gewünschte Diskussion zwischen den Disziplinen war dadurch eingeschränkt – aber sie fand nun statt.
Binärer Code, unendliche Optionen
Nach Ansicht von Sybille Krämer tut das dringend not. Die Philosophin an der Freien Universität Berlin hat heute eine Gastprofessur am Institut für Kultur und Ästhetik Digitaler Medien der Leuphana Universität in Lüneburg. „Artificial Intelligence“ sei bereits jetzt allgegenwärtig. Die Geisteswissenschaften müssten sich deshalb mit diesen Technologien auseinandersetzen, mahnt sie. Und zwar nicht nur mit Robotern in Film und Literatur oder mit ethischen Fragen, sondern auch damit, was Digitalität, „Deep Learning“ und all die anderen Aspekte der KI im Alltag bedeuten. „In den Geisteswissenschaften heißt es meist, die Binarität, also null und eins (die Grundlage für die Verarbeitung digitaler Informationen, Anm.), sei eine unglaubliche Reduktion. Aber es ist doch eigentlich eine unglaubliche Vielfalt! Aus nur zwei Elementen kann man unendliche Kombinationen erzeugen“, betont Krämer.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!