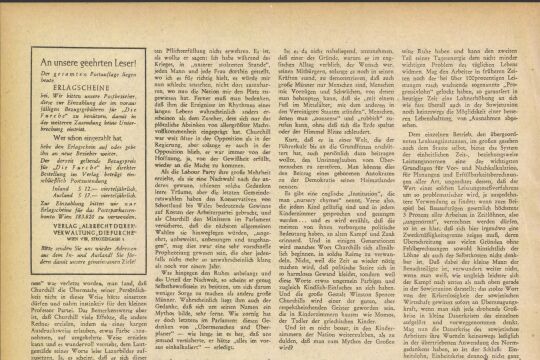Parkinsons Oesetz — oder Jie wachsende Pyramide
Kürzlich erschien in deutscher Uebersetzung ein Buch aus dem Englischen, „Parkinsons Gesetz” (Econ-Verlag, Düsseldorf). Der Verfasser namens Parkinson ist Universitätsprofessor, der sich mit Fragen der Geschichte und Gesellschaftswissenschaften befaßt. Als sein kleines Buch in England erschien, druckten die größten Zeitschriften Kapitel daraus ab und’ ganz Großbritannien lachte. Denn ein ernsthafter Forscher hatte ernste Fragen in humoristischer Form behandelt. Nun können wir es dank der deutschen Uebersetzung ebenfalls lesen, lachen oder leise schmunzeln und auch versuchen, die Lehre daraus zu ziehen.
Kürzlich erschien in deutscher Uebersetzung ein Buch aus dem Englischen, „Parkinsons Gesetz” (Econ-Verlag, Düsseldorf). Der Verfasser namens Parkinson ist Universitätsprofessor, der sich mit Fragen der Geschichte und Gesellschaftswissenschaften befaßt. Als sein kleines Buch in England erschien, druckten die größten Zeitschriften Kapitel daraus ab und’ ganz Großbritannien lachte. Denn ein ernsthafter Forscher hatte ernste Fragen in humoristischer Form behandelt. Nun können wir es dank der deutschen Uebersetzung ebenfalls lesen, lachen oder leise schmunzeln und auch versuchen, die Lehre daraus zu ziehen.
Arbeit läßt sich wie Gummi dehnen, um die Zeit auszufüllen, die für sie zur Verfügung steht. Diese Tatsache ist allgemein anerkannt, wie schon aus dem englischen Sprichwort hervorgeht: „Der Fleißige hat die meiste Freizeit.”
Geht man davon aus, daß sich Arbeit (besonders Schreibarbeit) durchaus elastisch gegenüber der Zeit verhält, dann wird sichtbar, daß geringe oder gar keine Beziehung zwischen einem bestimmten Arbeitspensum und der Zahl der Angestellten, die das Pensum erledigen sollen, besteht. Mangel an echter Tätigkeit muß nicht notwendig Müßiggang genannt werden: Mangel an Beschäftigung offenbart sich nicht immer in auffälligem Nichtstun. Vielmehr schwillt eine Arbeit an und gewinnt sowohl an Bedeutung als an Schwierigkeiten, je mehr Zeit man auf sie verwenden darf. Obwohl dies heute allgemein bekannt ist, hat man noch nicht die notwendigen Folgerungen daraus gezogen. — Vor allem nicht auf dem Gebiet der öffentlichen Dienste und Ministerien. Politiker wie Steuerzahler glauben da (wenn auch gelegentlich von Zweifeln geplagt}, daß ein ständig wachsendes Beamtenkorps die ständig wachsende Arbeit der Beamten widerspiegele. Zyniker, die sich zu dieser Auffassung nicht bequemen wollen, erklären grob, daß durch Vermehrung der Beamten entweder einige Beamte zu Müßiggängern gemacht würden oder aber die Arbeitszeit aller Beamten verkürzt werde. Doch sie haben beide unrecht; denn dies ist keine Frage des Zweifelns oder Glaubens. Vielmehr ist es so, daß die Zahl der Beamten oder Angestellten in gar keiner Beziehung zu der Menge der vorhandenen Arbeit steht. Das ständige Wachsen der Beamten- und Angestelltenzahlen vollzieht sich nach Parkinsons Gesetz — und es vollzieht sich, gleich, ob die Arbeit zunimmt, abnimmt oder ganz verschwindet. Die Bedeutung von Parkinsons Gesetz liegt in der Tatsache, daß es ein Gesetz des Wachstums ist und daß es sich auf eine sorgfältige Analyse all jener Kräfte stützt, welche das Wachstum bestimmen.
Die Gültigkeit dieses erst kürzlich entdeckten Gesetzes ist hauptsächlich durch statistische Unterlagen erbracht worden, von denen sofort die Rede sein soll. Doch genauso wertvoll wie jene Statistik dürfte für den interessierten Laien eine Erklärung jener Faktoren sein, die den allgemei- den Tendenzen, definiert durch Parkinsons Gesetz, unterworfen sind. Es handelt sich dabei — wenn wir alle die zahlreichen technischen Komplikationen außer acht lassen — um zwei ursächliche Triebkräfte, Motive oder Tendenzen. Man kann sie in zwei kurze Lehrsätze fassen, welche fast wie Axiome wirken: (1) „Jeder Beamte oder Angestellte wünscht die Zahl seiner Untergebenen, nicht aber die Zahl seiner Rivalen, zu vergrößern”, und (2) „Beamte oder Angestellte schaffen sich gegenseitig Arbeit”.
Um Triebkraft Nr. 1 zu verstehen, müssen wir das Bild eines Beamten, genannt A, entwerfen, welcher spürt, daß er überarbeitet ist. Ob die Ueberarbeitung auf Tatsachen oder Einbildung beruht, spielt dabei keine Rolle; nur beiläufig wollen wir erwähnen, daß A’s Gefühl (oder Einbildung) sehr leicht ein Ergebnis jenes „Leistungsknicks” sein kann, der bei Männern in den mittleren Jahren auf tritt. Für dieses tatsächliche oder eingebildete Zuviel an Arbeit gibt es nun drei mögliche Heilmittel: A kann darum bitten, daß man ihn entläßt. A kann aber auch bitten, daß er seine Arbeit künftig mit dem Kollegen B teilen darf; und A kann schließlich ein Gesuch stellen, daß ihm zwei Unterbeamte zugeteilt werden, genannt C und D. Ich glaube, es gibt kein bekanntes Beispiel in der Weltgeschichte, daß ein Beamter oder Angestellter einen anderen als den dritten Weg wählte. Denn durch Abdankung verliert er die Pensionsberechtigung; zieht er den Kollegen B als Gleichberechtigten ins Spiel, dann schafft er sich einen Rivalen für den Fall, daß sein Vorgesetzter W. eines Tages in’ den Ruhestand geht und einen leeren Stuhl hinterläßt. Infolgedessen zieht A vor, zwei Junioren, C und D, unter sich zu haben. Sie stärken nicht nur seine Stellung im Amt, er kann auch die Arbeit -in zwei Hälften einteilen, die er ihnen getrennt zuweist, worauf für ihn der Vorteil entspringt, daß er als einziger der ganzen Arbeit vorsteht. Es ist wichtig, festzuhalten, daß die beiden Untergebenen C und D untrennbar sind. C allein einzustellen, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Warum? Weil C, allein, die Arbeit mit A teilen und dadurch in den Genuß jener Gleichberechtigung geraten würde, die bereits B .aus güten Gründen versagt wurde; die Gefahr würde dadurch nur erhöht, denn C wäre jetzt der einzige Nachfolger A’s. Untergebene müssen also immer in der Mehrzahl auftreten, denn nur durch die Angst, der andere könnte der Nachfolger des Chefs werden, kann man sie in Ordnung halten. Beschwert sich eines Tages C über zuviel Arbeit (was er ganz sicherlich tun wird), dann wird A — in vollem Einverständnis mit C — die Einstellung von mindestens zwei Untergebenen für C befürworten. Doch um nicht Feindschaft im eigenen Büro aufkommen zu lassen, muß er die Einstellung von zwei Hilfskräften für D befürworten, der ja im gleichen Rang wie C steht. Mit der Neueinstellung der Hilfskräfte E, F, G und H kann er aber nun fast sicher sein, daß er demnächst befördert wird.
Sieben Beamte tun jetzt, was zuvor einer allein tat. Und hier beginnt die zweite Triebkraft wirksam zu werden. Denn diese sieben Beamten schaffen sich gegenseitig so viel Arbeit, daß jeder von ihnen alle Hände voll zu tun hat und A selbst härter als je arbeitet. Jedes eingehende Aktenstück muß alle sieben Schreibtische passieren. Beamter E erhält es zuerst und entscheidet, daß der Fall von Kollegen F bearbeitet werden muß, der das Schreiben liest und einen Antwortbrief entwirft, den er an seinen Vorgesetzten C weiterleitet. C nimmt erhebliche Veränderungen an dem Entwurf vor, ehe er sich mit D in Verbindung setzt, der die Angelegenheit von seinem Gehilfen G bearbeiten läßt. Doch G steht gerade im Begriff, seinen Urlaub anzutreten, und übergibt den Faszikel deswegen H, der zu dem Entwurf ein kurzes Expose schreibt, es von D abzeichnen läßt, worauf er das ganze Bündel an C zurückgehen läßt, der den von ihm bereits verbesserten ersten Entwurf nochmals revidiert und die endgültige Fassung A vorlegt.
Was macht nun A? Er könnte das Ding ohne Gewissensbisse ungelesen abzeichnen, denn er hat weiß Gott andere Sorgen. Nächstes Jahr wird er aufsteigen und die Stelle seines Chefs W. einnehmen; deshalb zerbricht er sich jetzt schon den Kopf, ob C oder ob D sein Nachfolger werden soll. Er hat G einen Urlaub bewilligt, zu dem der Mann, streng genommen, nicht berechtigt war. Nun fragt er sich, ob es nicht gescheiter gewesen wäre, H auf Urlaub zu schik- ken, der ihn offenbar nötiger hätte. Denn H sieht in letzter Zeit blaß aus — teilweise, aber nicht allein, wegen seines Aergers mit der Familie. Dann ist da noch die Geschichte mit F, der Während einer Konferenz Gehaltszulage bekommen sollte, und weiter das Gesuch von G um Versetzung in das Pensionsministerium. So könnte A also mit Fug und Recht seinen Krakel unter C’s endgültigen Entwurf setzen und die ganze Geschichte los sein. Doch dazu ist er zu gewissenhaft. Obwohl ihn neuerdings nur noch Probleme beschäftigen, die seine Mitarbeiter für sich selbst und damit für ihn schaffen (Probleme, die es überhaupt nur gibt, weil ss das Büro gibt), denkt er nicht daran, sich vor der Pflicht zu drücken. Also liest er den Entwurf des Antwortschreibens sorgfältig durch, streicht die Zusätze der beiden Umstandskrämer C und H und reduziert das Schreiben auf jenen Entwurf, den der begabte (wenn auch streitsüchtige) F gleich zu Beginn geliefert hat. Er feilt nur noch ein wenig an der Sprache des Schreibers herum — keiner dieser jungen Leute hat heute mehr eine Ahnung, was Grammatik ist! Und das Endergebnis seiner Tätigkeit bildet ein Brief, den er genau in dieser Form selbst geschrieben haben würde, wenn die Beamten C bis H nie geboren worden wären. Viel mehr Menschen haben viel mehr Zeit benötigt, um zu dem gleichen Ergebnis zu kommen. Keiner von ihnen war müßig, alle gaben ihr Bestes. Es ist fast Nacht, wenn A endlich das Büro verläßt und heimfährt.
Aus dieser Beschreibung der beiden Triebkräfte Nr. 1 und Nr. 2 kann der Student der politischen Wissenschaften leicht entnehmen, daß alle mit der Verwaltung Beauftragten gezwungen sind, sich ständig zu vervielfachen. Doch bisher wurde noch nichts von der Zeit gesprochen, welche zwischen dem Tag, als A zum erstenmal ins Amt kam, und dem Tag, als H mit Pensionsberechtigung angestellt wurde, verstrich. Unmassen statistischen Materials wurden gesammelt und mühsam analysiert, und aus dem Ergebnis der Untersuchung wurde Parkinsons Gesetz abgeleitet. Es ist hier nicht der Platz, die Analyse in allen Einzelheiten zu wiederholen. Doch mag es den Leser interessieren, daß die ersten Forschungsgruppen in den Haushalt der britischen Kriegsmarine entsandt wurden. Man wählte sie als Ausgangspunkt, weil die Aufgaben der Admiralität leichter meßbar sind als beispielsweise die Aufgaben einer Handelskammer. Bei der Marine handelt es sich lediglich um Zahlen und Tonnagewerte. Wir lassen hier ein paar typische Beispiele folgen:
Die Stärke der britischen Marine im Jahre 1914 drückte sich in folgenden Zahlen aus: 146.000 Seeoffiziere und Matrosen, 3249 Werftbeamte und -angestellte, 57.000 Werftarbeiter. Im Jahre 1928 gab es nur noch 100.000 Seeoffiziere und Matrosen, die Zahl der Werftarbeiter hatte sich auf 62.439 vermehrt, die Werftbeamten und -angestellten waren auf eine Kopfzahl von 45 58 angestiegen. Inzwischen war allerdings die Kampfkraft der Schlachtschiffe auf einen Bruchteil von 1914 gesunken — weniger als 20 Großkampfschiffe 1928 gegenüber 62 Großkampfschiffen 1914. Im gleichen Zeitraum aber schnellte die Zahl der Admiralitätsangestellten sprunghaft von rund 2000 im Jahre 1914 auf 3569 im Jahre 1928 hoch — was, wie man damals bemerkte, „eine großartige Marine zu Land” auf die Beine brachte. Die Kritik, die sich seinerzeit erhob, zielte auf das Mißverhältnis zwischen det Zahl jener, die kämpften und jener, die verwalteten. Es ist nicht unsere Absicht, nochmals auf den alten Vergleich zurückzukommen. Was wir aber Vorstehendem entnehmen müssen, ist die Tatsache, daß aus 2000 Angestellten des Admiralitätsstabes von 1914 im Jahre 1928 3 569 Stabsschreiber geworden waren. Und weiter, daß dieses Wachstum in gar keiner Beziehung zu einer irgendwie gearteten Zunahme der Arbeit stand. Die Marine hatte im gleichen Zeitraum ein Drittel ihrer aktiven Seeleute und zwei Drittel ihrer aktiven Großkampfschiffe aufgegeben. Seit dem Jahre 1922 konnte auch niemand erwarten, daß diese Zahlen jemals wieder wachsen würden. Denn die Anzahl der Großkampfschiffe (nicht die der Admiralitätsschreiber)- war durch das Abkommen von Washington begrenzt worden. Worauf es uns ankommt, ist das Anwachsen des Stabes um 78 Prozent in einem Zeitraum von 14 Jahren, was einer jährlichen Zuwachsrate von 5,6 Prozent entspricht.
Kann es für das Anwachsen der Beamten in der Marine noch irgendeine andere Erklärung geben als die, daß ein solches Wachstum zwangsläufig ist, weil es einem unbekannten Wachstumsgesetz unterliegt? Nun kann man einwenden, daß die fragliche Periode in eine Zeit rapider technischer Entwicklungen auf dem Marinesektor fällt. Der Gebrauch des Flugzeuges wurde nicht länger den Verrückten vorenthalten; elektrische Anlagen vermehrten sich und wurden immer komplizierter; Unterseeboote wurden geduldet, wenn auch noch nicht gefördert; und der Ingenieuroffizier wurde von manchen beinahe schon als Mensch angesehen. In einem derart revolutionären Zeitalter schwellen erfahrungsgemäß die Lagerbestände der Zeugämter an. Man darf erwarten, daß mehr Zeichner, mehr Konstrukteure, Planer, Techniker und Wissenschafter auf den Gehaltslisten erscheinen. Aber alle diese sogenannten Werftbeamten und -angestellten vermehrten sich nur um 40 Prozent, während die Rate der Vermehrung bei den Schreibern von Whitehall nahezu 80 Prozent erreichte. Für.jeden neuen Vorarbeiter oder Elektroingenieur in Portsmouth (der Kriegswerft) gab es zwei neue Schreiber in Charing Cross (dem Büro der Admiralität). Man fühlt sich versucht, daraus folgenden vorläufigen Schluß zu ziehen: „Die Zuwachsrate eines Verwaltungsstabes ist doppelt so groß wie die Zuwachsrate eines technischen Stabes, vorausgesetzt, daß die eigentliche Kampfkraft (in diesem Fall die Zahl der Seeleute) um 31,5 Prozent gesenkt wird.” Doch ist es eine Hypothese geblieben. Denn statistische Untersuchungen haben ergeben, daß die Kampfkraft irrelevant ist: die Angestellten in der Admiralität würden sich mit der gleichen Geschwindigkeit vervielfacht haben, auch wenn es keinen aktiven Seemann mehr gegeben hätte.
Während unserer ganzen Untersuchungen über die sogenannte reine oder absolute Personalvermehrung deuteten die Ergebnisse auf eine jährliche Zuwachsrate von rund 5,75 Prozent hin. Nachdem dieser Wert einmal ermittelt war, wurde es aber auch möglich, Parkinsons Gesetz auf eine mathematische Basis zu stellen: In jedem öffentlichen Verwaltungsapparat, der sich nicht gerade im Kriegszustand befindet, wird sich der Angestelltenstab voraussichtlich nach der Formel entwickeln. In dieser Formel ist: k= Zahl der Angestellten, die Beförderung anstreben, indem sie neue Untergebene einstellen; L = Differenz zwischen dem Alter der Einstellung und dem Alter der Pensionierung; m = die Anzahl der Arbeitsstunden/Mann, die der Anfertigung von Memoranden im internen Büroverkehr dienen; n = die Zahl der Verwaltungseinheiten, welche vom Personal des Büros tatsächlich erledigt werden. Dann ist x die Zahl der neuen Angestellten, welche von Jahr zu Jahr angeheuert werden müssen. Jeder Mathematiker weiß nun, daß man, um die Zuwachsrate zu finden, nichts weiter tun muß, als x mit 100 zu multiplizieren und durch die Kopfzahl des vergangenen Jahres zu teilen. Es entsteht damit die Formel wobei y = Kopfzahl der ursprünglichen Büros ist. Diese Rate wird unweigerlich zwischen 5,17 und 6,56 Prozent liegen, ohne Rücksicht auf die Variationen der Arbeitsmenge (wenn überhaupt), die erledigt werden muß.
Die Entdeckung der Formel und des allgemeinen Prinzips, auf dem sie basiert, hat natürlich keinerlei politischen Wert. Kein Versuch wurde gemacht, die Frage zu ergründen, ob Ministerien wachsen sollen oder nicht. Wer glaubt, daß dieses Wachstum wesentlich sei für die Vollbeschäftigung der Nation, ist durchaus berechtigt, diese Meinung zu vertreten. Wer an der Gesundheit einer Volkswirtschaft zweifelt, die darauf beruht, daß einer die Memoranden des anderen liest, hat ebenfalls ein Recht auf seine Meinung. Es wäre zweifellos noch verfrüht, eine Untersuchung darüber zu beginnen, wie das zahlenmäßige Verhältnis zwischen denen, die verwalten, und denen, die verwaltet werden, aussehen sollte. Vorausgesetzt, daß ein solcher Optimalwert überhaupt existiert, wäre es dann ein Leichtes, an Hand der Zuwachsrate zu errechnen, wie viele Jahre noch verstreichen, bis dieser Zustand erreicht ist. Doch selbst eine Voraussage dieser Art wäre noch kein Politikum. Denn es kann nicht nachdrücklich genug festgestellt werden, daß Parkinsons Gesetz eine rein wissenschaftliche Entdeckung ist, auf die heutige Politik bestenfalls theoretisch anwendbar. Es ist nicht Aufgabe des Botanikers, Unkraut zu jäten. Ihm genügt es, wenn er sagen kann, wie schnell es wächst.