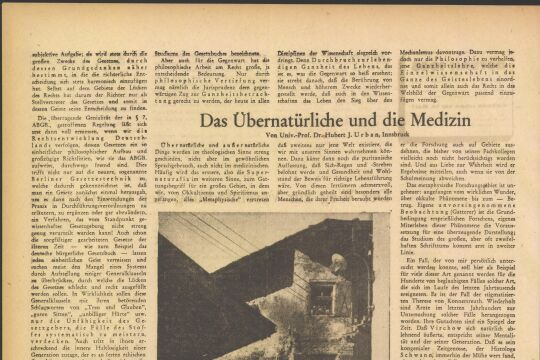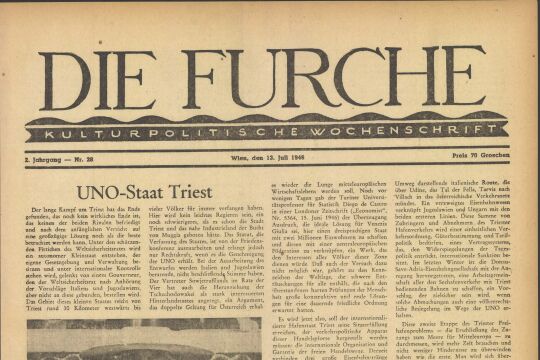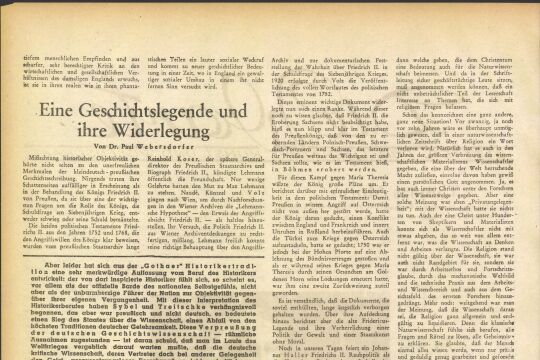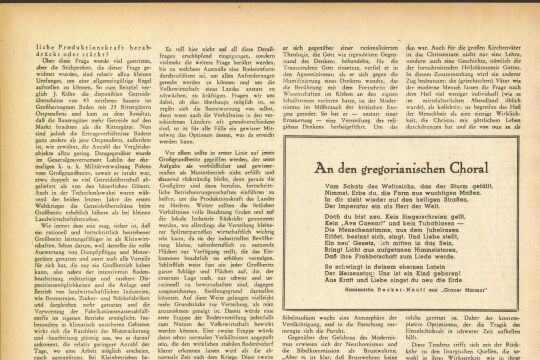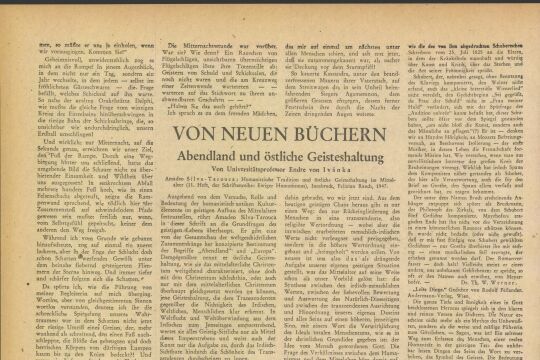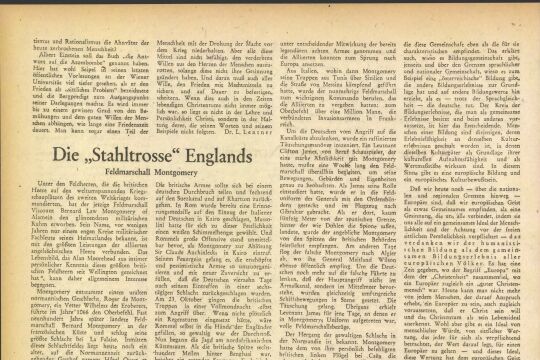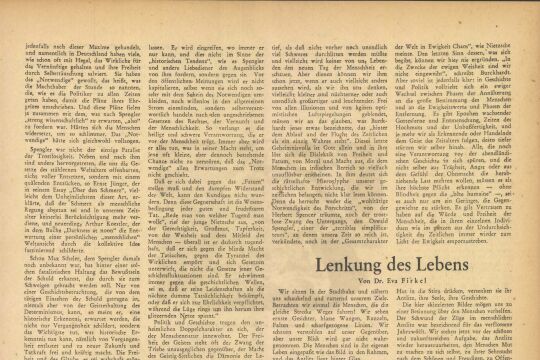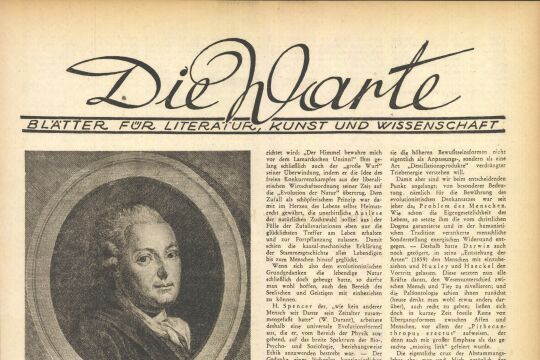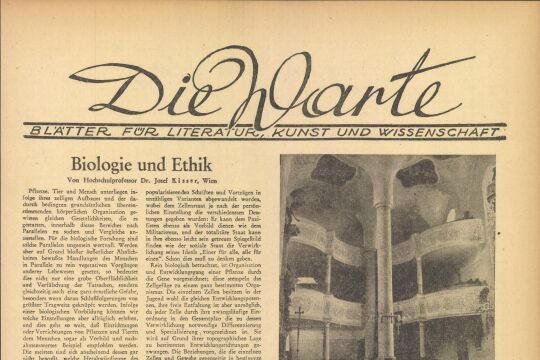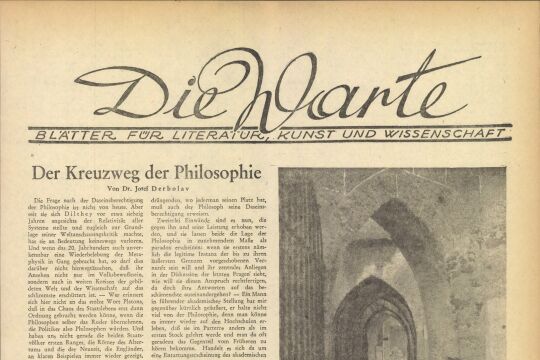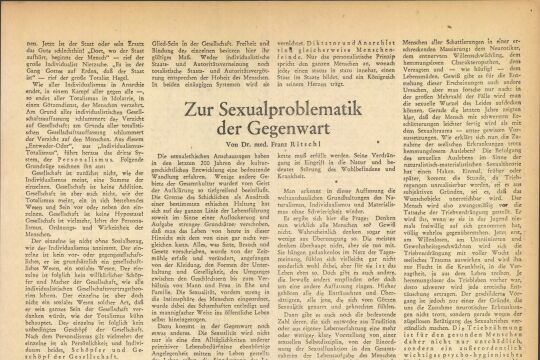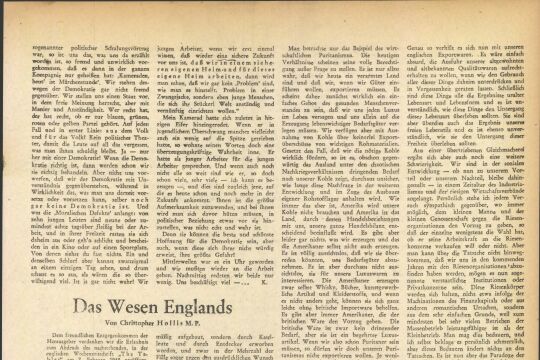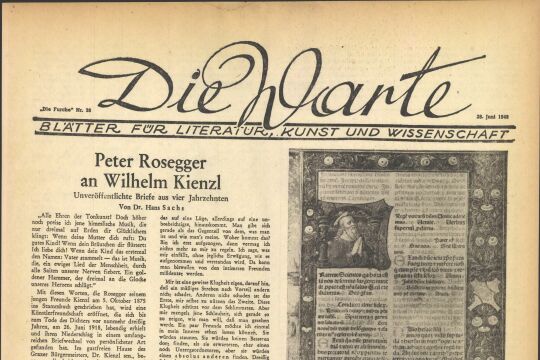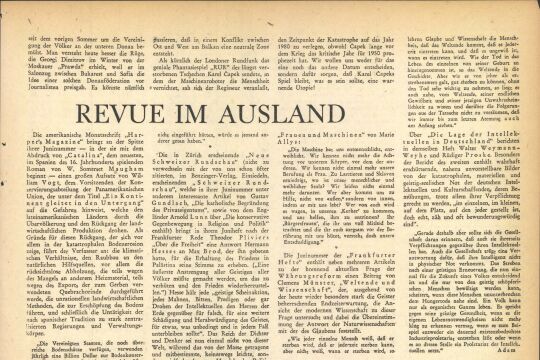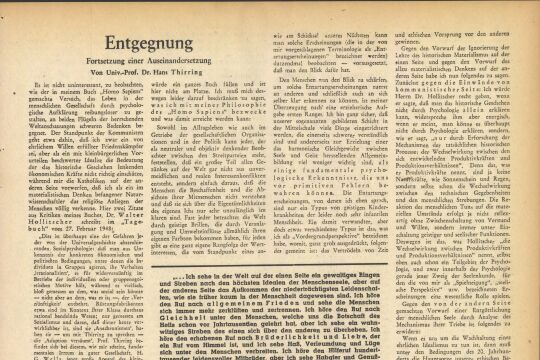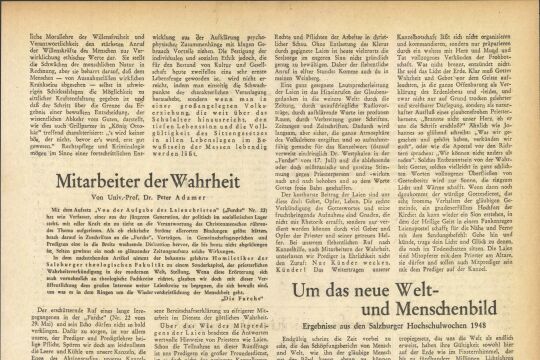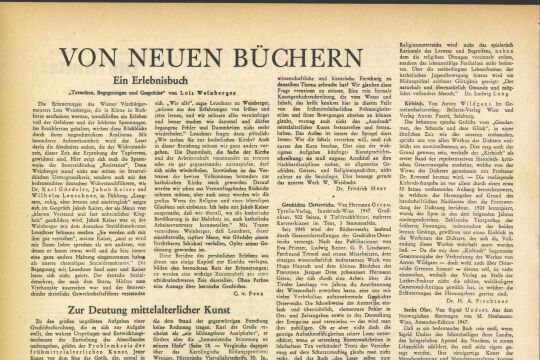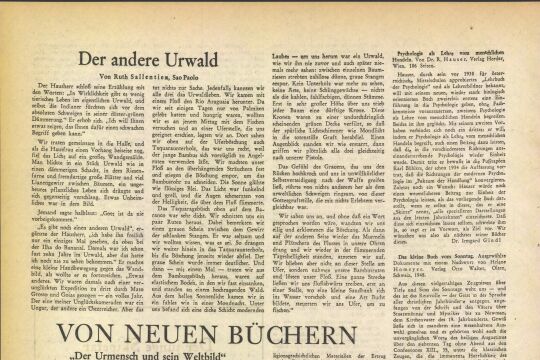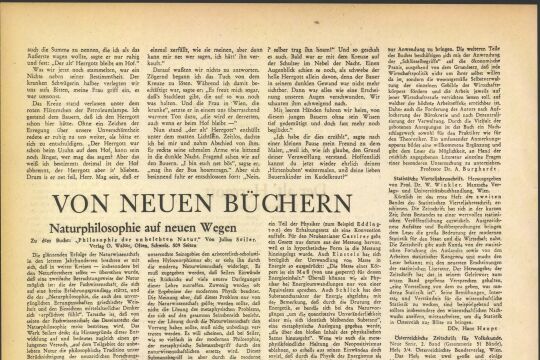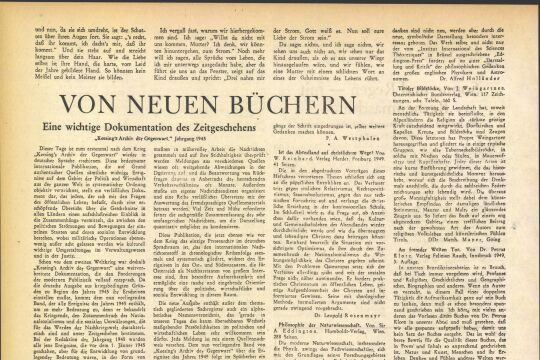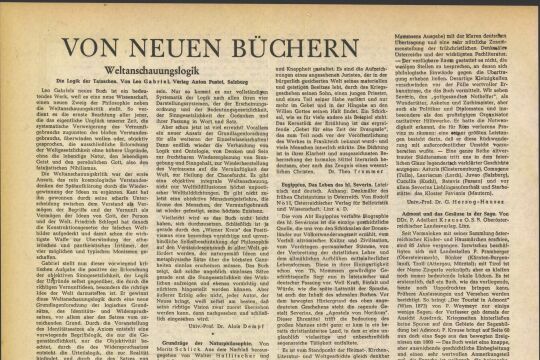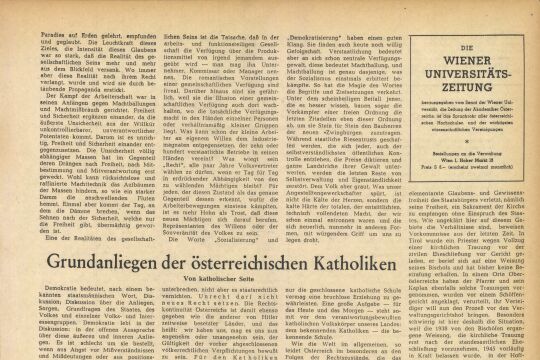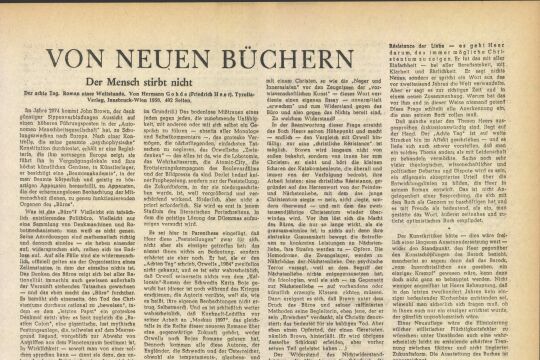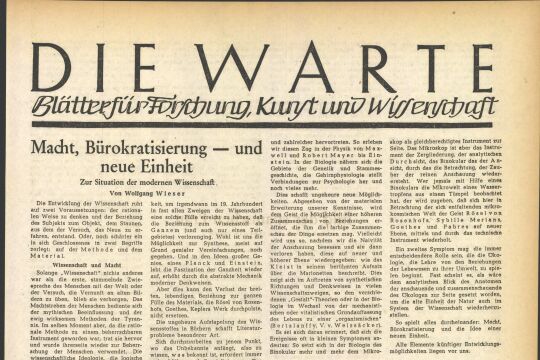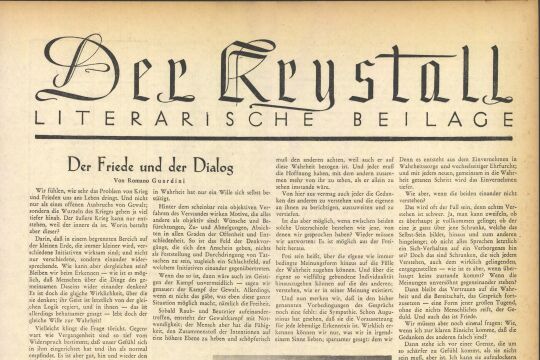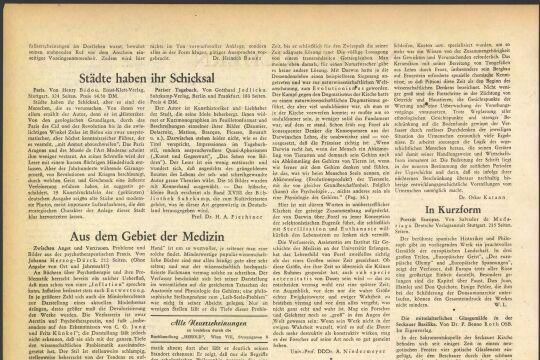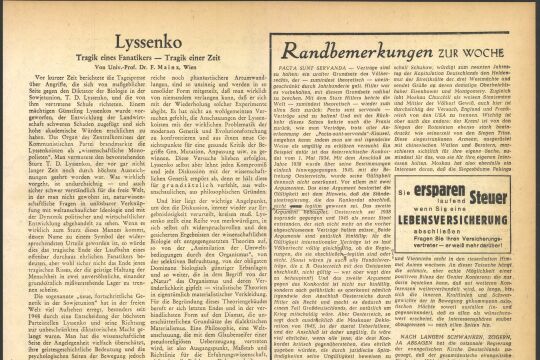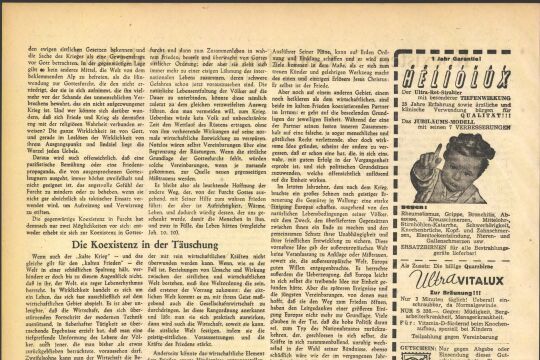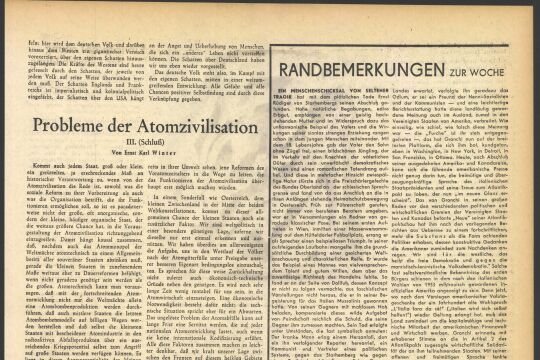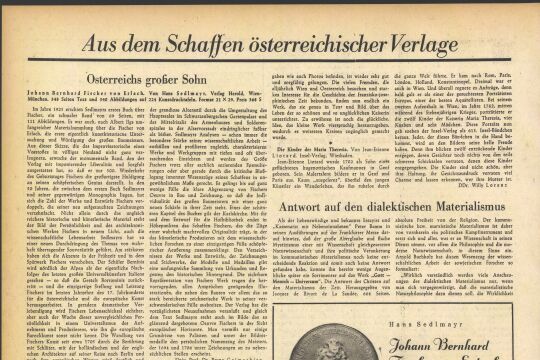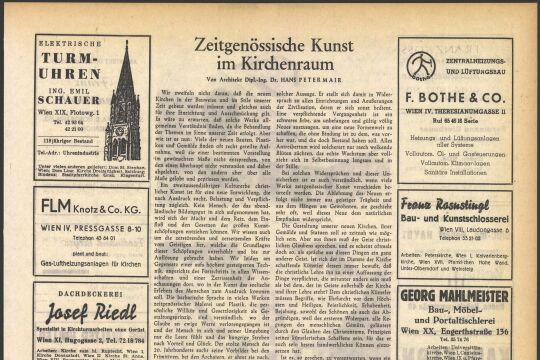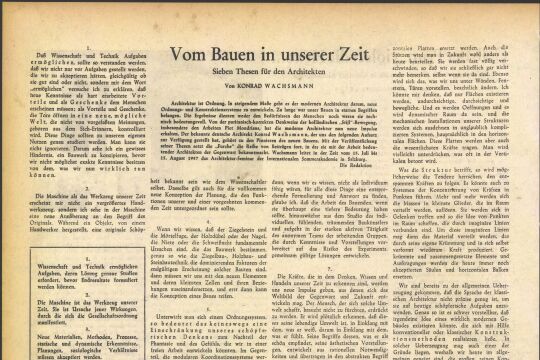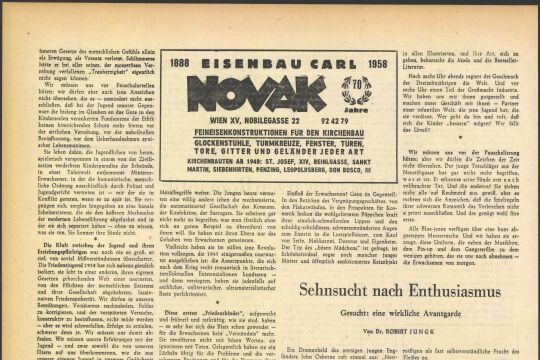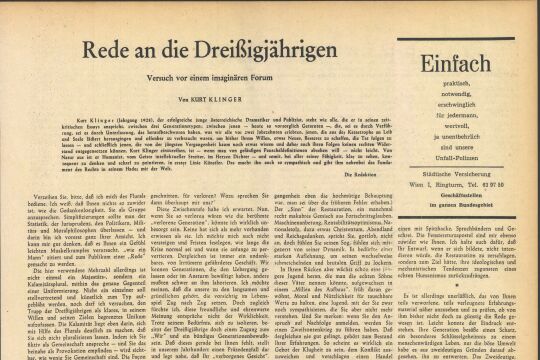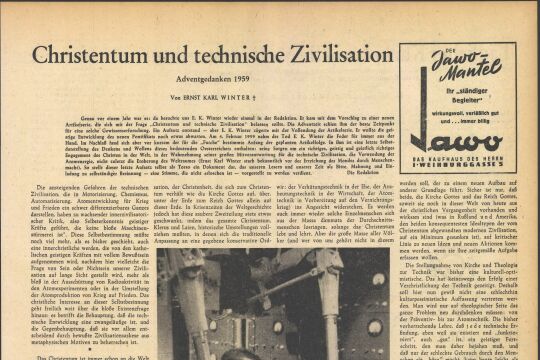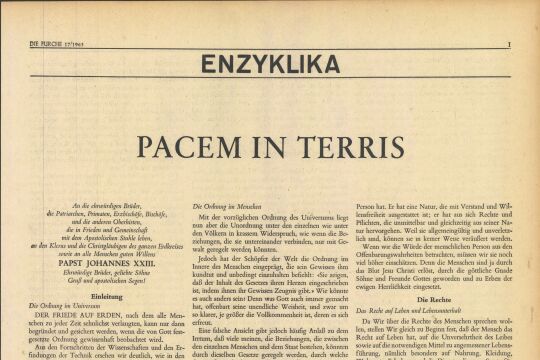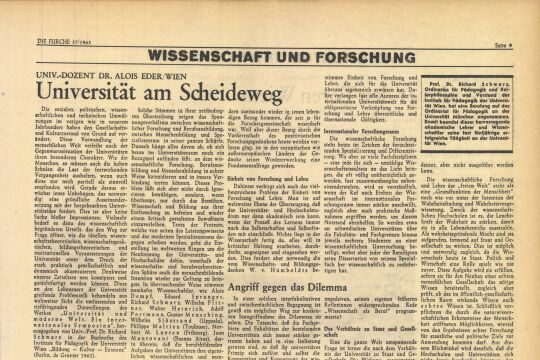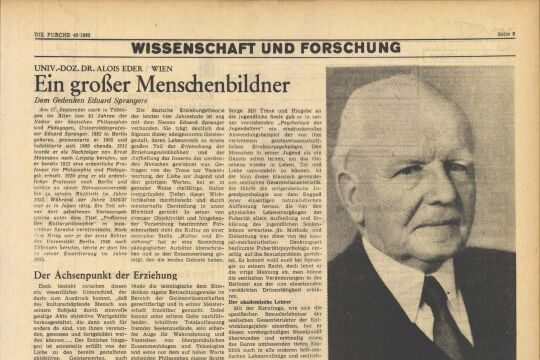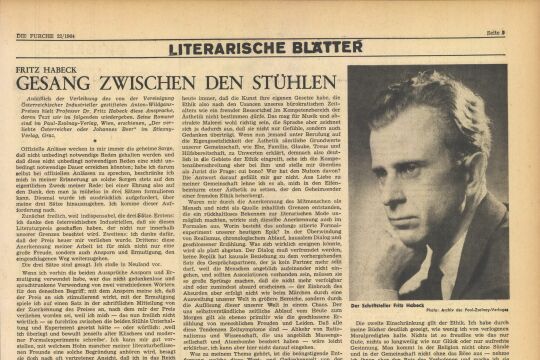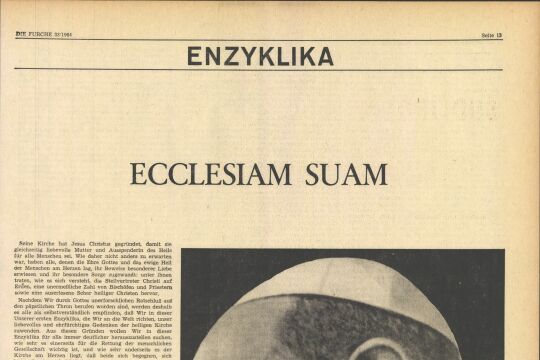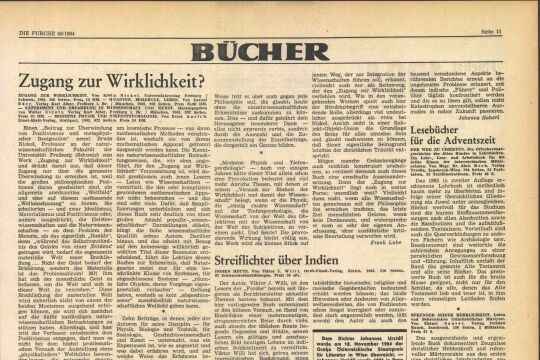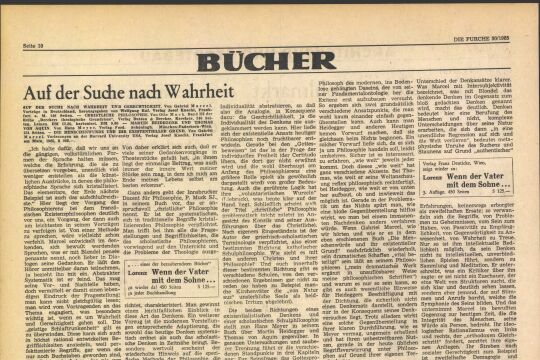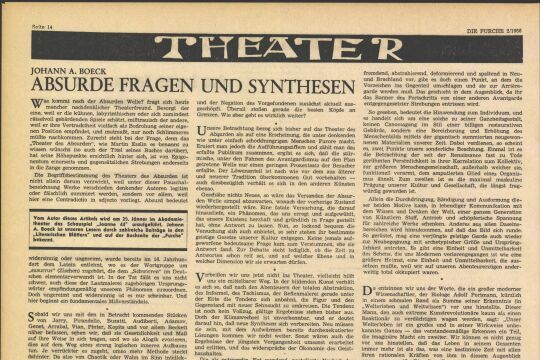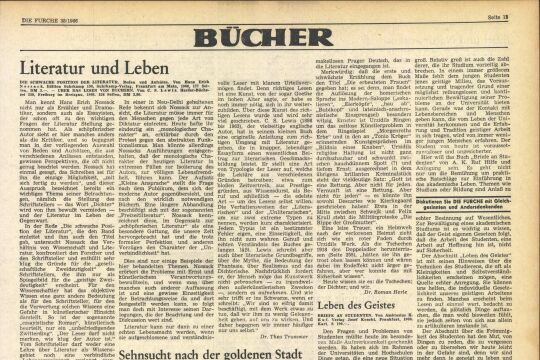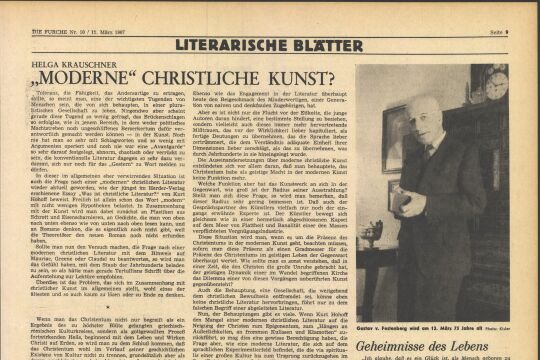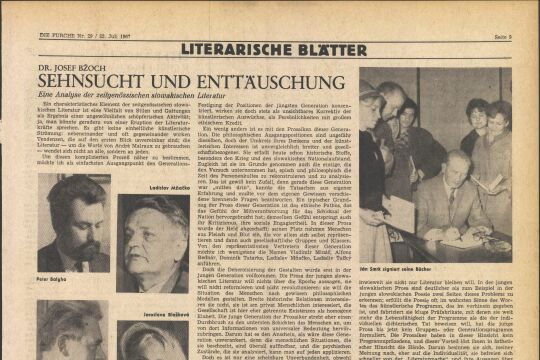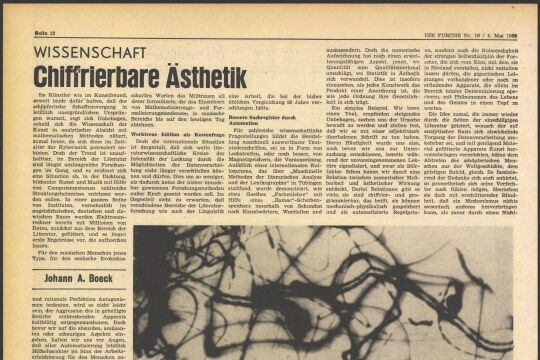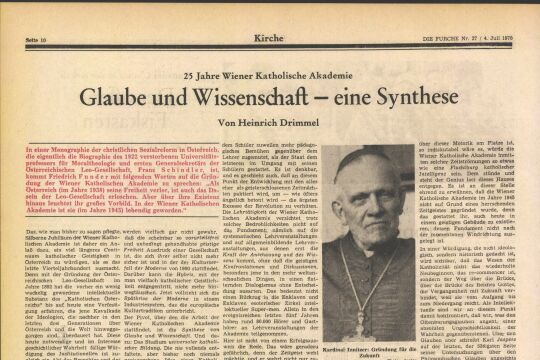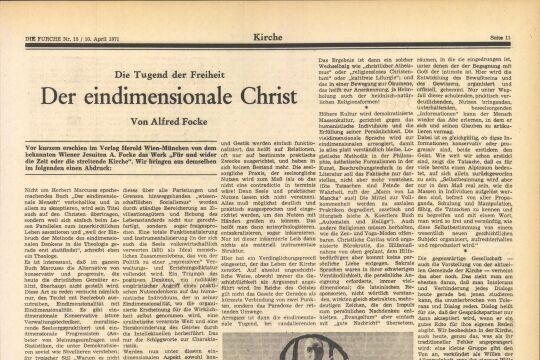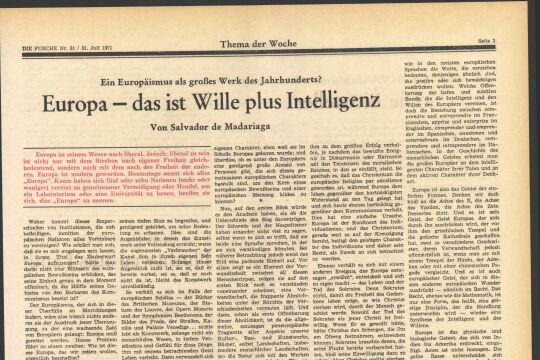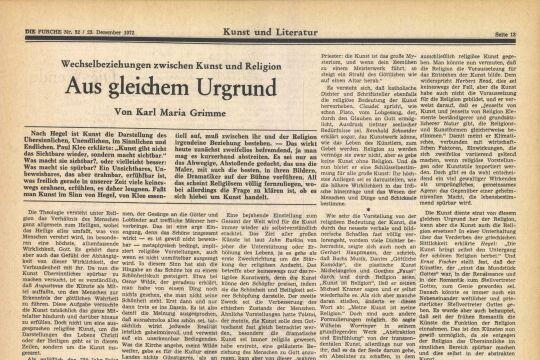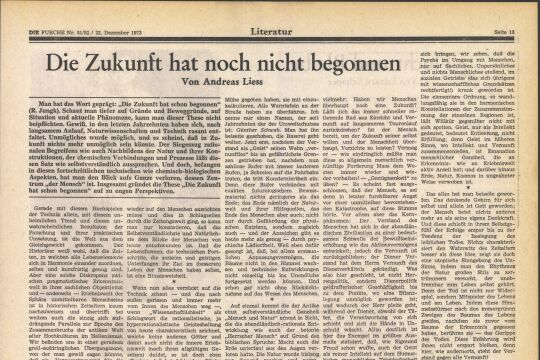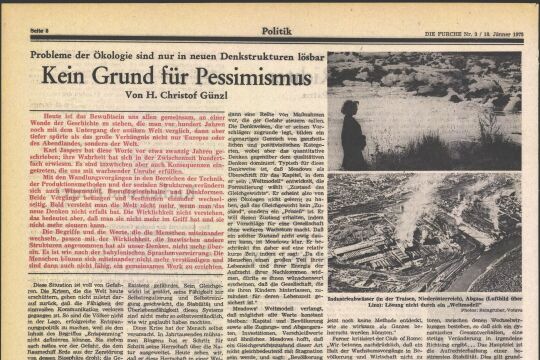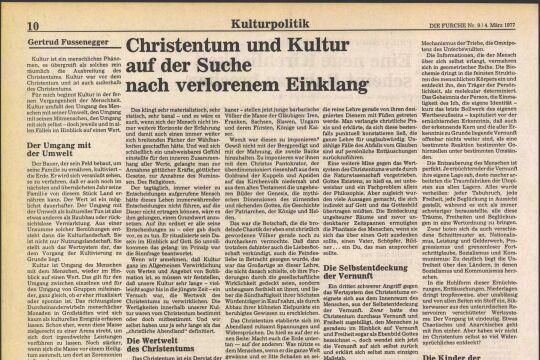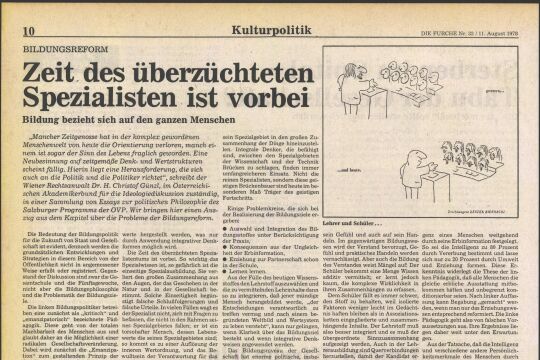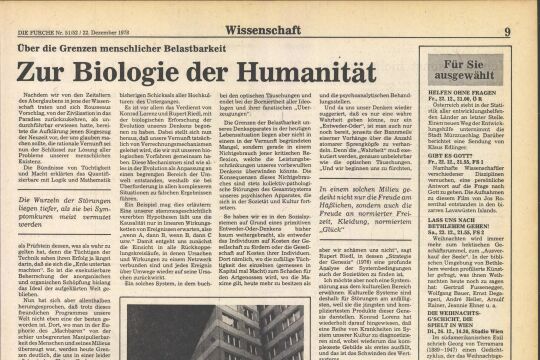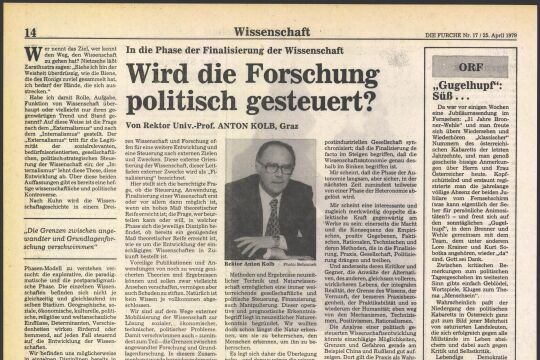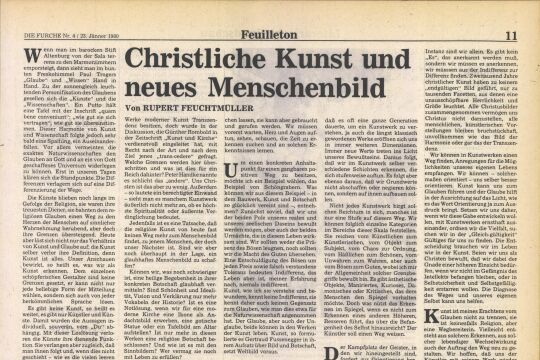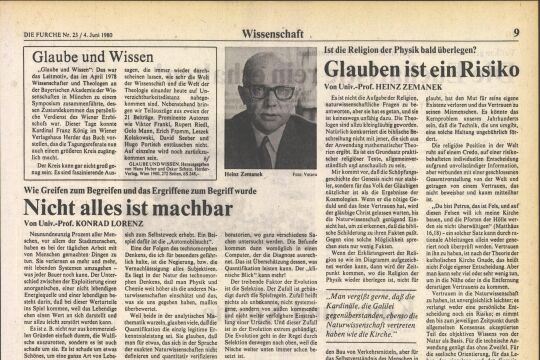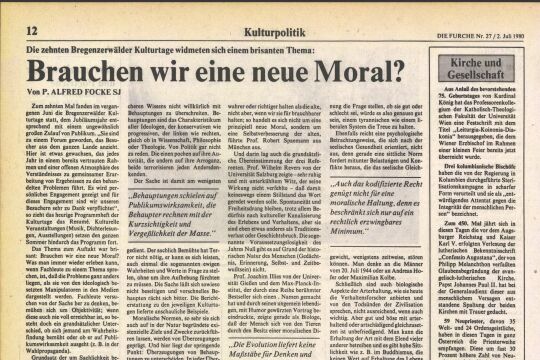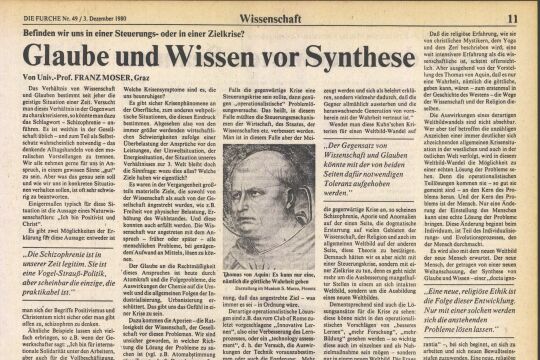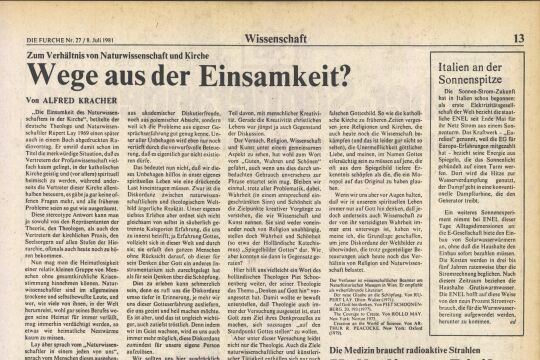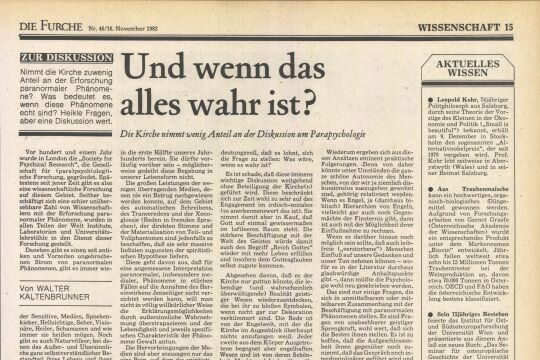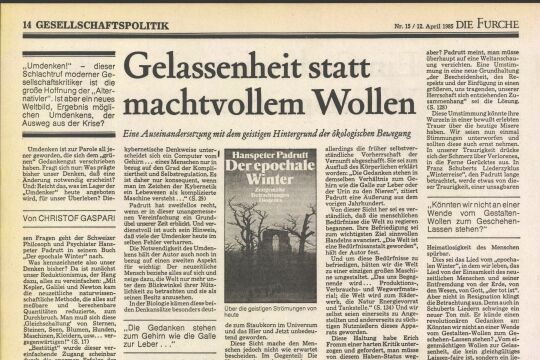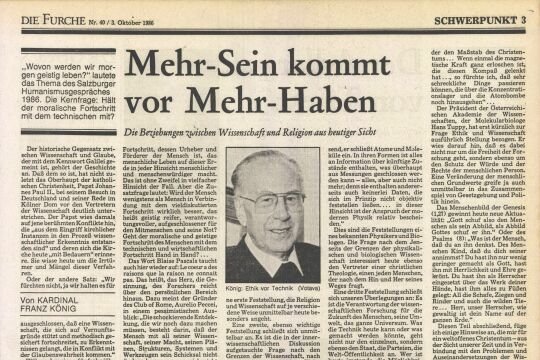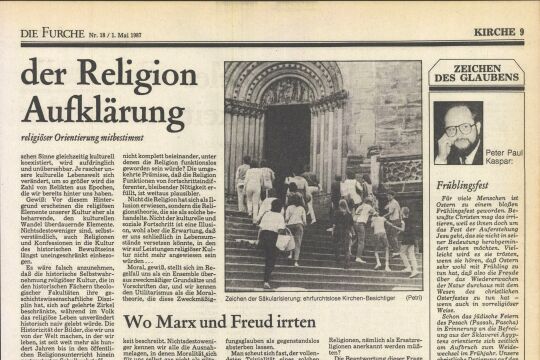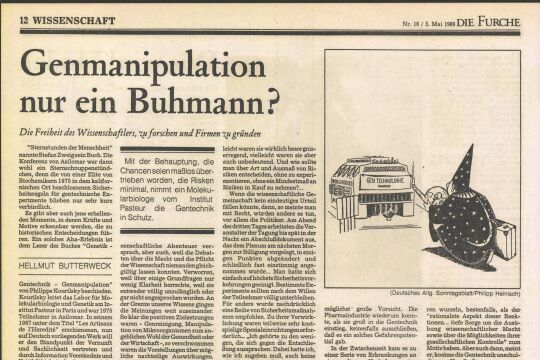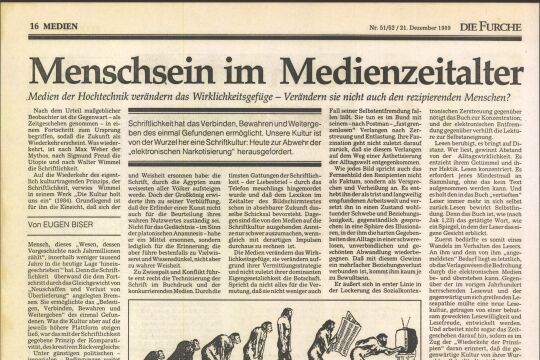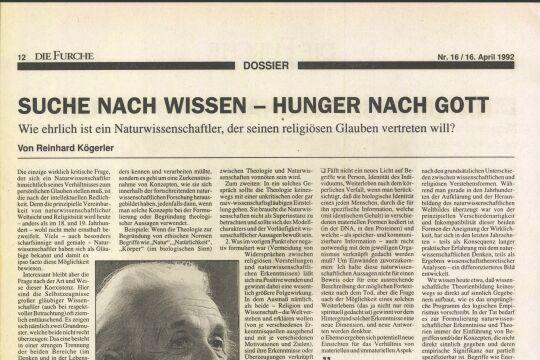Schafft Wissen!
DISKURS
Forscher rein in den Elfenbeinturm!
Was soll Forschung an den Universitäten ausmachen: Sind es nur die messbaren Fortschritte, die zu konkreten Anwendungen führen – oder darf Wissenschaft auch reiner Selbstzweck sein? Ein Gastkommentar.
Was soll Forschung an den Universitäten ausmachen: Sind es nur die messbaren Fortschritte, die zu konkreten Anwendungen führen – oder darf Wissenschaft auch reiner Selbstzweck sein? Ein Gastkommentar.
Vor Kurzem hörte ich bei der Promotionsprüfung eines Freundes, eines studierten Chemikers, zu. Nach dessen Vortrag stellte ihm sein Vater – stolz und trotzdem verschmitzt – die Frage: „Was bringen deine Ergebnisse? Lässt sich damit etwas anfangen?“ Mein Freund antwortete mit dem eingeübten Verweis auf den potenziellen Nutzen, den selbst Grundlagenforschung in sich berge.
Dieses Beispiel spiegelt die in unserer Gesellschaft vorhandene Erwartung wider, dass Forschung nützlich sein sollte. Die meisten Wissenschaftler beugen sich diesem Erwartungsdruck. Selbst wenn ihre Arbeit jenseits ökonomischer, technischer oder sozialer Wirksamkeit liegt, trauen sie sich nicht zu sagen: „Meine Arbeit ist nicht nützlich.“ Wir scheinen aus den Augen verloren zu haben, dass Tätigkeiten gerechtfertigt sein können, ohne einem äußeren Zweck zu dienen. Der Besuch eines Konzerts oder eines Gottesdienstes zum Beispiel stellt für viele Menschen eine wichtige Sinnquelle dar. Mit Nützlichkeit aber haben beide nichts zu tun.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!