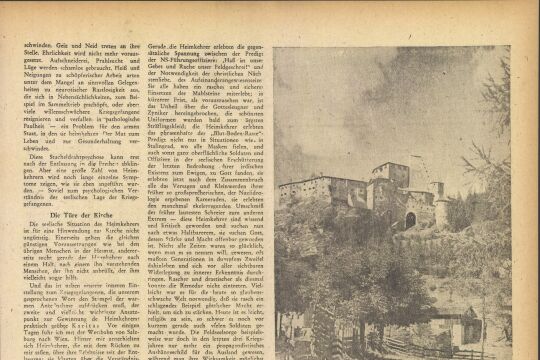Daniel Kehlmann hat mit einer sehr persönlichen Rede anlässlich der Eröffnung der Salzburger Festspiele das gegenwärtige deutsche Theater scharf attackiert und damit eine heftige Kontroverse ausgelöst. Sie bietet Anlass für einige grundsätzliche, nicht zuletzt historisch fundierte Überlegungen zu Sinn und Aufgabe des zeitgenössischen Theaters.
Der Begriff Regietheater ist in den letzten Jahren zu einem Schimpfwort, ja zu einem Kampfbegriff geworden, ohne dass jemand wüsste, was damit eigentlich genau gemeint ist.
Klar ist nur, wer „Regietheater“ sagt, missbilligt das gegenwärtige Theater, das heißt, Regietheater ist „böse“. Das ist als eine Reaktion auf die Enttäuschung von Erwartungshaltungen, auf die Verunsicherung durch ungewohnte Theatererfahrungen und den Unwillen, sich auf Neues, Fremdartiges, gar Rätselhaftes und daher Anstrengendes einzulassen, zu verstehen.
Wegen seiner Schwammigkeit taucht der Begriff meist in Verbindung mit seinem „guten Bruder“ auf, dem Autorentheater, das auch mit „Werktreue“ beschrieben werden kann. Erst so gewinnt er Kontur. So verwendet, gilt Regietheater niemals als werktreues Theater und umgekehrt gerät jenes nie in den Verdacht, Regietheater zu sein. Dass ein Theater „ohne Regie“ noch lange keine Werktreue garantiert und es eine uninterpretierte Übersetzung in Theater nicht gibt, wird dabei häufig unterschlagen.
Vorwurf der Werkzertrümmerung
Die Diskussion um Regietheater und Werktreue – die mit einer bemerkenswerten Regelmäßigkeit wie Heftigkeit wiederkehrt – ist demnach eine Auseinandersetzung um die ästhetische und inhaltliche Adäquanz aktueller Inszenierungen von meist klassischen Werken. Der Vorwurf lautet: Werkzertrümmerung, Infantilismus, Aktualisierungswahn oder ordinäre Klassikerverstümmelung, beklagt wird der Verlust an Kultur, an hohem Stil, an gepflegter Sprache. Regietheater ist also alles, was nicht werk- oder texttreu ist, es ist, negativ ausgedrückt, ein Theater, das die Deutung des Regisseurs wichtiger nimmt als das literarische Werk des Autors. Gerhard Stadelmeier, der Theaterkritiker der FAZ, nennt es mitunter auch „Rübenrauschtheater“, womit er das Unbedeutende, Beliebige, das dem Regisseur während der Probenzeit durch die „Rübe“ gerauscht ist, meint.
Irgendwie geht es also um die Rolle des Regisseurs. Der solle, so die Forderung, weniger auf Populismus, selbstzweckhafte Effekte setzen und sich vielmehr als Diener des Autors, als genauer Textarbeiter, als Re-Produzierender und nicht Produzierender verstehen. Wo dabei das Zuviel-an-Freiheit und das Zuwenig-an-Werktreue beginnt, ist freilich denkbar unklar. Was beim Film, einer vergleichsweise jungen Kunstgattung, längst möglich ist, wird dem Theater immer wieder verweigert. Das Verständnis des Regisseurs als Co-Autor wird mit Selbstermächtigung gleichgesetzt. In diesem Sinne wird Regietheater verstanden als ein Theater des Angriffs auf den literarischen Autor, als ein Theater des Übergriffs.
Goethe als Regietheater-Befürworter
Bei genauerem historischem Hinsehen wird allerdings klar, dass diese Dichotomie kaum haltbar ist.
Der Kunstcharakter einer Inszenierung wurde lange Zeit als durch den ihr zugrunde liegenden Dramentext gewährleistet angesehen, der Regisseur war eher ein Arrangeur. Erst kurz vor 1900 wurde die Bedeutung der Inszenierung als eigenes ästhetisch konstruiertes Ereignis allmählich erkannt. Mit ihr wandelte sich auch die Rolle des Regisseurs. Spätestens seit den zwanziger Jahren gilt die Regie als das künstlerische Zentrum der Inszenierung, Theater kann seitdem kaum mehr, wie noch im dichtungsverliebten 19. Jahrhundert, mit dem dramatischen Text gleichgesetzt werden. Die theatrale Moderne um die Jahrhundertwende initiierte eine grundlegende Emanzipation des Theaters vom literarischen Text. In ihrer Folge galt das Theater selbst mit seinen szenischen Vorgängen als poetischer, sinnlicher, assoziativer Komplex mit einem eigenen Formenvokabular, das ständiger Veränderungen und Erweiterungen bedarf.
Schon Schiller und Goethe, auf die sich die Adepten der Werktreue so gern berufen, waren als Theaterpraktiker Vertreter des Regietheaters, die es mit der Werktreue nicht so genau nahmen. Goethe meinte in seiner Schrift „Über das deutsche Theater“ (1815), „der einnehmende Stoff, der anerkannte Gehalt solcher Werke sollte einer Form angenähert werden, die teils der Bühne überhaupt, teils dem Sinn und Geist der Gegenwart gemäß wäre“. Er sprach sich also bereits sehr früh für Aktualisierungen des Stoffes und für Inszenierungen derselben auf dem Stande der neuesten Errungenschaften aus. Auch Richard Wagner war bekanntermaßen ein früher Vertreter derjenigen, welche die Inszenierung als autonome Kunstform ansahen; und Max Reinhardt, der als Begründer des Regietheaters gilt, sah die Aufgabe des Regisseurs auch darin, die „toten Stücke in die lebendige Sprache der Bühne zu übersetzen“. In den sechziger und siebziger Jahren waren es Peter Zadek, Peter Stein, Klaus Grüber, Hans Neuenfels und andere, die im so genannten „Bremer-Stil“ mit herkömmlichen Inszenierungsformen brachen, die prinzipielle Mehrdeutigkeit von Texten ernst nahmen und neue Freiheiten im Umgang mit den Klassikern erkämpften. Sie inszenierten, was ein Text meinte, und nicht bloß, was er sagte!
Wer eine Rückverpflichtung der Bühne auf den Text postuliert, missachtet aber nicht nur die historischen Tatsachen, sondern auch die ästhetische Eigenständigkeit der Kunstform Theater, die sich vom Primat des geschriebenen Werkes emanzipiert hat. Ein Beleg dafür ist auch, dass sich das Texttheater selbst gewandelt hat. Autoren wie Heiner Müller oder Elfriede Jelinek haben der ästhetischen Eigenständigkeit des Theaters in entscheidendem Maße Rechnung getragen, indem sie auf Anweisungen verzichtet und die performative Dimension der szenischen Übersetzung in die Texte eingearbeitet haben.
Der Angriff auf das Regietheater ist darüber hinaus auch ein Angriff auf das Theater an sich, denn er negiert den ontologischen Status des Theaters als ein Ereignishaftes, Vergängliches und radikal Präsentisches, das Gegenwart, Zeitbezogenheit, Aktualität immer erst herstellen musste und muss. Denn Theater ist Auseinandersetzung mit Gegenwart, und so gesehen ist Regietheater, das einen Text als Material begreift, Befragung der Gegenwart anhand alter Stücke, wobei deren Zeitgenossenschaft immer erst herzustellen, zu erfinden ist. Wenn es gelingt, die Ferne alter Texte produktiv zu verbinden mit phantasievoller Vergegenwärtigungsfreiheit, dann kann das im besten Fall dazu führen, dass neue Aspekte, Bezüge, Bedeutungsebenen aufgedeckt werden, im schlechteren Falle führt es zu einer Verarmung, zu Langeweile und Überdruss.
Ernsthaftigkeit gegenüber dem Text
Die ständige Erneuerung der szenischen Erscheinungsformen des Theaters ist selbstverständlich und Pflicht für Theaterschaffende. Gerade im Zeitalter der Medien bedarf das Theater der steten Erweiterung seines szenischen Vokabulars, denn es unterliegt auch dem Wandel der von anderen Medien geprägten Seh- und Hörgewohnheiten und der damit zusammenhängenden Erlebnisbereitschaft seines Publikums.
Das soll nun gewiss nicht heißen, dass mit jedem Werk nach Belieben verfahren werden darf. Aber der freie Umgang mit Texten ist die Voraussetzung für zeitgenössisches, also uns berührendes und in diesem Sinne lebendiges Theater. Wichtig ist, dass mit dem in den Texten Erzählten seriös umgegangen wird, dass dem dramatischen Text bei seiner Umformung in Theater mit Ernsthaftigkeit begegnet wird. Das heißt aber eben nicht, dass das literarische Wort so „sakrosankt“ werden darf, dass es wichtiger wird als die Figur, die es spricht. Denn aus dieser Art von Texttreue entsteht kein szenisches Leben.
Eigentlich ist es ganz einfach: Es gibt kein Regietheater, sondern nur gutes und schlechtes Theater.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!